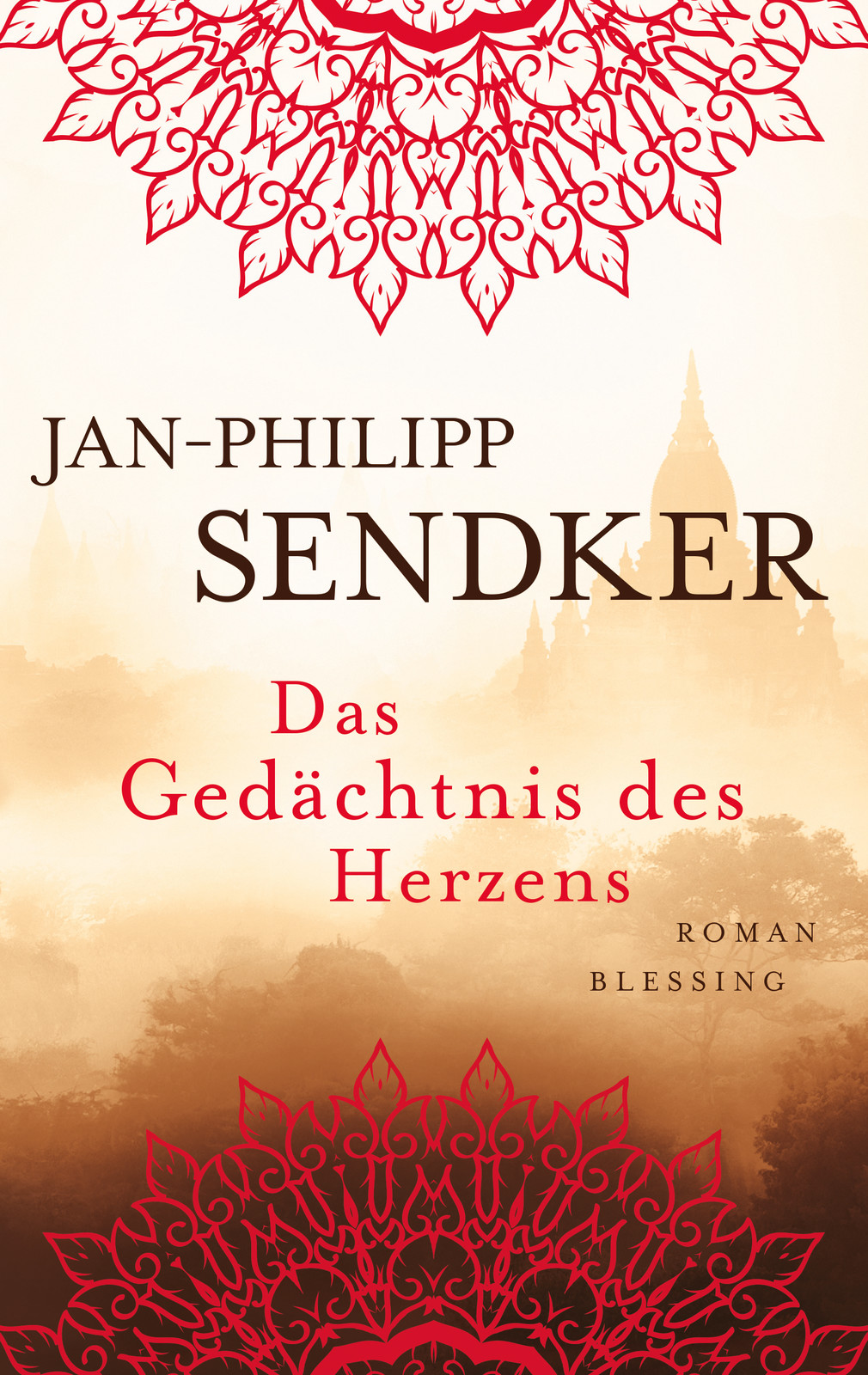
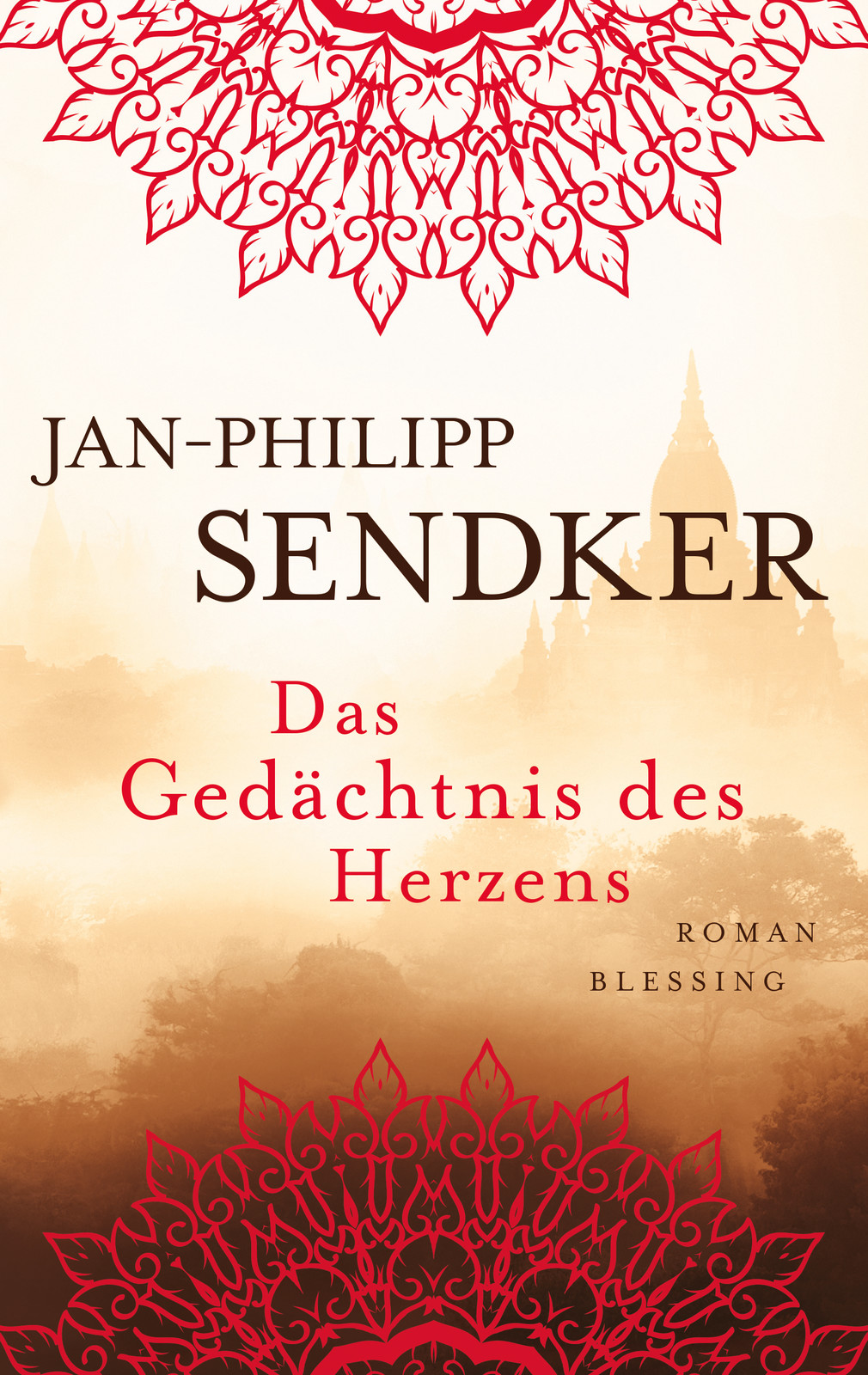
Ko Bo Bo ist zwölf Jahre alt und lebt allein mit seinem Onkel U Ba in Kalaw, einem kleinen, in den Bergen Burmas versteckten Ort. Er ist ein ungewöhnliches Kind mit einer ungewöhnlichen Gabe: Was die Menschen fühlen, kann er in ihren Augen lesen. Sein Vater kommt ihn einmal im Jahr besuchen, an seine Mutter hat er kaum eine Erinnerung. Als seine Sehnsucht nach ihr übermächtig wird, beginnt sein Onkel ein gut gehütetes Geheimnis zu lüften.
Anfangs zögerlich, dann immer detaillierter, erzählt U Ba ihm die Geschichte einer großen Liebe: von zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten, die sich im Wirbel politischer Ereignisse fast verlieren, von einer Tapferkeit, der ihrer beider Herzen nicht gewachsen waren, und von der geheimnisvollen Krankheit seiner Mutter. Überzeugt davon, sie heilen zu können, macht sich Bo Bo eines Nachts heimlich und ganz allein auf die Suche nach ihr.
Der Autor
Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war viele Jahre Amerika- und Asienkorrespondent des Stern. Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000 seine eindringliche Porträtsammlung Risse in der Großen Mauer. Nach dem Welterfolg Das Herzenhören (2002) folgten die Bestseller Das Flüstern der Schatten (2007), Drachenspiele (2009), Herzenstimmen (2012), Am anderen Ende der Nacht (2016) und Das Geheimnis des alten Mönches (2017). Seine Romane sind in mehr als 35 Sprachen übersetzt.
Jan-Philipp Sendker
Das Gedächtnis
des Herzens
Roman
Blessing
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Jan-Philipp Sendker
Copyright © 2019 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie,
nach einer Idee von Hauptmann & Kompanie
Umschlagabbildung: Getty Images/Benjawan Sittidech;
Shutterstock/Music and Art Studio
Herstellung: Gabriele Kutscha
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-24883-3
V002
www.blessing-verlag.de
Für
Anna, Florentine, Theresa,
Jonathan und Dorothea
ERSTER TEIL
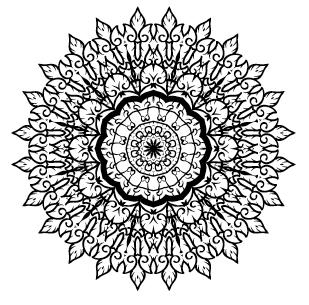
1
Alle Geschichten handeln von der Liebe, sagte mein Onkel. Die großen und die kleinen, die schönen und die nicht so schönen, jene, die uns traurig machen, und jene, die uns trösten sollen.
Wir saßen in der Küche auf dem Boden, draußen war es dunkel und etwas kühler geworden. Mein Onkel begann zu frieren, ich stand auf, holte eine Decke, legte sie ihm um die Schultern und setzte mich wieder.
Vor uns knisterte ein Feuer. Ich schaute in die Glut und hörte ihm zu, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob ich alles richtig verstand, was er mir erzählte.
Ob die Geschichten vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden in fernen, fremden Ländern erdacht wurden, erklärte er, oder gestern Abend in einer kleinen Hütte auf der anderen Seite des Flusses: Alle großen Erzählungen kennen nur ein Thema. Die Sehnsucht des Menschen nach der Liebe.
Hörst du, Bo Bo?
Ich nickte.
Es gibt keine größere Kraft, fuhr er mit ruhiger Stimme fort, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Die Zahl ihrer Gesichter und Farben, ihrer Sprachen und Formen ist endlos. Deshalb hat die Dichter auch nie etwas anderes beschäftigt und wird sie auch nie etwas anderes beschäftigen. Und das ist auch gut so, denn wir haben die Neigung, das zu vergessen.
Er bemerkte mein verwundertes Gesicht, beugte sich zu mir, als wolle er mir ein Geheimnis anvertrauen – und schwieg dann doch.
Das kannte ich von ihm schon. In den vergangenen Wochen hatten wir viele Abende zusammen am Feuer gesessen, und er hatte mir Geschichten erzählt, die irgendwann einfach abbrachen.
Von der Zeit, als er klein war und die Welt noch groß, weil es in Kalaw keine Autos und keine Fernseher gab.
Von seiner Frau, die viel zu jung zum Sterben gewesen war.
Von seiner Mutter, die ihn gelehrt hatte, dass man Entfernungen nicht mit Schritten überwindet.
Und von einem Jungen, der angeblich Schmetterlinge an den Klängen ihrer Flügelschläge erkennen konnte.
Vieles davon klang rätselhaft. Kein Mensch kann Schmetterlinge fliegen hören. Aber es war nie langweilig, und ich folgte seinen Worten gern.
Was ist nur wieder mit mir los, hörte ich ihn murmeln. Wo soll das bloß enden? Worüber rede ich? Was kann ein Junge in deinem Alter von der Liebe wissen?
Was sollte ich ihm darauf antworten? Was weiß ein Zwölfjähriger von der Liebe?
Nichts.
Zumindest nicht viel.
Oder doch mehr, als er ahnt?
Unser Gespräch endete an dem Abend mit seiner Frage, und ich war enttäuscht. Ich hätte ihm gern noch länger zugehört, mein Onkel hat eine wunderschöne Stimme. Wenn er lange spricht, vergesse ich alles, was mir das Leben manchmal schwer macht. Wie früher, als er mir jeden Abend Lieder vorsang, bis ich eingeschlafen war.
Wie sollte ich ahnen, dass dies erst der Anfang einer langen Geschichte war? Einer Geschichte, an deren Ende ich verstehen würde, was er mir in diesen Wochen auf die verschiedenste Art und Weise, mit Worten, aber auch ohne, zu sagen versuchte.
Am nächsten Morgen begann mein Onkel, von seiner jüngeren Schwester zu erzählen. Das war etwas Besonderes.
Er lag unter einer leichten Decke auf dem Sofa, ich hatte ihm zwei kleine Kissen unter den Kopf geschoben, einen Tee gekocht und mich auf den Boden vor ihn gehockt. Seine Augen waren wieder zugefallen. Der Mund stand einen Spalt offen, es sah aus, als wäre er eingeschlafen. Es hatte zu regnen aufgehört, die Vögel zwitscherten, ich wollte leise aufstehen, in den Hof gehen und die Hühner füttern, da flüsterte er meinen Namen.
»Bo Bo«, fragte er, »bist du da?«
Statt zu antworten, nahm ich seine Hand. Das mache ich oft, sie ist so schön warm und weich. Er lächelte, ohne die Augen zu öffnen. Ich hielt sie fest, das hat er gern, besonders, wenn er müde ist oder nachts aufwacht, nach mir ruft, weil er nicht wieder einschlafen kann.
In letzter Zeit ist er oft müde, vor allem am Morgen. Manchmal habe ich Angst, dass er krank wird, aber er sagt, ich solle aufhören, mir ständig Sorgen zu machen. Es liege nur an seinem Alter, mit bald achtzig Jahren sei ein Mensch nun einmal hin und wieder müde. Ich kann nicht sagen, ob das so ist, denn ich bin ja erst zwölf, und andere Achtzigjährige kenne ich nicht. Zumindest nicht so gut.
Wir schwiegen eine Weile. Im Hof knarzte der Bambus im Wind, um uns herum summten ein paar Fliegen. Von den Nachbarn wehte der Duft eines frischen Currys herüber. U Ba drückte meine Hand und begann zu erzählen.
Seine Schwester habe ein großes Herz und sei die schönste Frau, der er je begegnet sei, abgesehen von seiner Ehefrau natürlich. Und seiner Mutter. Ihre Bewegungen seien so elegant und anmutig wie die einer Tänzerin. Ihre Augen würden leuchten mit einer Kraft, wie er es nie zuvor erlebt habe, und an ihrem Lachen könne sich ein Mensch erwärmen.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich mich nicht erinnere, wie sie aussieht oder wie ihr Lachen klingt und ob man sich daran wirklich wärmen kann.
»Seid ihr euch ähnlich?«, wollte ich wissen.
Er dachte lange nach, und ich fürchtete schon, er würde nun schweigen.
»Ja und nein«, sagte er schließlich. »Das ist so mit Geschwistern. In manchen Dingen sind sie sich ganz vertraut, und in anderen sind sie sich so fremd, dass es wehtut.«
Ich habe keine Geschwister, oder falls ich welche habe, kenne ich sie nicht, deshalb kann ich das nicht beurteilen. Ich habe U Ba, meinen Onkel, und der ist mir nicht fremd, jedenfalls nicht so, dass es wehtut.
»Wie viele Kinder hat sie?«, fragte ich vorsichtig.
U Ba neigte den Kopf von einer Seite zur anderen und runzelte dabei die Stirn, ohne etwas zu erwidern. Ich hatte keine Ahnung, was er mir mit dieser Geste sagen wollte. Erwachsene sind nicht immer leicht zu verstehen, finde ich.
Es gab so viel, was ich ihn über seine Schwester gern gefragt hätte. Zum Beispiel, ob sie gesund ist, ob es ihr gut geht und ob sie uns vielleicht einmal besuchen kommen könnte, aber ich wusste, dass ich von ihm auch darauf keine Antworten bekommen würde.
Damit er nicht ganz aufhörte zu erzählen, setzte ich mich zu ihm aufs Sofa, nahm seine Füße in meine Hände und begann, sie zu massieren. Das tat ihm gut und machte ihn an den meisten Tagen gesprächiger.
»U Ba, erzähl mir mehr von ihr«, bat ich ihn in der Hoffnung, vielleicht etwas Neues über sie zu erfahren. »Erzähl mir ihre Geschichte.«
»Später einmal«, erwiderte er und gähnte.
»Nein, jetzt. Bitte.«
Aber nun schwieg er, öffnete kurz seine Augen, lächelte mir zu. Er sah erschöpft aus.
Kurz darauf rutschte sein Kopf auf dem Kissen zur Seite. Eine Fliege setzte sich auf seine Wange und krabbelte bis zur Nasenspitze, ich verscheuchte sie mit ein paar Handbewegungen.
»U Ba«, flüsterte ich. »U Ba.« Aber er rührte sich nicht.
Um ihn nicht zu wecken, blieb ich ein paar Minuten sitzen. Irgendwann stand ich auf und schlich in den Hof hinunter. Dort wartete wie jeden Tag meine Arbeit auf mich: die Hühner und das Schwein füttern, Wäsche waschen, Unkraut jäten. Heute musste ich auch noch mein altes Fahrrad flicken, weil ich im Matsch über eine Scherbe oder einen Nagel gefahren war.
Manchmal ist mir U Ba ein Rätsel. Warum hatte er ausgerechnet an diesem Morgen angefangen, von seiner Schwester zu erzählen? Er spricht so selten über sie. Ich glaube, er hat Angst, dass ich dann traurig werde.
Mein Onkel hat nur eine Schwester, und folglich ist sie meine Mutter.
2
Die Hühner waren hungrig. Sie liefen unruhig zwischen meinen Beinen herum, sobald ich ihnen eine Handvoll Futter zuwarf, stürzten sie sich gackernd drauf, als hätten sie seit Tagen nichts gefressen. Zwei Hennen stritten gierig um ein paar Körner, ich machte einige Schritte auf sie zu und scheuchte sie auseinander.
Hungrige Tiere sind mir unheimlich. Selbst Hühner.
Während ich sie fütterte, versuchte ich, nicht an meine Mutter zu denken, aber meine Gedanken gehorchten mir nicht.
Alle Kinder, die ich kannte, hatten Mütter, mit denen sie zusammenlebten. Fast alle. Die Eltern von Ma Shin Moe waren im vergangenen Jahr bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Die Mama von Ko Myat arbeitete in Thailand. Sie kam ihn aber jedes Jahr besuchen. Oder jedes zweite.
Als ich länger nachdachte, fielen mir noch Ma San Yee und Maung Tin Oo ein, Zwillinge, deren Mutter bei ihrer Geburt gestorben war. Ihr Vater hatte eine neue Frau, und sie hatten damit immerhin eine Stiefmutter. Die war zwar nicht sonderlich nett zu ihnen, aber sie war da.
Von meiner Mama wusste ich nur, dass sie in Yangon lebte und dass es ihr nicht gut ging. Aber ich wusste nicht, warum es ihr nicht gut ging oder was genau ihr fehlte.
Ich wusste nicht, worüber sie sich freute oder was ihr Kummer bereitete. Ob sie lieber Reis aß wie ich oder lieber Nudeln wie ihr Bruder.
Ich wusste nicht, ob sie gut schlief oder ob sie vielleicht nachts aufwachte und, wie U Ba, nach mir rief und ich nicht für sie da war.
Ich wusste nicht, wie sie roch. Wie ihre Stimme klang. Wie ähnlich ich ihr sah.
Ich konnte mich nicht einmal daran erinnern, wann ich sie das letzte Mal gesehen hatte.
Früher besaß U Ba ein Foto von ihr, er benutzte es als Lesezeichen. Darauf waren meine Mutter, mein Onkel und ich zu sehen. Wir standen auf einer verschneiten Veranda, alle dick eingepackt mit Mützen und Handschuhen. Meine Mutter hielt mich im Arm. Ich war in eine Decke gewickelt und noch sehr klein, ein Baby. Wir schauten alle sehr ernst in die Kamera.
Dann vergaß er das Buch im Hof, und ein heftiger Regenschauer weichte die Seiten auf und das Bild gleich mit. Seitdem ist meine Mutter ein besonders schöner zerflossener bunter Fleck zwischen zerflossenen bunten Flecken.
Um mich abzulenken, begann ich, laut zu zählen. Das ist eine Angewohnheit von mir. Wenn ich an etwas nicht denken will, zähle ich einfach, und wenn mich etwas besonders bedrängt oder bedroht, zähle ich Dinge. Die Früchte eines Avocadobaumes zum Beispiel. Die Blüten eines Hibiskusbusches. Die Speichen meines Fahrrads. Oder einfach Treppenstufen.
Eins-zwei-drei-vier-fünf-sechs-sieben-acht-neun-zehn-elf-zwölf-dreizehn-…
Die Gedanken machten mit mir trotzdem, was sie wollten.
Meine Mutter ging mir nicht aus dem Kopf.
Ich lief an den Hühnern vorbei in die hinterste Ecke unseres Hofes und hockte ich mich vor den Ameisenhaufen.
Er war schon wieder größer geworden und reichte mir fast bis zur Hüfte. Zwei schwarze Pfade, auf denen bestimmt Tausende von Tieren krochen, führten unter den Bougainvilleabüschen entlang zum Papayabaum, dahinter machten sie aus mir nicht erklärlichen Gründen einen scharfen Bogen und verschwanden hinter der Hecke im Dickicht des Nachbargrundstücks.
Ich mochte es, Ameisen zu beobachten. An ihnen konnte ich sehen, dass Stärke nichts mit Größe zu tun hatte. Sie schleppten Blätter, Nadeln, Borkestückchen, die viel schwerer wogen als sie selbst.
Legte ich ihnen Stöcke oder Steine in den Weg, hielten sie kurz an, ertasteten sie mit ihren winzigen Beinchen und Fühlern und liefen dann entweder darüber hinweg, darunter hindurch oder daran vorbei, egal wie groß oder breit die Hindernisse waren. Es waren Tiere, die ein Ziel hatten, die sich auf dem Weg dorthin nicht aus der Ruhe bringen und von nichts beirren ließen.
Das beruhigte mich.
Außerdem zeigten sie keine Angst. Wenn ich mich ihnen näherte und mit dem Fuß aufstampfte, ignorierten sie mich und setzten einfach ihre Wege fort, anstatt in alle Richtungen zu fliehen, wie es Käfer, Würmer und Asseln tun, wenn ich einen Stein hochhebe.
Ich saß vor den Ameisen, konzentrierte mich nur noch auf das Wimmeln vor meinen Augen und vergaß die Zeit.
Irgendwann fühlte ich mich besser und ging zurück zum Haus.
Auf der Treppe lagen ein paar Hemden von meinem Onkel, die beiden grünen Longys meiner Schuluniform und ein Knäuel T-Shirts. Daneben lehnte der Rechen, mit dem ich das Unkraut jäten sollte. Ich hatte nicht die geringste Lust, die Wäsche zu machen oder in den matschigen Beeten herumzukriechen, und schaute lieber nach U Ba.
Er lag noch immer auf dem Sofa und rührte sich nicht. Seine Decke war auf den Boden gerutscht, ich hob sie auf und faltete sie zusammen, es war warm geworden.
Statt den Reifen zu flicken, nahm ich das zweite Rad und fuhr in den Ort.
Es war Markttag, in der Stadt waren mehr Menschen, mehr Autos und Motorräder unterwegs als sonst. Ich musste aufpassen, fast hätte mich ein Moped von der Fahrbahn gedrängt.
U Ba sagt, es ist noch nicht lange her, da fuhren in Kalaw weder Autos noch Motorräder. Man lief zu Fuß, nahm das Fahrrad oder eine der vielen Pferdekutschen. Am Abend wurde um neun Uhr der Strom abgestellt, und eine wunderbare Stille zog ein. Wer es sich leisten konnte, zündete Kerzen an, wer nicht, ging schlafen. Es gab weder Computer noch Telefone, und es kamen keine fremden Besucher.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Heute ist jeder Erwachsene mit seinem Mobiltelefon beschäftigt. Was haben die früher den ganzen Tag über gemacht?
Auf dem Markt waren die meisten Stände mit Regenplanen überspannt, darunter herrschte ein großes Gedränge. Es roch nach getrockneten Fischen, nach Koriander und frisch gemahlenem Chilipfeffer. Um die Fleischstände machte ich einen Bogen, den Gestank von ausgenommenen Tieren mag ich nicht, er hängt mir noch Stunden später in der Nase.
Trotz der vielen Menschen hatte ich das Gefühl, nur noch Mütter mit ihren Kindern zu sehen. Manche hatten sie zwischen Karotten und Kartoffeln auf den Schoß gelegt, andere auf den Rücken gebunden oder hielten sie in ihren Armen. Die Frauen streichelten ihre Kinder. Fütterten sie. Sangen ihnen Lieder vor oder wiegten sie in den Schlaf.
Ihr Anblick machte mich wieder traurig. Unruhig und ziellos streifte ich umher. Am liebsten wäre ich zurück nach Hause gefahren und hätte mich zu meinem Onkel auf das Sofa gelegt, aber U Ba hatte mich gestern gebeten, ihm Tee und eine Packung Cheroots zu kaufen. Ich besorgte noch Eier und Gemüse fürs Mittagessen, eine Tüte Kekse und zwei Bund gelbe und weiße Chrysanthemen für unseren Altar. Bei einem Stand für Süßigkeiten kaufte ich zwei Stück Milchkuchen für meinen Onkel. Er trug es mir nie auf, doch ich wusste, wie gern er ihn mochte. Ich stieg wieder auf das Fahrrad und fuhr zu Ko Aye Min.
Sein Büro liegt in einer Seitenstraße nicht weit vom Markt entfernt. Vor der Tür steht ein Schild mit der Aufschrift »Abenteuertouren mit Aaron«. So nennt er sich, weil er fürchtet, dass sich die Kunden seinen burmesischen Namen nicht merken können. Er arbeitet als Touristenführer, das heißt, er bekommt Geld dafür, mit anderen Menschen spazieren zu gehen. Ich habe ihn schon oft gefragt, was das für eine seltsame Arbeit ist, mit Besuchern in der Gegend herumzulaufen, und warum er dafür auch noch bezahlt wird. So etwas macht man doch eigentlich aus Freundlichkeit oder, wenn sie den Weg nicht kennen und sich verlaufen haben, aus Hilfsbereitschaft. Er sagt, das nenne man »Tourismus«, und davon verstünde ich noch nichts.
Wieso es ein Abenteuer sein soll, mit ihm in die Dörfer der Pa-O, Karen, Danu oder Palong rings um Kalaw zu wandern, ist mir unerklärlich, aber in der Trockenzeit kommen eine Menge Fremde in unsere Stadt, und Ko Aye Min ist sehr beschäftigt. Manchmal ist er über viele Wochen jeden Tag unterwegs, und ich sehe ihn selten. In der Regenzeit hingegen besuchen uns nur wenige Menschen, dann hat er nicht viel zu tun, sitzt oft in seinem Büro und hat Zeit für mich. Wir spielen Schach zusammen oder reden über Fußball. Er hat keine Frau und keine Kinder. Bis vor Kurzem hatte er eine Freundin, aber die wohnte in der Nähe von Mandalay. Ihren Eltern wollte sie ihn nicht vorstellen, deshalb sahen sie sich nicht so oft. Wenn sie ihn besuchte, hatte er nicht viel Zeit für mich. Aber das war in Ordnung. Sie blieb nie lange, und irgendwann kam sie gar nicht mehr.
Ko Aye Min ist eine Art Bruder für mich, auch wenn er schon etwas älter ist. Ungefähr dreißig, glaube ich. Das macht nichts. Wir können über ganz viel reden, und wenn mir nicht nach Reden zumute ist, wie heute, können wir über ganz viel schweigen.
Er weiß sehr genau, was er mich fragen darf und was nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die wissen mehr als andere, ohne dass man ihnen viel erklären muss.
Er hat mich noch nie nach meiner Mutter gefragt.
Er hat mich noch nie auf meine Narbe angesprochen.
Im Gegensatz zu den Kindern und Lehrern in der Schule. Sie ist dunkelrot, breit wie ein Streichholz und reicht vom linken Mundwinkel bis fast hinauf zum Ohr. Da wir zu Hause keinen Spiegel haben, glaubt U Ba, dass ich sie nicht oft sehe. Da irrt er. Ich sehe sie jedes Mal, wenn mir jemand ins Gesicht blickt.
An manchen Tagen spüre ich ein Ziehen in der Narbe, dann weiß ich, dass sich das Wetter ändert.
An anderen Tagen tut sie weh und brennt, dann weiß ich, dass es mir nicht so gut geht.
Ko Aye Min freute sich, mich zu sehen. Er saß im hinteren Teil des Büros und las in einem Buch. Auf seinem Schreibtisch lagen ungeöffnete Briefe, ein paar Zeitungen und Landkarten. Zwischen seinen Beinen klemmte eine halb volle Coca-Cola-Flasche.
Er legte das Buch zur Seite. »Hallo, Sherlock.« So nannte er mich manchmal, seit wir zusammen ein paar Sherlock-Holmes-Filme gesehen hatten. Er sagte, ich würde ihn, mit meinen ewigen Fragen und meinem Scharfsinn, an den Detektiv erinnern. »Schön, dich zu sehen. Wie geht’s?«
»Gut. Und dir?«
»Auch gut.«
Das war geschwindelt. Ihm war schwer ums Herz, und zwar ziemlich. Mich konnte er nicht täuschen, denn ich besitze eine Gabe, die mir selbst unheimlich ist: Was ein Mensch fühlt, sehe ich in seinen Augen.
Ich meine natürlich nicht, dass ich weiß, dass jemand unglücklich ist, weil sie sich mit Tränen füllen. Das versteht ja jeder. Ich sehe, wenn ein Mensch traurig ist, obgleich er lacht.
Ich sehe, dass in jemandem die Wut wächst, auch wenn er äußerlich gleichgültig wirkt.
Ich sehe, wenn sich hinter Zorn eigentlich Angst versteckt.
Ich sehe das Unwohlsein, das die freundliche Stimme gern verbergen möchte.
Augen sind verräterisch. Augen können sich nicht verstellen. Sie können nicht lügen, selbst wenn sie wollten. Sie erzählen mir oft mehr, als ich wissen möchte, und das ist nicht schön. Ich schaue niemandem gern dabei zu, wie er die Unwahrheit sagt.
Deshalb habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, den meisten Menschen nicht zu lange ins Gesicht zu gucken und mich ihren Blicken zu entziehen.
Wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, schaue ich hin, ohne hinzuschauen. Das ist wie jemandem zuhören, ohne wirklich zuzuhören.
Mein Onkel ist der Einzige, der davon weiß. Als ich es ihm erzählte, zog er in Gedanken versunken an seiner erloschenen Cheroot, schüttelte hin und wieder den Kopf, als könne er kaum glauben, was er da hörte. Ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass er an meinen Worten zweifelte.
Einmal unterbrach er mich und erkundigte sich, ob ich auch ein besonders feines Gehör hätte. Keine Ahnung, wie er darauf kam. Am Ende wollte er wissen, woran ich die verschiedenen Gefühle erkennen würde. Die Frage konnte ich ihm nicht beantworten. Ich sehe es einfach. Für mich können Augen flimmern, glitzern oder so glühen wie heiße Glut im Feuer. Sie können leuchten, zittern, mit Schatten durchzogen und im nächsten Moment fast durchsichtig sein. Sie können auch bei Menschen so leer schauen wie die eines toten Vogels oder fast platzen vor Angst wie die eines Huhns vor dem Schlachten. Augen können trübe sein wie das Wasser einer matschigen Pfütze oder blenden wie das Licht der Sonne. Jeder Ausdruck hat endlos viele Schattierungen, und immer hat alles seine ganz eigene Bedeutung.
Mein Onkel meinte, Säuglinge hätten in den ersten Monaten ihres Lebens eine ähnliche Begabung, sie würden in den Augen ihrer Mütter lesen können, wahrscheinlich hätte ich es einfach nicht verlernt. Seitdem haben wir nie wieder darüber gesprochen, doch habe ich den Eindruck, dass er sich in manchen Momenten von mir nicht mehr in die Augen schauen lassen möchte.
U Ba sagt, es gibt in Kalaw den einen oder anderen, der Gedanken lesen kann. Der alte Astrologe zum Beispiel. Der greise Mönch im Kloster auf dem Hügel über der Stadt angeblich auch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich jedenfalls habe keine Ahnung, was Menschen denken. Selbst wenn sie es mir verraten, fällt es mir oft schwer zu verstehen, was sie sagen.
In den Augen von Ko Aye Min sah ich, dass ihn etwas bedrückte. Nun konnte ich mir überlegen, was es sein könnte. Vor diesem Problem stehe ich oft. Ich sehe den Menschen an, ob sie betrübt, glücklich oder ängstlich sind, aber warum sie es sind, weiß ich nicht. Manchmal behaupten sie, es gehe ihnen gut, gleichzeitig sehe ich, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Früher traute ich ihren Worten mehr als ihren Augen, habe aber gelernt, dass das ein Fehler ist.
Ko Aye Min schwieg und trank einen Schluck von seiner Cola. »Möchtest du was trinken?«
»Nein danke.« Eine Weile starrte ich auf die große Landkarte Burmas, die hinter ihm an der Wand hing. »Hast du etwas Neues zu lesen für mich?«
Er stand auf und ging zu einem Schrank, in dem er seine Bücher aufbewahrte. Reisende, mit denen er wanderte, ließen ihm gern ihre ausgelesenen Exemplare zurück. Mit den finnischen, koreanischen oder französischen Ausgaben konnten wir natürlich nicht viel anfangen, über die englischen freuten wir uns umso mehr, sie waren in Kalaw sonst nicht zu bekommen, und wir lasen beide viel. Er neigte den Kopf zur Seite und studierte aufmerksam Buchrücken für Buchrücken. Schließlich zog er eins heraus und reichte es mir.
»Internationaler Bestseller« stand fettgedruckt auf dem Umschlag. Der Autor, John Green, sagte mir nichts, ich warf einen kurzen Blick auf den Titel, »The Fault in Our Stars«, und gab es ihm wieder. »Nein danke. Ich interessiere mich nicht für Astrologie.«
»Darum geht es nicht. Es ist wirklich gut. Versprochen.«
Ich steckte es in die Tüte zu den Einkäufen. »Danke.«
»Möchtest du an den Computer?«
Ich schüttelte den Kopf.
Bei ihm steht ein Rechner, und den darf ich benutzen, wenn er ihn nicht braucht. Wir haben zu Hause keinen Computer, nicht mal einen Fernseher, und unser Telefon muss sehr alt sein, man kann damit nur telefonieren.
Es ruft aber so gut wie nie jemand an. Und im Adressbuch steht nur eine Nummer.
U Ba sagt, wir bräuchten kein moderneres. Sein Herz sei nicht groß genug, um die ganze Welt hineinzulassen. Und meins noch zu jung.
»Wollen wir Schach spielen?«, fragte ich.
Ko Aye Min nickte. Er holte aus einer Vitrine die Figuren und sein neues Brett, das ich ihm vor einigen Wochen geschenkt hatte. Es war aus Teak, mit U Bas Hilfe hatte ich Holzstücke zurechtgesägt, zusammengeklebt und die Felder daraufgemalt. Das alte war aus Plastik gewesen und eines Nachts von Ratten zerfressen worden. Er stellte die Schachuhr auf den Tisch, ich baute auf, wir spielten zwei kurze Partien, die er beide ohne große Anstrengung gewann.
»Was ist los mit dir?« Er war ein guter Spieler, ich eigentlich auch, aber heute war ich mit meinen Gedanken woanders.
Wie anmutig bewegt sich eine Tänzerin?
Wie schön können Augen leuchten?
Wie klang ein Lachen, an dem man sich erwärmen konnte?
»Nichts«, antwortete ich. »Nichts.«
3
Narbenfratze. Du hässliche Narbenfratze.«
Ich drehte mich um: Vor mir stand Soe Aung. Er mochte mich so wenig wie ich ihn. Er war ein Großmaul, vor dem alle Angst hatten, weil er zwei ältere Brüder hatte, die ebensolche Angeber waren. Jetzt war er wütend auf mich, weil ich ihn bei der Englischprüfung nicht hatte abschreiben lassen.
»Narbenfratze.«
»Wenn du das noch einmal sagst, knall ich dir eine.« Für einen Moment dachte ich an U Ba und seine Ermahnungen. Sei freundlich zu unfreundlichen Menschen, sie brauchen es am meisten, sagte er immer. Aber das war mir jetzt egal.
»Narbenfratze.« Er zog eine fiese Grimasse.
Ich schlug schneller zu, als er sich ducken konnte. Das Klatschen meiner Hand auf seiner Wange klang gut, es war auf dem halben Schulhof zu hören. Er versuchte, mich zu packen und auf den Boden zu schmeißen, aber ich war stärker und nahm ihn in den Schwitzkasten. Sofort waren wir umringt von anderen Jungs. Er trat nach mir, versuchte, mich zu beißen, zu kratzen und mich an den Haaren zu ziehen. Wir hatten uns schon öfter gerauft, aber noch nie so heftig. Wenn wir uns prügelten, dauerte es leider nie lange, bis jemand Soe Aungs größere Brüder zu Hilfe holte. Ich spürte ihre kräftigen Hände an meinen Schultern. Sie zerrten mich von ihm fort, boxten mich in den Bauch und gegen die Brust und schubsten mich so lange hin und her, bis ich der Länge nach in den Matsch fiel und mir die Lippe aufschlug.
Eine Lehrerin trennte uns. Die drei kamen, wie fast immer, mit einer Ermahnung davon, ich musste zur Schulleiterin.
Sie war eine kleine Frau, kaum größer als ich, mit einer kalten, scharfen Stimme. Ihr Blick verhieß nichts Gutes, in ihm loderte Wut.
»Du schon wieder«, fluchte sie.
Sie erwartete von mir, dass ich meinen Kopf senkte, aber das konnte ich nicht. Stattdessen streckte ich meinen Rücken, stellte ich mich aufrecht hin und schaute geradeaus an die Wand.
Sie holte ihren Stock aus der Ecke, ich musste meinen Longy bis über die Hüfte hochziehen und schloss die Augen. Ich stellte mir einen Mangobaum vor und begann leise, seine Früchte zu zählen.
Eins.
Zwei.
Drei.
Beim ersten Hieb zuckte ich, beim zweiten auch, die anderen spürte ich kaum noch.
U Ba hockte auf der obersten Treppenstufe hinter einem Vorhang aus Wasser, der sich aus der überlaufenden Dachrinne ergoss. Neben ihm stand unser Radio. Er hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, einmal am Tag die große Welt doch in sein Herz zu lassen, indem er die Nachrichten der BBC hörte. Dabei verfinsterte sich seine Miene jedes Mal. Ich wunderte mich, warum er täglich etwas tat, wovon er schlechte Laune bekam.
Er sah meine nassen, dreckigen Sachen, den Riss in meinem Hemd, die Blutflecken darauf und wusste gleich, was passiert war.
Ich schlich an ihm vorbei ins Haus, zog mir schnell einen sauberen Longy und ein trockenes T-Shirt an und setzte mich zu ihm.
Mein Onkel schaltete das Radio aus, legte eine Hand auf mein Knie und schwieg. Ein Gecko huschte an uns vorbei, ein zweiter folgte ihm. Sie suchten im Haus Schutz vor dem Regen.
»Hast du Hunger? Soll ich etwas zu essen machen?« Er hatte meine Fragen nicht verstanden, ich beugte mich zu ihm und wiederholte sie etwas lauter.
»Nein danke«, sagte U Ba. »Mir geht es gut.«
Fette Tropfen prasselten aufs Wellblechdach und die Blätter der Bananenstauden im Hof, ihr Tosen machte es schwer, sich zu unterhalten. Das war mir sehr recht.
»Gab es Ärger in der Schule?«, fragte er nach einer langen Pause.
»Ja. Soe Aung, dieser …«. Ich biss mir auf die Zunge und fügte hastig hinzu: »Er hat mich hässliche Narbenfratze genannt.«
»Ist das ein Grund, sich zu prügeln?«
»Nein. Aber wenn ich es mir immer gefallen lasse, dann …«, erwiderte ich leise.
»Was dann?«
»Dann, dann …« Ja, was dann? Ich wusste es auch nicht. Ich wusste nur, dass mich die Wut überkommen hatte, und konnte nicht einmal behaupten, dass es mir leidtat.
»Muss ich zur Direktorin?«
»Ich glaube schon. Diesmal ist es ernst.«
»Das habe ich mir gedacht«, seufzte er. Mehr sagte er nicht. Er drückte noch einmal sanft mein Knie, stützte den Kopf auf seine Hände und schaute sorgenvoll in den wassergetränkten Hof. Seine Schultern waren nach unten gefallen, sein Oberkörper nach vorn gebeugt. Zum ersten Mal fiel mir auf, dass ich größer und kräftiger war als er. Wahrscheinlich war das schon eine Weile so, und ich hatte es nicht bemerkt. Ich blickte auf die welke Haut seiner dünnen Oberarme, sah die Rückenwirbel, die sich auf seinem T-Shirt abzeichneten. Der Gedanke, dass ich stärker war als mein Onkel, der, solange ich denken konnte, für mich gesorgt und darauf geachtet hatte, dass mir kein Unheil geschah, beschämte mich, auch wenn ich natürlich wusste, dass es nicht meine Schuld war, sondern der Lauf der Dinge. Ich wollte es trotzdem nicht!
Ich dachte an unser Schachspiel in der vergangenen Woche. Gleich zu Beginn der Partie war er unachtsam gewesen und hatte eines seiner Pferde verloren. Kurz darauf noch einen Bauern. Je länger wir spielten, desto deutlicher sah ich, wie mühsam es für ihn war, meinen Kombinationen zu folgen. Ich lockte ihn in eine Falle, sieben oder acht Züge später wäre er matt gewesen, und plötzlich sträubte sich etwas in mir. Noch nie in meinem Leben hatte ich gegen ihn gewonnen. Ich begann, bewusst Fehler zu machen. Zuerst opferte ich einen Läufer, dann einen Bauern. U Ba nahm die Geschenke dankend an. Ich wusste nicht, was mir am Ende unangenehmer war, der Umstand, dass ich ihn hätte besiegen können, weil er alt und vergesslich wurde, oder dass ich ihn gewinnen ließ und er es nicht bemerkte.
Seitdem erfand ich jedes Mal eine neue Ausrede, wenn er vorschlug, zusammen Schach zu spielen.
Ich rutschte auf der Treppe zwei Stufen tiefer und nahm seine Füße in meine Hände. Ihre Haut war rau und hart. Wie die Borke eines Baumes. Sie tun ihm oft weh, dann fällt ihm das Gehen schwer, und er bleibt auf dem Sofa sitzen oder eben draußen auf der obersten Treppenstufe, und ich massiere sie.
Mit meinen Knöcheln drückte ich kräftig gegen seine Sohlen.
»Das tut gut.«
Es war nicht schwer, meinem Onkel eine Freude zu machen. Es gibt viele Schlüssel zum Glück, sagte er immer. Einer von ihnen ist die Bescheidenheit. Ein anderer Dankbarkeit.
Seine Fußnägel waren zu lang. Ich stand auf, holte einen Nagelknipser und schnitt sie ihm.
U Ba hob den Kopf, er wich meinem Blick nicht aus, ich hatte das Gefühl, er wollte mir etwas sagen. Seine Augen verrieten mir, dass ihm etwas auf dem Herzen lag. Aus ihnen sprach Unruhe. Ein tiefes Unbehagen. Sie flackerten leicht. In ihnen lag kein Glanz, sie waren matt, dunkel und stumpf. Ein wenig erinnerten sie mich an die Schwielen an seinen Füßen. Es gab keinen Menschen, in dessen Augen ich so gut lesen konnte wie in denen U Bas.
Eine Vorahnung überkam mich.
»Fährst du weg?«, fragte ich so beiläufig wie möglich.
Er presste die Lippen aufeinander, dann folgte ein wortloses Nicken.
Einmal im Jahr besuchte mein Onkel seine Schwester. Für mehrere Wochen blieb er fort, fast immer zu Beginn der Trockenzeit im Herbst.
Der Abschied von mir fiel ihm nicht leicht, das wusste ich, und um es ihm nicht noch schwerer zu machen, bemühte ich mich jedes Mal, mir nicht anmerken zu lassen, dass auch ich traurig war.
Aber ich hatte einen Trost: Immer wenn U Ba wegfuhr, kam mein Vater mich besuchen.
4
Bereits vor Sonnenaufgang hörte ich meinen Onkel in der Küche mit Geschirr und Töpfen klappern. Kurz darauf knisterten die ersten Scheite, der Geruch von brennendem Holz zog durch das Haus. So früh war er seit Monaten nicht aufgestanden.
Als ich ins Wohnzimmer kam, schnitt er frische Blumen für den Altar an, füllte Reis in eine kleine Schale und stellte sie als Opfergabe vor unseren Buddha. Daneben legte er zwei Bananen. Seine Routinen waren mir wohlvertraut.
Mein Onkel packte nie viel ein. Was er für die Wochen benötigte, passte in eine grüne Umhängetasche aus Kunstleder: ein zweiter Longy, etwas Unterwäsche, drei Hemden, ein Notizbuch. Obwohl er zu Hause, trotz seiner schlechter werdenden Augen, jeden Tag mehrere Stunden las, nahm er keine Bücher mit. Das wunderte mich. Ein Leben ohne Bücher gab es für ihn eigentlich nicht. In ihnen fand er Trost, wenn er Trost brauchte, Zerstreuung, wenn ihm nach Zerstreuung war. Einige, so hatte er mir einmal erklärt, waren für ihn eine Art Kompass, ohne den er sich weder in der Welt noch in seinem eigenen Leben zurechtfinden würde.
In den Stunden vor seiner Abreise sprachen wir nicht viel. Das kannte ich, selbst wenn er für einen Tag in die Provinzhauptstadt Taunggyi fährt, wird er vor der Abfahrt ganz still. Er sagt immer, seine Seele reise nicht schneller, als seine Füße laufen können. Sie sei viel langsamer als die Züge oder Busse, und ich habe das Gefühl, ein Teil von ihm reist schon vorher ab, vielleicht, damit er, wohin er auch fährt, als Ganzes ankommt.
Ich holte Wasser aus der Tonne im Hof und machte es in einem Kessel auf dem Feuer warm, um ihm die Haare zu waschen. Mir schwirrte der Kopf vor lauter Dingen, die ich vor seiner Abreise noch gern gesagt und gefragt hätte, aber mein Mund fühlte sich an wie zugewachsen, und am Ende bekam ich keinen Ton heraus.
Kurz vor dem Bahnhof überholte uns ein Militärjeep, bremste scharf, setzte zurück, bis er direkt neben uns zum Stehen kam. Auf dem Beifahrersitz erkannte ich einen Soldaten, der uns in den vergangenen Monaten häufiger besucht hatte. Als er zum ersten Mal bei uns im Hof stand, hätte ich mich am liebsten unter dem Haus bei unserem Schwein verkrochen. Er war größer und kräftiger als alle anderen Männer, die ich kannte, und sein Blick verhieß nichts Gutes. An seiner Uniform hingen bunte Abzeichen, auf seine Schulterklappen waren jeweils drei Sterne und zwei Laubblätter genäht. Er war kein gewöhnlicher Soldat, sondern ein Oberst-oder-so-ähnlich, hatte mir U Ba später erklärt.
»Wo ist dein Onkel?«, hatte er mich angeraunzt.
Ich war zurückgewichen und hatte stumm aufs Haus gezeigt. Er war mit schweren Schritten die Treppe hochgestiegen, im Hof hatte er einen sonderbaren Geruch hinterlassen.
Er war häufiger zu Besuch gekommen, jedes Mal hatte U Ba mich hinausgeschickt. Ich hätte doch sicher Arbeiten im Hof zu erledigen.
Das tat er sonst nie.
Neugierig geworden, war ich unter das Haus geschlichen und hatte ihre Gespräche durch die Ritzen in den Holzbohlen belauscht. Mein Onkel, so erfuhr ich, besaß einige Felder am Rande Kalaws. Die hatten seiner vor langer Zeit verstorbenen Frau gehört, und der Soldat wollte sie kaufen. Am liebsten sofort.
Nachdem er gegangen war, hatten uns Nachbarn erzählt, dass die Grundstücke in einem Gebiet lagen, in dem ein neuer Teil Kalaws entstehen sollte mit Villen, einem Einkaufszentrum, Golfplatz, einem eigenen Krankenhaus und Landeplatz für Hubschrauber. U Ba hatte die Felder vor vielen Jahren einigen Bauern aus einem Nachbardorf zur Nutzung überlassen und bekam dafür einen kleinen Teil ihrer Reisernte. Er beabsichtigte nicht, an dieser Vereinbarung etwas zu ändern, ganz egal wie sehr sie im Wert gestiegen waren und noch steigen würden. Das erklärte er dem Oberst-oder-so-ähnlich bei jedem seiner Besuche, mal mit vielen, mal mit wenigen Worten.
Der hörte ihm nicht zu oder verstand meinen Onkel nicht, oder er verstand ihn und nahm ihn nicht ernst. Jedenfalls erhöhte er jedes Mal sein Angebot.
»Die Menschen hören nur, was sie hören wollen«, stöhnte U Ba nach ihrem letzten Gespräch.
Jetzt lehnte sich der Soldat aus dem Autofenster und musterte meinen Onkel voller Missmut. »Sie gehen auf Reisen?«
»Ja«, erwiderte U Ba, ohne seine Schritte zu verlangsamen, sodass der Wagen neben uns herrollen musste. Das war nicht sehr höflich und ganz untypisch für ihn.
»Können wir Sie mitnehmen?«
»Das ist überaus freundlich, vielen Dank. Ich nehme den Zug, mein Neffe begleitet mich zum Bahnhof, und der ist ja glücklicherweise nicht mehr weit.«
Wir liefen neben dem Jeep, unsere Blicke starr geradeaus gerichtet.
»Haben Sie es sich überlegt?«, fragte der Soldat.
»Ihr Angebot ist sehr großzügig«, erwiderte U Ba. »Genau genommen ist es so großzügig, dass ich es nicht annehmen kann.«
»Lassen Sie das meine Sorge sein.«
U Ba ging nun so schnell, dass ich ihm kaum folgen konnte und immer wieder in den Laufschritt verfallen musste.
Plötzlich blieb er unvermittelt stehen, auch der Jeep kam mit einem Ruck zum Halten. »Ich bitte höflichst um Entschuldigung, sollte ich mich in unseren Gesprächen bisher so missverständlich ausgedrückt haben«, hob er an. »Es liegt nicht in meiner Absicht, Sie über meine Pläne im Unklaren zu lassen. Es verhält sich so, dass ich nach Ihrem letzten Besuch bereit war, auf Ihr Angebot einzugehen.« U Ba machte eine Pause, der Soldat beobachtete ihn gespannt.
»Da es sich aber um die Felder meiner Frau handelt, habe ich U Than Win aufgesucht, der ist, auf mein Bitten und dank seiner besonderen Fähigkeiten, mit ihr oder ihrem Geist, wenn Sie so wollen, in Kontakt getreten und hat sie um Erlaubnis für den Verkauf der Grundstücke ersucht. Bedauerlicherweise hat meine Frau diese Erlaubnis nicht erteilt. Sie war sogar, wenn ich es so sagen darf, empört über dieses Ansinnen. Ihrer Entscheidung kann ich mich nicht widersetzen, dafür werden Sie Verständnis haben. Mehr steht nicht in meiner Macht.«
Ich sah dem Oberst-oder-so-ähnlich in die Augen und wendete mich erschrocken ab. Mein Onkel sagt, es gebe Herzen, die seien mit Essig gefüllt.
»Es überrascht mich, dass selbst Sie an Geister glauben, U Ba.« Der Hohn in seiner Stimme. Er war auch für mich nicht zu überhören.
»Tun wir das nicht alle?«, entgegnete mein Onkel ruhig. »Jeder auf seine Art.«
Der Soldat antwortete mit einem kurzen, wütenden Schnaufen. »Haben Sie sich schon einmal überlegt, was Sie Ihrem Neffen von diesem Geld alles kaufen könnten?« Als wir nicht reagierten, fuhr er fort: »Ich fürchte, Sie machen einen Fehler. Mehr Geld werden Sie nicht bekommen.«
»Ich weiß, ich weiß.« U Ba beugte sich zum Wagenfenster, als wolle er dem Oberst-oder-so-ähnlich ein Geheimnis anvertrauen. »Das habe ich meiner Frau auch alles erklärt.« Er seufzte tief. »Es hat sie zu meinem großen Bedauern nicht umstimmen können. Sie entschuldigen mich jetzt.«
Nach diesen Worten setzte mein Onkel seinen Weg fort, und ich eilte ihm hinterher.
Für einige Meter rollte der Jeep noch neben uns, mir wurde ganz heiß vom Zorn im Blick des Soldaten, dann heulte der Motor auf, und der Wagen brauste davon.
Kaum war er außer Sichtweite, verlangsamten wir unsere Schritte wieder.
»Was für ein geduldiger Mensch«, sagte U Ba halblaut, wie zu sich selbst.
»So geduldig sah er jetzt nicht aus«, wandte ich ein.
»Weißt du, Bo Bo, es ist noch nicht lange her, da hätte er mir für die Grundstücke kein Geld geboten.«
»Was denn sonst?«
»Nichts. Er hätte sie sich genommen.«
Der Zug stand schon am Bahnsteig bereit. Händler boten Tee oder Kaffee in Plastiktüten an, Kinder, die ich aus der Schule kannte, trugen Körbe mit Bananen, Äpfeln oder Keksen auf ihren Köpfen. Zwischen uns wühlten streunende Hunde im Abfall. Koffer, Kisten und Babys wurden durch die Fenster gereicht. Wir stiegen ein, und ich versuchte, für U Ba einen Platz zu finden. Es war die Zeit des Thadin Kyut Festival, deshalb waren die Waggons überfüllt, viele Passagiere saßen in den Gängen, zwischen den Bänken, in den offenen Türen. Als der Sohn eines Nachbarn uns erblickte, stand er auf und bot U Ba seinen Platz an. Mein Onkel nahm dankend an. Für eine Weile blieb ich schweigend neben ihm stehen.
Mit einem kräftigen Ruck setzte sich der Zug in Bewegung. Einige der fliegenden Händler sprangen ab, andere stiegen auf.
U Ba drückte wortlos meine Hand. Das war unser Zeichen. Doch heute fiel es mir schwer loszulassen. Als ich es schließlich konnte, spürte ich, wie er mich festhielt.
Wir hatten Kalaw bereits hinter uns gelassen, als wir einander endlich losließen. Ich kletterte über Körbe voller Blumenkohl, Kartoffeln, Karotten und Hühner hinweg zur Tür, dort drehte ich mich noch einmal um. U Ba hatte den Kopf zur Seite gewandt und starrte aus dem Fenster.
Ich wartete.
Er rührte sich nicht.
Ich wartete.
Er rührte sich noch immer nicht.
Ich stieg auf die unterste Stufe, sprang ab, lief noch ein paar Meter neben dem Zug her und blickte ihm nach. Als er hinter der nächsten Kurve verschwand, drehte ich mich um und machte mich auf den Weg zurück nach Kalaw. Ich mochte es, zwischen den Schienen zu laufen und in großen Sprüngen von Bohle zu Bohle zu hüpfen.
Erwachsene, dachte ich dabei, sind mir ein Rätsel.
5
Wenn U Ba verreist, ist alles anders.
Unser Haus ist plötzlich größer.
Die Nächte sind kälter. Und dunkler.
Der Regen ist lauter.
Die Stille stiller.
Die Leere leerer.
Und obwohl ich mich schon sehr auf meinen Vater freute, wurde mit jeder Stunde, die mein Onkel weg war und ich allein, die Stille noch stiller und die Leere noch leerer.
Das klingt komisch, aber es war so.
Einmal habe ich U Ba gefragt, ob es ihm auch so geht, wenn ich nicht da bin.
Er dachte kurz nach. »Nein«, erklärte er. »Du bist ja immer nur ein paar Stunden weg.« Als er meine Enttäuschung sah, fügte er hinzu: »Du fehlst mir natürlich, und wärst du länger fort, würde ich mich genauso fühlen.«
Vielleicht bin ich einfach nicht gern allein.
Von draußen hörte ich die Stimmen der anderen Kinder in den Höfen und Häusern nebenan. Ein paar Jungs spielten Chinlone. Ihr Lachen machte es nicht einfacher.
Ich stellte U Bas alten Kassettenrekorder an. Er leierte zwar, und wir besaßen nur drei Kassetten mit Klaviermusik, aber das war immer noch besser als die Stimmen von draußen und die Ruhe im Haus.
Ich säuberte die Feuerstelle, fegte Küche und Schlafzimmer, holte den Buddha von unserem Altar und wischte ihn gründlich mit einem feuchten Tuch ab. Beim Entstauben der Regale fiel mir Ko Aye Mins Buch wieder in die Hände. Ich setzte mich aufs Sofa und begann zu lesen. Nach ein paar Seiten klappte ich es wieder zu. Meine Gedanken waren woanders, und wer zu abgelenkt ist, einer Geschichte zu folgen, sollte kein Buch in die Hand nehmen, sagt U Ba.
Der erste Tag war immer der schwerste.
Meine Narbe spannte wie schon seit vielen Wochen nicht mehr.
Ich ging im Haus auf und ab und begann zu zählen.
Eins-zwei-drei-vier-fünf-…
Bei hundert wurde ich ruhiger, bei fünfhundert ging es mir besser.
Mein Blick wanderte durch unser Wohnzimmer, in dem die Regale bis unter die Decke reichten. Wir besaßen mehr Bücher als der Buchhändler, der vor einigen Monaten an der Hauptstraße seinen Laden eröffnet hatte. Sie quollen aus den Regalen, lagen in Türmen auf dem Fußboden, neben dem Sofa, vor dem Bett.
Viele waren in schlechtem Zustand, und U Ba hatte es sich zur Aufgabe gemacht, sie zu restaurieren. Als ich kleiner war, hatte ich abends oft auf dem Sofa gelegen und ihm dabei zugeschaut, bis ich einschlief. Er brauchte zwei bis drei Monate für ein Buch, manchmal auch länger, je nachdem, wie dick oder dünn und wie gut es erhalten war. Ich hatte ihn schon lange nicht mehr an einem Buch arbeiten sehen. Seine nachlassenden Augen und die Hände, die immer häufiger zitterten, machten das Restaurieren noch mühsamer, als es ohnehin schon war, klagte er.
Ich wusste, wie sehr ihn das betrübte, denn U Ba glaubte, wir seien die reichsten Menschen in Kalaw, wenn nicht in den ganzen Shan-Staaten. Wir seien umgeben von Weisheit und Wissen, Schönheit und Fantasie, wer sonst könnte das von sich behaupten?
Vielleicht würde ich ihm eine Freude machen, wenn ich in seiner Abwesenheit seine Arbeit fortführte. Aus einem Regal kramte ich den Pappkarton mit den Utensilien hervor. Darin lagen ein Töpfchen, gefüllt mit weißen Papierschnipseln, und ein Glas mit grau-weißem Kleber, eine Pinzette und mehrere schwarze Stifte. Ich stellte die Sachen auf den Tisch, griff wahllos eines der alten Bücher und schlug es auf. »Der Fremde« von einem Albert Camus. Der Titel gefiel mir, und es war schön dünn. Mehr ein Büchlein. Das vergilbte Papier war angefressen von Würmern, Motten, Termiten, der feuchten Luft und den Jahren. Auf den ersten Seiten war kaum ein Satz lesbar.
Vorsichtig nahm ich mit der Pinzette einen der Schnipsel, tunkte ihn in den Kleber, legte ihn auf eines der Löcher auf dem Papier und drückte ihn mit dem Zeigefinger fest. Sobald der Klebstoff getrocknet war, zog ich mit einem spitzen Stift behutsam den Buchstaben nach. Aus »F em e« machte ich »Fremde«, aus »M tt r« wurde wieder »Mutter«, aus »K nke h s« machte ich mit viel Mühe »Krankenhaus«.
Die Arbeit war schwieriger als gedacht. Immer wieder stieß ich auf Wörter, die ich nicht kannte und deren Schreibweise und Bedeutung ich in unserer alten Ausgabe der »Encyclopedia Britannica« nachschlagen musste.
»Sargschrauben« zum Beispiel. Oder »Privatleben«. Das Wort gab es im Burmesischen gar nicht.
6
Much money, nicht many money«, flüsterte ich. Ko Thein Aung, der neben mir saß, schaute mich an.
»Was sagst du?«, fragte er leise.
»Es heißt much money, nicht many money«, wiederholte ich.
Er kicherte, während die Klasse fünfmal im Chor rufen musste: »I do not have many money.«
Ich seufzte, schwieg und schaute aus dem Fenster. Draußen regnete es, ich versuchte, die Tropfen zu zählen, die vor mir an die Scheibe klatschten. Das war genauso sinnlos wie dieser Englischunterricht.