

FBI-Agentin Emmy Dockery ist jung und engagiert. Ihre Fähigkeit, Details zu bemerken, die andere übersehen, hat ihr bereits beeindruckende Erfolge eingebracht. Doch nun stellt eine Reihe von Morden selbst sie vor ein Rätsel. Die Opfer, oft alleinstehende Senioren und Obdachlose, scheinen alle durch einen Unfall gestorben zu sein, und auf den ersten Blick gibt es keine Verbindung zwischen ihnen. Aber Emmy ist sich sicher: So viele Todesfälle können kein Zufall sein. Und so verbringt sie jede freie Minute mit der Suche nach dem Mörder. Nur dass er sie schon längst gefunden hat …
Weitere Informationen zu James Patterson sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
James Patterson
und
David Ellis
TODESGIER
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Peter Beyer
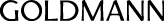
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Unsolved« bei Little, Brown and Company, Hachette Book Group, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Dezember 2019
Copyright © der Originalausgabe 2019 by James Patterson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
This edition is published by arrangement with
Kaplan / DeFiore Rights through Paul & Peter Fritz AG
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Nicolas Balcazar / EyeEm / getty images; Nik Keevil / Trevillion Images; FinePic®, München
AG · Herstellung: ik
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-25321-9
V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz





Ich bin weder bösartig noch gestört. Ich bin weder ungebildet noch arm, und ich bin auch kein Opfer von Kindesmissbrauch. Das, was ich tue, tue ich aus einem ganz bestimmten Grund.
Der Mann in der beigefarbenen Jacke lenkt seinen SUV auf den Parkplatz vor der Ladenzeile und stellt den Motor aus. Er steigt aus dem Wagen, rückt seine Jacke zurecht und fährt sachte mit der Hand über die Ausbeulung an seiner Seite, die seine verdeckt getragene Handfeuerwaffe verursacht.
Die untergehende Sommersonne wirft ein schummriges Licht auf die fast menschenleere Ladenzeile. Der Waschsalon an ihrem Ende liegt im Dunkeln, auch der Catering-Service hat schon geschlossen, das Metallgitter vor dem Fenster ist heruntergelassen. Allein der Mini-Markt, auf dessen Schaufenster Zigaretten, Bier, zwei Hotdogs zum Preis von einem sowie Powerball-Lose beworben werden, hat noch geöffnet.
Auf dem Parkplatz steht nur noch ein anderes Fahrzeug, ein rostfarbener Dodge Caravan, der mit dem Kühler zur Ladenzeile etwa acht Buchten entfernt parkt.
Mitten auf dem Parkplatz sitzt ein Mann in einem Rollstuhl. Weit vornübergebeugt, langt er zum Pflaster hinunter und plagt sich damit ab, ein Sammelsurium von Gegenständen aufzuklauben, die ihm aus seiner Plastiktüte herausgefallen sind. Zugleich hantiert er am Joystick auf der Armlehne seines Rollstuhls herum, doch vergebens – der motorisierte Stuhl reagiert nicht auf seinen Befehl.
Ein Behinderter in einem defekten Rollstuhl.
Nur Moralisten und Lemminge glauben, dass Schwäche Mitgefühl und Barmherzigkeit hervorruft. Jeder Geschichtsstudent, jeder Student der Wissenschaft weiß, dass das Gegenteil der Fall ist.
Wir müssen die Schwachen ausmerzen. Das war immer schon so, und das wird auch immer so bleiben.
Der Mann in der beigefarbenen Jacke ruft: »Soll ich Ihnen helfen, Mister?«
Mühsam richtet sich der Rollstuhlfahrer auf. Nachdem er versucht hat, die über das Pflaster gekullerten Toilettenartikel aufzuheben, ist sein Gesicht gerötet und glänzt vor Schweiß. Er trägt eine tarnfarbene Kappe und eine olivgrüne Armeejacke. Wie zu erwarten bei jemandem, der seine Gehfähigkeit eingebüßt hat, ist sein Oberkörper kräftig. Sein unrasiertes Gesicht ist wettergegerbt, mit Ausnahme einer kleinen glänzenden, mondsichelförmigen Narbe über dem rechten Auge.
»Ich könnte wohl Hilfe brauchen«, sagt der Rollstuhlfahrer. »Das wäre nett.«
»Kein Ding.«
Es geht doch nichts über gute Manieren, um seine Beute einzufangen. Das ist viel leichter, als sich auf einer Wiese auf die Lauer zu legen und darauf zu warten, dass das waidwunde Tier in der Herde ahnungslos vorbeigehumpelt kommt.
»Überhaupt kein Problem«, bekräftigt der Mann in der beigefarbenen Jacke. Schwungvoll hebt er die Zahnpasta, den Deostift und die grüne Flasche Shampoo auf, stopft alles wieder in die Plastiktüte und reicht sie dem Rollstuhlfahrer. Der scheint hin- und hergerissen zwischen Dankbarkeit und verletztem Stolz, einem Gefühl der Hilflosigkeit. Erneut hantiert er am Joystick und flucht leise vor sich hin, als der Rollstuhl nach wie vor nicht reagiert.
»Ärger mit dem Ding?«, erkundigt sich der Mann in Beige. »Soll ich Ihnen in Ihren Wagen helfen?«
Komme mir keiner mit Grausamkeit oder Mitleid. Der denkende Mensch empfindet weder Zuneigung, noch hat er Vorurteile, nur ein Herz aus Stein.
Ich bin, wie ich geschaffen wurde. Ich bin ein Produkt der Naturgesetze, nicht der Gesetze, die irgendeine nichtige menschliche Gesellschaft aufgestellt hat.
Der Rollstuhlfahrer stößt einen Seufzer aus. »Tja, also … das wäre toll.«
»Klar doch, kein Problem.« Der Mann streckt die Hand aus. »Ich bin Joe«, stellt er sich vor.
»Charlie«, sagt der Rollstuhlfahrer und schüttelt ihm die Hand.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Charlie. An welche Seite Ihres Vans soll ich Sie schieben?«
»Zum Heck.«
Der Mann in der beigefarbenen Jacke, Joe, ergreift die Schiebegriffe des Rollstuhls und rollt Charlie ans Heck des Vans. Er macht Anstalten, die Hecktür zu öffnen, doch Charlie drückt einen Knopf an seinem Schlüsselanhänger, worauf die Tür automatisch aufgleitet.
»Cool!«, bemerkt Joe. »So etwas habe ich bei einer Hecktür noch nie gesehen.«
»Wahrscheinlich haben Sie auch noch nie in einem Rollstuhl gesessen.«
Charlie drückt einen weiteren Knopf an seinem Schlüsselanhänger und aktiviert damit die hydraulisch betriebene Rampe.
Joe schiebt Charlie die Rampe hinauf und weiter auf die Ladefläche des Vans. Die Rampe fährt hoch und klappt wieder zurück. Der Innenraum ist, natürlich, eine Sonderanfertigung: Es gibt einen Beifahrersitz und einen Rücksitz hinter diesem, aber auf der anderen Seite sind alle Sitze ausgebaut, sodass der Weg zum Lenkrad frei ist, mit dessen manueller Steuerung der Van bedient wird.
Eine schöne, freie Fläche.
Hier werde ich ihn töten. Aber ich werde nicht grausam vorgehen … schon wieder dieses Wort. Ich habe kein Verlangen, mehr Schmerz zuzufügen als notwendig ist, um ihn zu eliminieren.
Erst aber noch ein kleiner Plausch, um das Opfer abzulenken und bei Stimmung zu halten.
Joe schaut auf die Ladefläche des Vans hinab und sieht, dass dort ein Hardcover-Buch liegt, aus dessen Mitte ein ramponiertes Lesezeichen herausragt. Der Titel lautet Der unsichtbare Killer: Die Jagd auf Graham, den erfolgreichsten Serienmörder unserer Zeit.
Joe hebt das Buch auf und schlägt wahllos eine Seite auf. »Hey, diese Frau kenne ich doch«, sagt er. »Die FBI-Analystin, die Graham erwischt hat. Emmy Dockery.«
Charlie hantiert mit dem Joystick und manövriert seinen Rollstuhl so lange hin und her, bis er Joe genau gegenübersteht. »Sie kennen Emmy Dockery?«
»Na ja, sie hat mir mal gemailt und mich angerufen. Ich bin Cop, und ich hatte da so einen Fall, bei dem ich an Tod durch Unfall glaubte. Emmy bat mich, ihn als Tötungsdelikt noch einmal neu aufzurollen.« Joe geht in die Hocke und legt das Buch wieder an die Stelle, wo er es gefunden hat. Zugleich wird der Innenraum des Vans allmählich in Dunkelheit getaucht.
Mit einem unheilvoll klingenden dumpfen Geräusch schließt sich die Hecktür.
»Ach, dann war es tatsächlich Emmy, die Sie dazu bewegt hat, den Fall Laura Berg noch einmal neu aufzurollen«, sagt Charlie. »Ich war mir da nicht ganz sicher.«
Während er sich aufrichtet, registriert Detective Joseph Halsted in einem Moment, der kaum mehr als einen einzigen Herzschlag währt: Laura Berg, die Steuerung an Charlies Rollstuhl, die plötzlich doch funktioniert, die sich schließende Hecktür, bevor er im nächsten Augenblick spürt, wie ihn die Elektrodenpfeile in der Bauchgegend treffen.
Der Detective zuckt zusammen, als der Stromstoß durch seinen Körper schießt, und verliert sofort die Kontrolle über seine Muskeln. Er bricht zusammen und schlägt, nicht imstande, seinen Sturz abzufedern, hart auf der Ladefläche des Vans auf.
»Sie haben mich von Anfang an als potenzielle Bedrohung ausgeschlossen«, sagt Charlie. »Selbst Sie, ein Polizist.«
Eine Hand nach wie vor am Auslöser, um seinem Opfer weiterhin Stromstöße zu verpassen, langt Charlie nach unten zu der Tasche, die neben ihm steht, und holt drei Paar Handschellen, einen großen Plastiksack sowie einen Racketball aus Gummi hervor.
»Sie fühlen sich wie ein Gefangener im eigenen Körper«, sagt er. »Sie fühlen sich verletzlich und hilflos.«
Detective Halsted liegt zuckend auf dem Boden des Vans, die Augen weit aufgerissen und den Mund weit aufgesperrt wie ein Fisch auf dem Trockenen.
»Falls es Sie tröstet: Emmy hatte recht«, sagt Charlie. »Laura Bergs Tod war kein Unfall. Ihrer wird auch keiner sein.«
Ich schaue mir die E-Mail mit den Suchergebnissen an. Es gibt 736 Treffer.
Das ist wie eine Nadel im Heuhaufen. Der Heuhaufen ist zu groß. Die Suche ist zu breit gefächert.
Das ist dir schon seit Wochen klar, Emmy. Aber du hast eine Heidenangst davor, die Suche zu stark einzugrenzen und dann diese eine Nadel zu übersehen.
Okay. Ausatmen. Packen wir’s an.
Eine Gasexplosion in Gresham, Oregon, die zwei Menschenleben gefordert hat, eine Mutter und ihre Tochter … ein Mann, der in seinem Garten in Gering, Nebraska, durch einen Stromschlag getötet wurde … ein Teenager, der tot in einem Pool in Brookhaven, Mississippi, aufgefunden wurde …
Ich stehe zu schnell vom Schreibtischstuhl auf, und mir wird schwarz vor Augen.
An die nach Norden hin ausgerichtete Wand dieses Zimmers habe ich mehr als hundert Briefe gepinnt, allesamt Fotokopien; die Originale werden nach wie vor von der Kriminaltechnik analysiert.
Eines Tages wird unser Blut sich vermischen, Miss Emmy. Sie und ich werden ein Kind machen, und stellen Sie sich nur mal die Dinge vor, die es vollbringen wird. Aber bis dahin werde ich mit dem Töten nicht aufhören. Ich kann nicht. Ich werde warten, bis Sie mich erwischen. Ob Sie das wohl schaffen?
Liebe Ms Dockery darf ich Sie Emmy nennen? Glückwunsch dass Sie Graham geschnappt haben aber ich hoffe Sie wissen es gibt noch andere hier draußen wie ich die sogar noch schlimmer sind als er
EMILY WO SIND SIE, SIE HABEN FRÜHER IN URBANNA GEWOHNT ABER JETZT NICHT MEHR, NUN ICH HOFFE ES GEHT IHNEN GUT ICH WOLLTE IHNEN BLOSS SAGEN DASS ICH 14 MENSCHEN GETÖTET HABE!! UND ICH HABE NICHT VOR AUFZUHÖREN SO LANGE BIS SIE MICH FINDEN
Auf der nach Osten hin ausgerichteten Wand hängen, auf einem Zeitstrahl, die aus Zeitungen ausgeschnittenen oder von Websites ausgedruckten Artikel.
VIENNA, VIRGINIA: TOD VON AKTIVISTIN »NATÜRLICHE URSACHE«
INDIANAPOLIS: FAMILIE UND FREUNDE SCHOCKIERT VON MOMS SELBSTMORD
ATLANTA: WERBEPROFI OFFENBAR ERTRUNKEN
CHARLESTON: TOD VON MUTTER OFFIZIELL ÜBERDOSIS
DALLAS: DEFEKTES STROMKABEL TODESURSACHE BEI MANN AUS SOUTHLAKE
Unter jedem Artikel kleben die entsprechenden Fotos, Obduktionsberichte und, wo vorhanden, die Notizen der polizeilichen Ermittler.
Ein Warnton erklingt. Die Alarmfunktion meines iPhones. Auf dem Bildschirm poppt eine Erinnerung auf: Leg dich mal aufs Ohr, Knalltüte!
Es ist drei Uhr nachts, also ist das wohl ein guter Rat. Na ja, später vielleicht.
Ich gehe in die Küche, brühe mir eine frische Kanne Kaffee auf und tigere hin und her, während das Wasser durch den Filter mit den gemahlenen Bohnen sickert. Das durchdringende Aroma lässt mich etwas wacher werden, aber es reicht nicht. Ich gehe ins Wohnzimmer, lege mich auf den Teppich und mache fünfzig Bauchpressen. Nach all dieser Zeit verspüre ich immer noch einen Restschmerz im Brustkorb, aber ich nutze ihn, um mich wach zu bekommen.
Ich gieße mir brühend heißen Kaffee in einen Becher und kehre damit zurück an meinen Schreibtisch mit dem Computermonitor.
Ein Mann ertrinkt, nachdem er eine Uferböschung hinab in den Lake Michigan gefallen ist … Ein junges Paar wird vermisst, nachdem es in Door County, Wisconsin, ein Kajak gemietet hat … Ein Vater und sein Sohn werden vom Blitz erschlagen …
Nein. Nach Paaren suche ich nicht, nur nach einzelnen Opfern. Ich muss herausfinden, wie ich diese Suche so eingrenzen kann, dass Ereignisse mit mehreren Opfern ausgeschlossen werden. Aber bei zu starker Eingrenzung entgeht mir womöglich genau das, wonach ich suche. Also durchkämme ich heillos eine Tragödie nach der anderen: Ein Großvater stirbt, nachdem er beim Graben im Garten auf eine Stromleitung gestoßen ist, eine Frau in New Orleans wird tot in der Badewanne aufgefunden, ein Vater …
Moment mal. Zurück.
Eine Frau aus New Orleans wird tot in der Badewanne aufgefunden. Klick das mal an.
Nora Connolley, 58, Sanitätsfachhändlerin, wurde am Montagmorgen tot in ihrer Badewanne aufgefunden, nachdem sie offenbar unter der Dusche in ihrer Wohnung im Stadtteil St. Roch gestürzt war. Polizeisprecher Nigel Flowers gab gegenüber der Times-Picayune an, es läge kein Verdacht auf Fremdverschulden vor
Hmm. Vielleicht.
Ich stelle rasch ein paar allgemeine Nachforschungen über Nora Connolley an. Als Erstes kommen die Dinge dran, die jeder hinkriegt – Facebook, Instagram und Suchanfragen über Google. Dann tue ich etwas, wozu nur Strafverfolger berechtigt sind, nämlich Lebensdaten in Louisiana durchgehen. Danach widme ich mich wieder Dingen, zu denen jeder in der Lage ist, und schaue mir Google Earth sowie die Websites von Immobilienmaklern an.
Als ich finde, wonach ich gesucht habe, klatsche ich mit der Hand auf den Schreibtisch – worauf mein Kaffee überschwappt und der Computerbildschirm erzittert.
Nora Connolley ist eines der Opfer.
Ich rufe eine weitere Website auf, suche die E-Mail-Adresse des Informationsbüros des New Orleans Police Department heraus und verfasse ein Anschreiben an den Polizeisprecher Nigel Flowers mit meiner üblichen Einleitung:
Mein Name ist Emily Dockery. Ich bin leitende FBI-Analystin. Allerdings muss ich hervorheben, dass ich Sie nicht in meiner amtlichen Funktion beim FBI oder auf Anweisung des FBI kontaktiere.
Diesen letzten Satz haben sich die Anwälte einfallen lassen. Es ist mir nicht gestattet, meine »sinnlosen Unternehmungen« mit dem Siegel des Federal Bureau of Investigation zu betreiben, nicht, solange sich das Bureau weigert, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.
Ich drücke den Finger auf die Backspace-Taste, lasse sie Wort für Wort verschlingen, so als spielte ich Pac-Man, bis dieser letzte Satz wieder vollkommen gelöscht ist.
Ich fange erneut an zu tippen. Na also. Schon besser.
Mein Name ist Emily Dockery. Ich bin leitende FBI-Analystin und würde gerne mit dem Detective sprechen, der für die Ermittlung im Todesfall Nora Connolley zuständig ist. Ich habe Grund zu der Annahme, dass ihr Tod kein Unfall ist beziehungsweise nicht auf natürliche Ursachen zurückgeht. Sie erreichen mich unter dieser E-Mail-Adresse oder der unten angegebenen Telefonnummer. Ich benötige höchstens fünf Minuten Ihrer Zeit.
Ich drücke auf Senden und springe von meinem Stuhl auf, worauf mir prompt erneut schwindelig wird und mir ein stechender Schmerz durch den Knöchel fährt. Ich muss das wirklich sein lassen.
Ich gehe hinüber an die Wand mit dem Zeitstrahl und überfliege jeden Artikel samt dazugehörigen Notizen, Fotos und Obduktionsbefunden. Vor allem die diversen hervorgehobenen Details: petechiale Stauungsblutungen, Hyperämie in den Lungen, blutiger Schaum im Pharynx, nicht zuordenbare Stichverletzungen …
Bis zum ersten, dem Tod von Laura Berg in Vienna, Virginia. Ich warte immer noch auf den Rückruf von Detective Joseph Halsted. Zu Anfang reagierte er zögerlich, aber mittlerweile scheint er einzulenken.
»Ruf mich an, Joe!«, murmele ich. »Hilf mir, diesen Kerl ausfindig zu machen.«
Dann kehre ich in die Küche zurück, um mir noch einen Becher Kaffee einzuschenken.
Der Mann, der sich Charlie nennt, wenn er seine Rolle spielt, findet das Fernsehfeature auf YouTube. Es ist über zwei Millionen Mal aufgerufen worden. Er klickt den roten Pfeil an und macht es sich gemütlich.
In weißen Druckbuchstaben erscheinen Wörter auf dem schwarzen Bildschirm – DIE ECHTE EMMY DOCKERY –, um sich dann wieder aufzulösen.
Fotos von den Titelseiten diverser Zeitungen werden ein- und wieder ausgeblendet wie die Maulwürfe bei Whac-A-Mole:
FBI SCHNAPPT »UNSICHTBAREN KILLER«
JAGD AUF »GRAHAM« ENDET IN CANNON BEACH
FORD FIELD BOMBENLEGER TOT
»ES IST VORBEI« – GRAHAM GEFASST UND GETÖTET
Der Bildschirm wird wieder schwarz, es folgen Luftaufnahmen eines Hauses, aus dessen Fenstern im Obergeschoss orangefarbene Flammen schlagen, so lange, bis schließlich das Dach einstürzt.
»Feuer«, sagt der Sprecher mit seiner beruhigenden Baritonstimme. »Tag für Tag gehen Häuser in Flammen auf, und das aus unterschiedlichsten Gründen – eine umgekippte Kerze, eine Zigarette, ein defektes Kabel. Jahr für Jahr kommen etwa dreitausend Menschen während eines Brandes in ihren eigenen vier Wänden ums Leben. In den Vereinigten Staaten geht alle neunzig Sekunden ein Haus in Flammen auf, in den unterschiedlichsten Gegenden, auf dem Land und in der Stadt. Atlantic Beach, Florida. Monroe, North Carolina. New Britain, Connecticut. Lisle, Illinois.«
Auf dem Bildschirm werden jetzt die Folgen eines weiteren Brandes eingeblendet, ein übel zugerichtetes Gebäude, von dem kaum mehr übrig ist als ein Haufen grauer Asche.
»Peoria, Arizona.«
Screenshot einer Zeitung, die Schlagzeile der Peoria Times:
WOHNUNGSBRAND IN PEORIA: FRAU TOT
»Bei diesem Brand kam Marta Dockery in den Flammen um. Offiziellen Angaben zufolge wurde das Feuer durch einen Defekt ausgelöst. Darüber waren sich alle einig. Alle, bis auf Martas Zwillingsschwester Emmy.«
Eine Fotografie von zwei Mädchen im Teenageralter, sonnengebräunt und mit zusammengekniffenen Augen in die Kamera schauend, wird eingeblendet. Die eine ist ein wenig kleiner geraten als die andere und hat dunklere Haare und vollere Wangen. Man konnte schon sehen, dass sie Zwillinge waren, aber keine eineiigen. Die Kamera zoomt auf das größere und schlaksigere Mädchen.
»Emmy beharrte darauf, das Feuer sei nicht zufällig ausgebrochen. Es sei Mord gewesen.«
Der Bildschirm wird schwarz.
Es folgt eine Aufnahme vom J. Edgar Hoover Building in Washington, DC, dem Hauptquartier des FBI.
»Emily Jean Dockery arbeitete als Datenanalystin für das FBI«, informiert der Sprecher. »Ihre Arbeitswelt bestand aus Zahlenkolonnen und Statistiken. Sie war keine Agentin im Außendienst. Sie war auch keine Brandermittlerin. Daher glaubte Emmy Dockery niemand, als sie darauf beharrte, ihre Schwester sei ermordet worden.«
Gezeigt werden nun Bilder von Ausschnitten aus einem anderen Zeitungsartikel:
Acht Monate nachdem ihre Zwillingsschwester bei einem Wohnungsbrand umkam, führt Emmy Dockery immer noch einen Kreuzzug, um das Peoria Police Department davon zu überzeugen, dass Marta Dockery nicht durch einen Unfall zu Tode kam, sondern durch Mord.
»Alle forensischen Beweise deuteten auf einen Tod durch ein Feuer hin, das nicht durch Brandstiftung entstand.« Auf dem Bildschirm ist die Aufnahme einer Frau mittleren Alters zu sehen, unter ihr die Bildzeile Nancy Parmaggione, Stabschefin des FBI-Directors. »Emmy gelang es, ein zunächst äußerst skeptisches Team erfahrener, altgedienter Ermittler nicht nur davon zu überzeugen, dass ihre Schwester ermordet worden war, sondern auch, dass ein Serienmörder frei herumlief und eine Reihe der grausamsten nur vorstellbaren Verbrechen verübt hatte.«
Nun erscheint ein älterer Mann auf dem Bildschirm. Die Bildunterschrift bezeichnet ihn als Dennis Sasser, Special Agent, FBI (a. D.). »Kein Mensch hat Emmy geglaubt. Ich auch nicht. Aber ohne Emmy hätten wir Graham niemals gefasst. Genauer gesagt hätten wir noch nicht einmal gewusst, dass es sich bei diesen Todesfällen überhaupt um Verbrechen handelte …«
Charlie spult die Videoaufzeichnung vor. Diesen Teil kennt er. Jeder kennt ihn. Die landesweite Großfahndung. Dann der finale Showdown. Graham tot und Emmy, nun … immerhin am Leben.
Nach etwa fünfundvierzig Minuten der Dokumentation drückt er auf Stopp. Der Bildschirm wird wieder schwarz, dann meldet sich der Sprecher: »Was wurde eigentlich aus der FBI-Analystin, die Graham gefasst und zur Strecke gebracht hat?«
Ein Bild erscheint, auf dem Sanitäter eine Frau auf einer Rollbahre eine Auffahrt hinunter zu einem Krankenwagen befördern. Die Szene ist geprägt von Polizeiwagen, Warnleuchten und bewaffneten Ordnungskräften. Das war, so viel weiß Charlie, nach Emmys persönlicher Begegnung mit Graham.
»Berichten zufolge erlitt Emmy Dockery an diesem Tag schwerwiegende Verletzungen – tiefe Wunden in der Kopfhaut, Verbrennungen am ganzen Körper, Perforation der Lunge und einen Knöchelbruch.«
Erneut meldet sich Dennis Sasser zu Wort. »Emmy hat furchtbare Verletzungen erlitten. Sie musste so Schreckliches durchmachen, dass es sich kaum in Worte fassen lässt.«
Der Sprecher fährt fort: »Erst nach einem halben Dutzend Operationen und drei Monaten Klinikaufenthalt wurde Emmy Dockery aus dem Krankenhaus entlassen. Und dann …«
Der Bildschirm wird schwarz. Ein unheilvolles Geräusch erklingt, der einzelne Schlag einer Trommel.
Und wieder eine Zeitungsschlagzeile:
URBANNA: NOTARZT BEI FRAU, DIE GRAHAM FING
Erneut wird der Bildschirm schwarz. Dann erscheint eine ältere Dame, das graue Haar zurückgebunden, die eine trotzige Miene aufgesetzt hat. Die Bildunterschrift lautet Dorian Dockery. »Meine Tochter hat nicht versucht, sich umzubringen!«, beteuert sie.
Charlie drückt den Pausenknopf und holt tief Luft. Er hat viele Zeitungsberichte über Emmy gelesen, und die Boulevardblätter haben keine Mühe gescheut, persönliche Informationen auszugraben – dass Emmy Dockery einen Nervenzusammenbruch erlitten habe, dass sie sich versteckt halte, dass sie sowohl Morddrohungen als auch Liebesbriefe von angeblichen Serienmördern erhält.
»Du bist innerlich zerbrochen, Emmy«, flüstert er. »Aber die Wunden sind wieder verheilt. Du hast überlebt. Genau wie ich.«
Charlie schließt die Augen und tut, was er immer tut, wenn die Vergangenheit ihn einholt. Zuerst verdrängt er die schmerzverzerrten Schreie, den panischen, heißen Atem, die Gerüche von versengtem Fleisch, spritzendem Blut, Schweiß und blanker Angst, die sich sogar jetzt noch in seine Nasenlöcher brennen.
Schließlich akzeptiert er die Erinnerungen. Lässt zu, dass sie sich in ihm ausbreiten, sich vermischen und neue Form annehmen.
Ihm wird kalt, sein Puls verlangsamt sich.
»Es ist der Kampf des denkenden Menschen«, hält er sich vor Augen. Ein stiller Kampf, laut Charles Darwin, der dicht unter der heiteren Fassade der Natur lauert.
Er macht die Augen wieder auf. Auf dem Bildschirm ist das Video immer noch auf Pause gestellt, nachdem es kurz zuvor von der Aussage von Emmys Mutter auf eine Aufnahme von Emmy übergeblendet hat, auf der sie ihr Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden trägt und eine grimmige Miene zieht. Ihre Augen sind auf die seinen gerichtet. Seine Augen auf die ihren.
Einsame, entschlossen blickende Augen.
»Gemeinsam könnten wir so viel erreichen«, sagt Charlie.
Harrison Bookman – den alle »Books« nennen – spürt, dass sein Handy an seiner Hüfte vibriert, als er gerade einer Kundin dabei behilflich ist, das passende Sachbuch für ihren an Geschichte interessierten Großvater zu finden. Sie entscheiden sich für ein Buch über die Bemühungen von Lyndon B. Johnson, den Civil Rights Act von 1964 im Kongress durchzusetzen. Während er den Preis des Buches an der Kasse eintippt, flackert Genugtuung in ihm auf. Er liebt alles an Büchern, aber das hier gefällt ihm an seiner Tätigkeit am meisten – mit einem Kunden zu reden und genau den richtigen Roman oder das richtige Sachbuch zu finden, so wie ein Sommelier Restaurantgästen dabei hilft, den perfekt passenden Wein zu ihrem Essen zu wählen.
Gäbe es doch bloß mehr Kunden.
Immerhin sitzt in diesem Moment Petty, kahlköpfig und sauber rasiert, in der Ecke auf einem der bequemen Sessel und schmökert in Fiesta von Hemingway; neben ihm steht ein Becher von dem Kaffee, den Books immer für Kunden bereithält. Einen Obdachlosen in seiner Buchhandlung abhängen zu lassen ist wahrscheinlich nicht die tollste aller Ideen, aber Petty bleibt für sich und präsentiert sich auch in einem einigermaßen vorzeigbaren Zustand – und wie könnte Books jemanden wegschicken, der zwei Dienstzeiten im Desert Storm absolviert und für sein Land so viel geopfert hat, nicht zuletzt seine mentale Gesundheit?
Petty ist Teilzeitbewohner des Lagers im hinteren Bereich des Ladens. Dort schläft er ein paar Nächte in der Woche, seit Books ihn vor sechs Monaten, im vergangenen Dezember, kennengelernt hat, als Petty auf dem Gehsteig vor dem Laden saß. Er rasiert und wäscht sich in dem Bad, das Books wieder zum Leben erweckt hat, als er die alte Wohnung dort zum Lager umbaute.
Books schaut der Kundin nach, als sie die Buchhandlung verlässt. Sein Blick schweift über das Schaufenster, auf dem der Name seines Ladens – THE BOOK MAN – mittels Schablonen markant aufgemalt steht. Im Schaufenster sind Neuerscheinungen und Titel von Lokalmatadoren genau so platziert, dass sie Einkäufer und Passanten in der Innenstadt von Alexandria anlocken.
Schließlich dreht er die Gürteltasche, in dem sein Handy steckt, nach oben, um erkennen zu können, wer gerade angerufen hat. Er wirft einen Blick auf das Display, muss aber zweimal hingucken.
Moriarty.
William Moriarty, der FBI-Director.
Das ist kein Höflichkeitsanruf. Bill macht keine Höflichkeitsanrufe.
Books überlegt, ob er sofort zurückrufen soll. Immerhin sind im Moment keine Kunden im Laden. Und er kann diesen klitzekleinen Adrenalinschub nicht verleugnen. Man kriegt vielleicht einen Mann aus dem FBI raus, aber aus dem Mann nicht das FBI.
Hinter ihm läutet die Türglocke. Kundschaft. Damit ist die Entscheidung für Books gefallen. Das FBI wird warten müssen.
Als er sich umdreht, sieht er zwei Männer den Laden betreten, Männer in dunklen Anzügen, die sich beide nun die Sonnenbrillen absetzen. Mein Gott, die müssen wirklich mal damit aufhören, dieses Klischee zu bedienen.
Einen der beiden kennt er nicht, der andere jedoch, der größere, ist ihm vertraut. Es ist Desmond. Er gehört zum Vorausteam des Directors.
»Hey, Books«, sagt Desmond, während er sich umsieht.
»Hey, Dez …« Books schaut ihn irritiert an.
»Der Director möchte dich einen Moment sprechen. Er hat dich angerufen.«
Ja, und zwar vor zwei Minuten. Es ist nicht so, als hätte er letzte Woche einen Termin mit mir ausgemacht oder so.
»Können wir irgendwo kurz ungestört reden?«
Books stößt den Atem aus. »Klar doch. Im Lager. Da ist ein Lieferanteneingang, nach hinten raus, wo …«
»Da hat er bereits geparkt.« Dez nickt.
Natürlich. »Okay«, sagt Books. »Dann mal los.«
Books führt das Vorausteam ins Hinterzimmer. Dort stapeln sich die Lagerbestände; Bücher, die noch in Regale einsortiert werden müssen, Bücher, die zurück an die Verlage gehen, ein Präsentationsständer der Kinderbuchautorin, die vergangene Woche hier eine Lesung gehalten hat. Dez stellt zwei Stühle an einen Tisch, während sein Partner die Hintertür öffnet.
»Da haben wir ja unseren Buchhändler.« Director William Moriarty ist in die Jahre gekommen, und angesichts seines Jobs ist das Altern nicht würdevoll vonstattengegangen. Er ist schon sein ganzes Leben lang im Staatsdienst tätig, zunächst als Special Agent, später bei der Bundesanwaltschaft, schließlich als Kongressabgeordneter und danach als Bundesrichter. Der Stress dieser ganzen Tätigkeiten, so hat er mal gesagt, verblasse im Vergleich zu dem, was es bedeute, das FBI zu leiten. Er hat das Gros seines Kopfhaars verloren, sein Gesicht und sein Oberkörper sind in die Breite gegangen, aber seinen klaren Blick hat er sich bewahrt.
Bill hatte kein Geheimnis aus seiner tiefen Enttäuschung über Books gemacht, als dieser seine Kündigung einreichte. Er hatte alles versucht, um Books im Schoß der Familie zu halten, hatte ihm eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung, ein größeres Büro in Aussicht gestellt. Er hatte sogar damit gedroht, ihn in Bundesgewahrsam zu nehmen, auch wenn Books sich ziemlich sicher war, dass es sich dabei um einen Scherz gehandelt hatte.
»Hi, Bill.«
»Bist du schon verheiratet?«
Sie nehmen einander gegenüber an dem Tisch Platz, an dem Books sitzt, wenn er seine Buchhaltung macht.
»Nein.« Diese Antwort entspricht zwar der Wahrheit, denkt Books für sich, verrät Bill andererseits jedoch nur das Nötigste. Noch nicht, wäre informativer gewesen. Oder Nein, die Hochzeit findet diesen September statt. Nein kann alles Mögliche bedeuten, etwa Nein, wir sind noch nicht verheiratet, aber auch Ich weiß nicht, ob wir es je sein werden.
Es ist nun fast anderthalb Jahre her, dass er Emmy einen Antrag gemacht (zum zweiten Mal) und sie Ja gesagt hat (zum ersten Mal). Aber sie haben noch keinen Termin vereinbart, noch kein Tafelservice ausgesucht.
»Aber ihr beide seid … immer noch zusammen?«
Small Talk zu machen ist nicht Bills Art. Ganz und gar nicht. Was kümmert es ihn, ob Books und Emmy zum Traualtar schreiten oder getrennte Wege gehen?
»Ja«, erwidert Books. Das waren jetzt zwei bedeutungsschwangere Fragen vom Director und zwei einsilbige Antworten von Books. Der Director ist ein schlaues Kerlchen. Er kann zwischen Zeilen lesen, die enger sind als diese hier.
»Ich brauche Sie, Books. Ein Auftrag. Ein Sonderauftrag.«
»Im Bureau wimmelt es von talentierten, engagierten Agents.«
»Ich brauche jemanden von außerhalb.«
»Von außerhalb«, wiederholt Books. »Geht es hier um ein Doppel-I?«
Internal Investigations, mithin interne Ermittlungen, werden üblicherweise im eigenen Haus durchgeführt, wie jede andere Ermittlung auch. Das Bureau räumt nur ungern ein, dass es externe Hilfe benötigt. Wenn der Director darum bittet, handelt es sich in diesem Fall wohl nicht um das übliche Doppel-I. Es geht hier nicht um einen Boss, der eine Untergebene um den Schreibtisch jagt. Wahrscheinlich auch nicht um einen Agent, der einen Computer des Bureaus dazu benutzt, Beauty-Produkte zu verkaufen oder auf Pornoseiten zu surfen. Es geht um etwas weit Größeres.
Es bedeutet, dass der Director nicht sicher ist, wem er in seiner eigenen Behörde trauen kann.
»Ihr habt eine undichte Stelle.«
Der Director nickt, und sein Gesicht nimmt ein wenig Farbe an. »So ist es. Sie würden die Ermittlungen leiten. Direkt mir Bericht erstatten. Niemandem sonst.«
»Ich suche mir mein Team selbst aus«, erklärt Books und wird sich bewusst, wie schnell er im Kopf über so viele Hürden gesprungen ist, wie leicht und fast automatisch er zugesagt hat. Als gäbe es da nicht den Hauch eines Zweifels. »Angefangen mit Emmy«, sagt Books, »und das nicht, weil sie meine Verlobte ist. Sondern weil sie die beste Analystin ist, die das Bureau je hatte. Ich weiß, sie ist nicht mehr dieselbe, seit …«
»Sie ist die beste.« Der Director schneidet eine Grimasse. »Keine Frage. Aber ich muss das ablehnen. Sie können sich jeden anderen aussuchen, Books, nur nicht Emmy. Nicht in diesem Fall.«
Books starrt den Director an, um seine Miene zu deuten, nimmt seinen abgewandten Blick wahr, sein Unbehagen. Auch das sieht ihm nicht ähnlich, um den heißen Brei herumzureden. Oder Fragen über Books’ Privatleben zu stellen, vor allem, was seine Beziehung mit Emmy angeht.
Books spürt, wie etwas in ihm zerbricht. »Nein«, sagt er, als könne er es kraft seines Willens aus der Welt schaffen.
»Es bereitet mir kein Vergnügen, es auszusprechen.« Der Director zuckt mit den Achseln. »Aber Emmy steht im Mittelpunkt dieser Ermittlung. Wir glauben, dass Ihre Freundin die undichte Stelle ist.«
Ich füge alle Daten zusammen, hefte alles, was ich über Nora Connolley zusammentragen konnte, an ein Biografieblatt, so wie ich eines für jedes der Opfer auf meiner Wand angelegt habe. Ein paar Informationen fehlen, aber für den Moment reicht es.
Würde mich doch bloß das New Orleans Police Department zurückrufen. Ich hatte ihnen gestern gemailt. Normalerweise erhalte ich zumindest einen Anruf, auch wenn die Stimme der jeweiligen Person dann mit einer Prise Skepsis gewürzt ist.
Und apropos: Warum hat mich Detective Halsted noch nicht wegen des Falls Laura Berg zurückgerufen?
Es ist 11:45 Uhr. Ich sollte zu Mittag essen. Nein, ich sollte schlafen. Ein paar Stunden lang habe ich mich gestern Nacht wirklich aufs Ohr gelegt. Geschlafen habe ich zwar nicht, aber geruht. So hat meine Mutter das immer ausgedrückt, als ich klein war und mich hin und her wälzte. Dass ich wenigstens geruht hätte. So richtig verstanden habe ich das nie. Entweder man schläft, oder man schläft nicht.
Ich schlafe nicht.
Mein Laptop verkündet mit einem Klingelton, dass ich eine E-Mail erhalten habe. Es ist die Einladung einer Vereinigung von Staatsanwälten, bei ihrer Jahresversammlung eine Rede zu halten. Ich tippe rasch eine freundliche Absage ein.
Die nächste Mail. Eine Google-Suchbenachrichtigung. Nicht meine normale, die mir bei meiner Suche im Heuhaufen Hunderte Artikel am Tag liefert. Nein, diese hier ist spezieller.
Als ich die Schlagzeile lese, sauge ich zischend Luft ein.
VIENNA: DETECTIVE TOT AUFGEFUNDEN
»Nein«, flüstere ich. »Nein!«
Detective Joseph Halsted (48) vom Police Department Vienna, seit neunzehn Jahren im Polizeidienst, wurde heute Morgen in seiner Wohnung tot aufgefunden. Bei ihrem Eintreffen konnten die Rettungssanitäter nur noch seinen Tod feststellen. Ein Polizeisprecher teilte mit, Todesursache sei Herzinfarkt.
Ich lege den Kopf in die Hände. »Oh nein. Nein, nein, nein!« Mein Handy, das auf dem Schreibtisch liegt, summt. »Das ist meine Schuld … das habe ich …«
Ich hatte ihn gebeten, sich noch einmal näher mit Laura Bergs Tod zu befassen. Andernfalls hätte er keinen weiteren Gedanken daran verschwendet. Ich habe Joe Halsted zur Schlachtbank geführt.
Es bedeutet aber noch etwas anderes, geht mir auf, obwohl es mir schwerfällt, mich in diesem Moment darauf zu konzentrieren. Es bedeutet nämlich, dass ich recht hatte, was Laura Berg angeht.
Das Display meines Handys leuchtet auf, und das Ding knurrt mich an. Ich lange danach. Die Anruferkennung zeigt die Ortsvorwahl von New Orleans. Ach ja, New Orleans …
»Hallo?«, bringe ich hervor.
»Agent Dockery?« Eine Männerstimme mit New Yorker Akzent. »Hier spricht Sergeant Crescenzo vom Police Department New Orleans. Sie hatten uns eine E-Mail zum Fall Nora Connolley geschickt?«
»Ja … äh … ähm … danke für den Rückruf.«
»Schlechter Zeitpunkt für ein Gespräch?«
Ich muss mich zusammenreißen. Das ist jetzt meine Chance. Ich räuspere mich. »Doch, doch, tut mir leid. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.«
»Ms Connolley ist in ihrer Dusche gestürzt, Agent Dockery.«
Ich bin kein Special Agent, aber ich korrigiere ihn nicht. Er geht davon aus, dass es sich hier um eine offizielle Untersuchung des FBI handelt und ich Special Agent bin, auch wenn ich weder das eine noch das andere habe verlauten lassen. Angelogen habe ich ihn nicht.
»Und Sie waren vor Ort?«
»Ich war dort, ja. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass …«
»Sie war im Begriff, ihr Haus zu verkaufen, nicht wahr?«
»Sie … was haben Sie gesagt?«
»Ihr Haus stand zum Verkauf.«
»Äh … Moment mal.« Ich vernehme gedämpfte Stimmen, während der Sergeant bei jemand anderem nachfragt, ob Nora Connolleys Haus zum Verkauf stand. Ich weiß bereits, dass es so war.
»Ja, ist wohl so«, bestätigt er, als er wieder am Telefon ist. »Das hätten Sie auch von jedem noch so alten Computer aus herausfinden können.«
Das ist ja gerade der Punkt, Sergeant.
»Und wie wird dadurch aus Ausrutschen und Hinfallen im Bad ein Mord?«, will er wissen.
»Ich glaube, es passt in ein Muster«, sage ich. »Ich prüfe derzeit die Möglichkeit, ob da ein Mörder am Werk ist, der den Tod seiner Opfer wie einen Unfall oder einen natürlichen Tod aussehen lässt.«
»Aha. Klingt wie der Fall, den ihr vor ein paar Jahren hattet. Dieser Kerl, der Menschen gefoltert und die Tatorte dann abgefackelt hat.«
»So was in dieser Richtung. Aber jemand, der noch raffinierter vorgeht.«
Eine Pause. »Also, hören Sie, wer bin ich, dass ich den Leuten vom FBI sagen würde, sie sollen sich zurückhalten? Aber für mich hört sich das so an, als wäre es an den Haaren herbeigezogen. Wenn Sie diese Ermittlung übernehmen wollen, gehört sie ganz Ihnen.«
Das ist es ja gerade: Das kann ich nicht. Ich besitze nicht die Befugnis dazu, und daran wird sich auch nichts ändern, es sei denn, ich kann das Bureau davon überzeugen. Das ist mein Dilemma. Ich kann keine Untersuchung einleiten, um zu beweisen, dass eine Untersuchung gerechtfertigt ist. Ich brauche diesen Mann, brauche Sergeant Crescenzo.
»Wären Sie bereit, die Untersuchung lokal einzuleiten?«, frage ich. »Für den Moment würde ich gern unter dem Radar bleiben.«
»Sie wollen, dass ich eine Untersuchung einleite, basierend darauf, dass eine Frau ihr Haus zum Verkauf angeboten hat und dann in der Dusche ausgerutscht und hingefallen ist?« Amüsiert stößt Sergeant Crescenzo einen Grunzlaut aus. »Ich brauche mehr als das, um eine Morduntersuchung einzuleiten.«
Natürlich braucht er das. Ich kann es ihm nicht verübeln.
»Der Brandstifter, von dem Sie eben sprachen, Graham – der war gut«, sage ich. »Aber dieser Kerl jetzt ist noch besser. Graham hat seine Opfer brutal gefoltert und dann seine Spuren verwischt, indem er an den Tatorten Feuer legte. Und dieser Kerl hier? Seine Opfer weisen keine Spur von Fremdeinwirkung auf. Er kommt und geht, ohne Spuren zu hinterlassen. Wie ein Geist.«
Erneute Pause. Immerhin habe ich ihn ins Grübeln gebracht. »Ich komme morgen nach New Orleans«, erkläre ich. »Dann schauen wir uns mal in aller Ruhe den Tatort an, und wenn Sie danach immer noch glauben, dass alles nur heiße Luft ist, lasse ich Sie in Ruhe.«
»Morgen, hä?«
»Und noch was, Sergeant. Bitte halten Sie die Presse da raus. Allen Beteiligten zuliebe.«
Das lässt er sich offenbar durch den Kopf gehen.
»Ich rufe Sie an, sobald ich gelandet bin«, sage ich und lege auf, bevor er Einwände erheben kann.
Der Flug nach New Orleans verläuft unruhig, aber zum Glück herrscht klares Wetter. Regen ist das Letzte, was ich brauche. Ich fahre mit einem Mietwagen nach St. Roch, einem Stadtviertel, das sich immer noch schwer damit tut, die Schäden zu überwinden, die Hurrikan Katrina verursacht hat. Es gibt leer stehende Häuser und jede Menge Schlaglöcher auf den Straßen, aber auch Pflanzgefäße mit frischen Blumen auf den Mittelstreifen der Flaniermeilen und ein paar Neubauten in den Gewerbegebieten.
Als ich vor dem Haus an der Music Street anhalte, lehnt ein leicht ergrauter, groß gewachsener und stämmiger Afroamerikaner in Hemdsärmeln an einer Limousine und schaut sich ein Dokument an. Als ich aus meinem klimatisierten Wagen steige, nickt er mir zu.
»Sergeant Crescenzo«, begrüße ich ihn, schockiert von der glühenden Hitze.
»Nennen Sie mich Robert«, sagt er und schüttelt mir die Hand. »Agent Dockery, Sie sind ein Meister des Understatements. Sie haben mir nicht gesagt, dass Sie es waren, die Graham zur Strecke gebracht hat.«
»Ich habe an dem Fall gearbeitet, ja. Und nennen Sie mich Emmy.«
»An dem Fall gearbeitet.« Er kichert und taxiert mich, sucht dabei wahrscheinlich meinen Körper nach Narben ab. Ich trage einen Schal, der meinen Hals bedeckt, sodass es dort nichts zu sehen gibt.
»Haben Sie die Befunde der Rechtsmedizin mitgebracht?«, frage ich.
»Es wurde keine Autopsie vorgenommen«, erwidert er. »Dafür sahen wir keine Notwendigkeit. Aber ich habe die Notizen der anfänglichen Untersuchung und die Fotos dabei.«
Das müsste reichen. Ich wende mich dem Haus zu. Nora Connolley wohnte in einem einstöckigen Nurdachhaus mit tomatenroten und lindgrünen Dekorelementen. Der winzige Vorgarten ist von einem schmiedeeisernen Zaun eingefasst. An diesem ist das rot-weiß-blaue Zu-verkaufen-Schild eines Maklers namens Jensen Keller befestigt.
»Wollen wir reingehen?«, schlägt er vor, öffnet das Tor und steuert auf die Veranda zu.
»Ich will lieber von hinten rein«, erkläre ich. »Fangen wir erst mal mit der frei stehenden Garage an.«
Crescenzo wendet sich mir zu. »Es gibt eine frei stehende Garage? Woher wissen Sie das? Google Earth?«
»Von dem Video auf der Website des Maklers«, erwidere ich. »So hat auch er davon erfahren.«
»Mit er meinen Sie den Mörder.« Die Skepsis in seiner Stimme ist unüberhörbar.
Ich gehe um das Haus herum, dem Verlauf des schmiedeeisernen Zauns folgend, der das gesamte Grundstück umgibt. Der Garten hinter dem Haus ist wesentlich größer als der Vorgarten.
»Aus dem Haus wurde nichts entwendet«, teilt Crescenzo mir mit, während er mich begleitet. »Kein Anzeichen von sexueller Gewalt, kein Anzeichen eines Kampfes.«
Ich kann ihm nicht verübeln, dass es für ihn genau das war, wonach es aussah – jemand ist in der Dusche ausgeglitten und hingefallen. Er hat keinen Grund, etwas anderes anzunehmen.
»Gab es nicht zuzuordnende Einstichwunden an ihrem Rumpf?«, frage ich.
»Wie …« Er bleibt stehen. »Woher zur Hölle wissen Sie das?«
»Zufallstreffer.« Ich bleibe ebenfalls stehen und werfe einen Blick auf den Garten hinter dem Haus. Sie hat ihn schön angelegt – ein Gemüsegarten in einer Ecke, ein adretter, gepflasterter Gehweg, der von der Garage zur hinteren Veranda führt.
»Nadeleinstiche«, sagt er.
»Zwei.«
»Ja, Emmy. Zwei. Sie wissen eine Menge.«
»Wie groß war die Frau?«, will ich wissen.
»Die Verstorbene? Oh, sie war klein. Etwa einen Meter sechzig. Nicht so schmal wie Sie, aber auch nicht gerade dick.«
Auf den Facebook-Fotos hatte sie zierlich gewirkt, aber bei diesen Bildern kann man sich nie sicher sein.
Wir erreichen die frei stehende Garage, einen kleinen, mit einem Fenster versehenen Bau mit Aluminiumverkleidung. Das Garagentor ist verschlossen. Wir gehen durch die Gartenpforte und gelangen über einen schmalen Weg zur Seitentür der Garage. Sie ist von außen verriegelt.
»Ich hatte den Makler nicht darum gebeten, die Garage aufzuschließen«, sagt Robert. »Nur das Haus.«
Ich übe Druck auf den Fenstergriff aus, worauf das Fenster nachgibt. Ich schiebe es so weit hoch, wie es sich bewegen lässt. Dann wende ich mich Robert Crescenzo zu.
Er hebt die Hände hoch über den Kopf. »Schauen Sie mich erst gar nicht so an.« Er ist deutlich über einen Meter achtzig groß und breitschultrig. Durch diese Öffnung passt er auf keinen Fall.
»Ist es okay, wenn ich reinschlüpfe?« Ich bin zwar auch groß, aber zurzeit so dünn wie eine Bohnenstange.
Er denkt einen Moment darüber nach, kommt dann aber wohl zu dem Schluss, dass es nicht schaden könnte.
Es gestaltet sich einfacher, als ich erwartet hatte. Ich gleite mit dem Kopf zuerst hinein, Gesicht nach oben, und als ich mit dem Oberkörper drinnen bin, strecke ich die Hände aus, ergreife von innen den Fensterrahmen und ziehe meine Beine hinterher. Dabei beiße ich die Zähne zusammen und ignoriere den Schmerz in meinem Brustkorb. Meine Landung auf dem Boden der Garage qualifiziert mich nicht gerade für das Olympiateam im Kunstturnen, aber ich bleibe auf den Beinen.
Als ich drinnen zum ersten Mal Luft hole, schlägt mir der Geruch von Benzin und Grünschnitt entgegen. Da durch das Fenster Licht einfällt, finde ich leicht meinen Weg um das geparkte Auto herum und kann die Tür zum Garten öffnen. Ich ertaste auch einen Lichtschalter. Die Garage bietet gerade genug Platz für ein Auto, ein Fahrrad sowie diverse Gartengeräte.
Robert Crescenzo tritt durch die Tür ein, die ich geöffnet habe. Er leuchtet mit einer Taschenlampe in das Fahrzeuginnere. Er probiert es an der Tür, sie lässt sich öffnen, und er betätigt den Hebel, der den Kofferraumdeckel aufklappen lässt, geht um den Wagen herum und leuchtet auch in den Kofferraum.
»Nichts, was einem ins Auge springen würde.« Er schaut mich an. »Hatten Sie geglaubt, etwas darin zu finden? Glauben Sie, dass sie in ihrer Garage überfallen wurde?«
Nein, das glaube ich nicht. Trotzdem erwidere ich: »Kann schon sein« und deute auf den Wagen. »Was dagegen, wenn ich mal einsteige?«
»Nur zu.«
Ich steige auf der Fahrerseite ein und lasse mich auf den Sitz sinken. Ich will das Lenkrad gar nicht berühren, doch als ich in seine Richtung lange, bemerke ich, dass ich es kaum mit den Fingerspitzen erreichen kann, obwohl ich die Arme ganz ausgestreckt habe. Mit den Füßen komme ich weder ans Brems- noch ans Gaspedal.
»Können wir mal Plätze tauschen?«, frage ich.
»Okay …«
Ich steige aus, und Robert steigt ein, richtet es sich auf dem Sitz ein und legt eine Hand auf das Lenkrad.
»Genau richtig eingestellt für jemanden in Ihrer Größe«, stelle ich fest.
»Stimmt.«
»Aber nicht für eine Frau, die dreißig Zentimeter kleiner ist als Sie.«
Sergeant Crescenzo blinzelt mehrmals, denkt darüber nach. Dann dreht er seinen Kopf und schaut mich an.
»Jemand anderes als Nora Connolley hat diesen Wagen zuletzt gefahren«, sagt er.
Sergeant Robert Crescenzo und ich verlassen die Garage und gehen wieder zurück zur Veranda. Er schreitet den gepflasterten Weg entlang, ich neben ihm auf dem Rasen.
»Auf die Gefahr hin, Offenkundiges auszusprechen«, beginnt er. »Nur weil jemand anderes zuletzt ihren Wagen gefahren hat, bedeutet das nicht, dass dieser Jemand sie auch ermordet hat.«
»Sie haben absolut recht«, pflichte ich ihm bei.
»Vielleicht ist eines ihrer Kinder damit gefahren. Sie hatte zwei Kinder, glaube ich.«
»Drei«, korrigiere ich ihn. »Mary lebt in Oklahoma, Sarah in Baton Rouge …«
»Aber ihr Sohn, Michael, wohnt hier in New Orleans. Einer der Officers hat mit ihm gesprochen.«
»Ja, aber er war in der Woche, in der sie gestorben ist, in Dallas.«
Sergeant Crescenzo bleibt stehen. Ich wende mich ihm zu.
»Sie haben Kontakt mit Zeugen in meinem Fall aufgenommen?«, fragt er.
»Ich habe keinen Kontakt mit ihm aufgenommen. Ich habe seine Reise auf Facebook verfolgt. Außerdem dachte ich, es wäre gar kein Fall«, füge ich hinzu. »Ihr Tod war doch ein Unfall, nicht wahr?«
Er schaut mich von der Seite an.
»Ich habe mir lediglich öffentlich zugängliche Informationen zunutze gemacht«, erkläre ich und wende mich wieder der Veranda zu. Sie ist nicht breiter als die Glasschiebetür zum Haus, aber groß genug, um Platz für einen kleinen Tisch, einen Sonnenschirm und einen gasbetriebenen Grill zu bieten.
»Die Veranda ist makellos«, sage ich.
Sergeant Crescenzo stellt sich neben mich. »Eine saubere Veranda? Also wenn das nicht auf Mord hindeutet, dann weiß ich es auch nicht.«
»Sie ist nicht bloß sauber, Robert. Sie ist blitzblank. So, als wäre sie geschrubbt worden.«
Er schaut sich um und gibt dabei einen diffusen Laut von sich, der wohl bedeuten soll, dass er diese Möglichkeit zwar einräumt, ihr aber keine Bedeutung beimisst.
Ich trete vom Rasen auf die Veranda, gehe hinüber zur Glasschiebetür und werfe einen Blick zurück auf die Wegstrecke, die ich gerade zurückgelegt habe.
gar nichts
»Sie haben recht«, sage ich. »Ich weiß das alles nicht. Aber Sie auch nicht, Robert.«
Er blinzelt erneut mehrmals.
»Deswegen sollten Sie eine Ermittlung einleiten«, sage ich.