

Buch
Wie können wir in herausfordernden Momenten stark sein? Vorstellungs- und Streitgespräche oder freies Sprechen vor anderen sind oft mit großen Ängsten verbunden. Harvard-Professorin Dr. Amy Cuddy erklärt uns, wie wir auf andere wirken können, wenn wir auf uns selbst Eindruck machen. Dabei gibt sie Einblicke in die Wissenschaft der »Body-mind-Effects«, die verdeutlichen, wie wir in Belastungsmomenten selbstsicher sein und unseren Körper, unsere Gedanken und Bewegungen kontrollieren können.
Autorin
Dr. Amy Cuddy, geboren 1972, ist promovierte Sozialpsychologin und lehrt an der Harvard Business School. Sie lebt mit ihrer Familie in Boston, USA.
Dr. Amy Cuddy
Ohne Worte
alles sagen
Mit Körpersprache überzeugen
Aus dem amerikanischen Englisch
von Henriette Zeltner
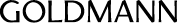
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die US-amerikanische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»Presence« bei Little, Brown and Company, New York, USA.
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Dieses Buch ist bereits 2016 unter dem Titel »Dein Körper spricht für dich« im Mosaik Verlag erschienen.
1. Auflage
Vollständige Taschenbuchausgabe Januar 2020
Copyright © 2015 der Originalausgabe: Amy Cuddy
Copyright © 2016 dieser Ausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
This edition published by arrangement with Little, Brown and Company, New York, USA. All rights reserved.
Die Autorin dankt für die Verwendung eines Auszugs aus »Bright as Yellow« von Karen Peris (the innocence mission).
Abbildungen: Kapitel 6: © Nikolaus F. Troje (aus: Cuddy und Troje), Kapitel 8: © Dailey Crafton
Umschlag: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: (Struktur) FinePic®, München
(Autorenfoto) Getty Images/John Lamparski/Kontributor Redaktion: Antje Steinhäuser
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
JE ∙ CF
ISBN 978-3-641-25327-1
V001
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz





Inhalt
Einführung
Kapitel 1
Was ist Ausstrahlung?
Kapitel 2
Die eigene Geschichte glauben und anerkennen
Kapitel 3
Aufhören zu reden, anfangen zuzuhören – wie Ausstrahlung Ausstrahlung erzeugt
Kapitel 4
Ich verdiene es nicht, hier zu sein
Kapitel 5
Wie Ohnmacht fesselt (und wie Macht befreit)
Kapitel 6
Lümmeln, Aufrichten und die Sprache des Körpers
Kapitel 7
Surfen, lächeln und singen wir uns zum Glück
Kapitel 8
Der Körper formt den Geist (Also Brust raus!)
Kapitel 9
Die richtige Haltung für mehr Ausstrahlung
Kapitel 10
Sich selbst einen Ruck geben: Wie kleine Veränderungen Großes bewirken können
Kapitel 11
»Fake It Till You Become It«
Dank
Register
Anmerkungemn
Für Jonah und Paul,
die Lieben meines Lebens …
Danke, dass ihr mich geduldig
wieder und wieder daran erinnert,
»auf dem Surfbrett einfach nur aufzustehen«
»And you live life with your arms reached out
Eye to eye when speaking.
Enter rooms with great joy shouts,
Happy to be meeting …
Bright as yellow,
Warm as yellow.«
Karen Peris (the innocence mission)
Einführung
Ich sitze an der Theke meines liebsten Buchladen-Cafés in Boston vor meinem aufgeklappten Laptop und schreibe. Vor zehn Minuten habe ich einen Kaffee und einen Muffin bestellt. Die Bedienung – eine dunkelhaarige junge Frau mit strahlendem Lächeln und Brille – schwieg kurz und sagte dann: »Ich möchte Ihnen nur sagen, wie viel Ihr TED-Talk mir bedeutet – wie sehr er mich inspiriert hat. Vor ein paar Jahren hat mein Lehrer ihn für die Schüler eines Kurses gepostet, den ich belegt hatte. Jetzt bewerbe ich mich gerade an der medizinischen Hochschule, und ich möchte Sie nur wissen lassen, dass ich vor meinem MCAT wie Wonder Woman in der Toilette stand und es mir echt geholfen hat. Obwohl Sie mich nicht kennen, haben Sie mir geholfen herauszufinden, was ich mit meinem Leben wirklich anfangen möchte – Medizin studieren –, und dann haben Sie mir geholfen, das zu tun, was ich tun musste, um mein Ziel zu erreichen. Vielen Dank.«
Mit Tränen in den Augen fragte ich sie: »Wie heißen Sie?«
»Fetaine«, sagte sie, und wir unterhielten uns während der nächsten zehn Minuten über Herausforderungen, denen Fetaine sich in der Vergangenheit zu stellen hatte, und darüber, wie gespannt sie auf alles ist, was die Zukunft bringt.
Jeder Mensch, der mir begegnet, ist einzigartig und erinnerungswürdig. Solche Begegnungen erlebe ich häufiger, als ich mir je hätte vorstellen können. Ein Fremder grüßt mich freundlich, erzählt mir seine sehr persönliche Geschichte, wie er eine große Herausforderung erfolgreich gemeistert hat, und bedankt sich dann schlicht für meine kleine Beteiligung daran. Das sind Frauen und Männer, ältere und jüngere, schüchterne und gesellige, arme und reiche Menschen. Aber eines verbindet sie alle: Sie fühlten sich angesichts großen Drucks und großer Verunsicherung machtlos, und sie haben eine bemerkenswert simple Methode entdeckt, sich von diesem Gefühl der Ohnmacht zu befreien, wenigstens für den Moment.
Bei den meisten Autoren erscheint zuerst das Buch, dann kommen die Rückmeldungen. Bei mir war es andersherum. Zuerst führte ich ein paar Experimente durch, die ich in einem Vortrag vorstellte, den ich 2012 bei der TEDGlobal Conference hielt. Darin präsentierte ich einige faszinierende Erkenntnisse aus meiner eigenen und der Forschung anderer darüber, wie unser Körper unser Gehirn und unser Verhalten beeinflusst. An dieser Stelle beschrieb ich diese Wonder-Woman-in-der-Toilette-Sache, die Fetaine erwähnte und die ich noch erklären werde, mit der sich unser Selbstvertrauen rasch steigern und unsere Unsicherheit in schwierigen Situationen verringern lässt. Ich schilderte meine eigenen Bemühungen rund um das sogenannte Impostor- oder Hochstapler-Syndrom und wie ich gelernt hatte, mich selbst dazu zu bringen, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln – und es schließlich auch wirklich zu besitzen. Ich bezeichnete dieses Phänomen als »Fake It Till You Become It«. (Übrigens: Der Teil des Talks, in dem es um meine eigenen Bemühungen ging, war fast komplett ungeplant und unvorbereitet, weil ich nicht geglaubt hatte, mutig genug sein, etwas derart Persönliches vor Hunderten von Zuhörern im Publikum preiszugeben. Wenn ich das geahnt hätte …) Ich wusste nicht, ob das Thema bei den Leuten ankommen würde. Mich faszinierte es jedenfalls. Sofort nachdem das einundzwanzigminütige Video meines Vortrags online war, begann ich von Leuten zu hören, die es gesehen hatten.
Natürlich verlieh meine Rede Fetaine nicht auf magische Weise das Wissen, das sie brauchte, um beim MCAT gut abzuschneiden. Sie verstand dadurch nicht wundersamerweise den Unterschied zwischen kugel- und zylinderförmigen Bakterien besser oder wie sich der Energieerhaltungssatz zur kinetischen Energie verhält. Aber möglicherweise befreite ich sie von der Furcht, die sie daran gehindert hätte, alles zu schreiben, was sie wusste. Ohnmacht verschlingt uns – und alles, was wir glauben, wissen und fühlen, gleich mit. Sie umhüllt uns und macht uns unsichtbar. Dadurch entfremden wir uns sogar von uns selbst.
Das Gegenteil von Ohnmacht muss Macht sein, nicht wahr? Das stimmt zwar bis zu einem gewissen Grad, doch ganz so einfach ist es nicht. Bei der Forschung, die ich jetzt seit Jahren betreibe, richtet sich ein Großteil der Erhebungen auf eine Fähigkeit, einen Zustand, den ich presence, Ausstrahlung, nenne. Positive Ausstrahlung wurzelt im Glauben an und Vertrauen in uns selbst – unsere wahren, aufrichtigen Gefühle, Werte und Fähigkeiten. Das ist wichtig, denn wie sollen andere Ihnen vertrauen, wenn Sie es selbst nicht tun? Egal ob wir vor zwei oder fünftausend Menschen reden, ein Bewerbungsgespräch führen, eine Gehaltserhöhung verhandeln oder potenziellen Investoren eine Geschäftsidee präsentieren, ob wir für uns selbst oder im Namen anderer sprechen, wir alle erleben einschüchternde Situationen, in denen man Haltung zeigen muss, wenn man ein gutes Selbstwertgefühl anstrebt und Fortschritte im eigenen Leben erzielen will. Ausstrahlung gibt uns die Kraft, solchen Momenten gewachsen zu sein.
Der Weg, der mich zu diesem Vortrag und diesem Durchbruch führte, war, das kann ich mit Sicherheit sagen, kein gerader. Sein Ausgangspunkt ist allerdings eindeutig.
Am lebhaftesten habe ich die albernen Zeichnungen und netten Botschaften meiner Freunde auf dem Whiteboard in Erinnerung. Ich bin Studentin im zweiten Studienjahr am College. Ich erwache in einem Krankenhauszimmer. Ich sehe mich um – überall Karten und Blumen. Ich bin erschöpft. Aber ich fühle mich auch verunsichert und aufgebracht. Ich kann meine Augen kaum offen halten. Noch nie habe ich mich so gefühlt. Ich verstehe es nicht, aber mir fehlt auch die Energie, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich schlafe wieder ein.
Das wiederholt sich viele, viele Male.
Meine letzte klare Erinnerung, bevor ich in dem Krankenhaus erwachte, war die Fahrt von Missoula, Montana, nach Boulder, Colorado, mit zwei guten Freundinnen und Mitbewohnerinnen. Wir waren in Missoula gewesen, um bei der Organisation einer Konferenz mit Studierenden der University of Montana zu helfen und um Freunde zu besuchen. Wir verließen Missoula am frühen Abend, gegen 18 Uhr, an einem Sonntag. Für die Lehrveranstaltungen am nächsten Morgen wollten wir schon wieder in Boulder sein. Rückblickend, und vor allem als Mutter, erkenne ich jetzt, wie unglaublich dumm dieser Plan war, wenn man bedenkt, dass die Fahrzeit von Missoula nach Boulder dreizehn bis vierzehn Stunden beträgt. Aber wir waren damals neunzehn.
Unser vermeintlich guter Plan sah so aus: Jede von uns würde ein Drittel der Strecke fahren. Eine Beifahrerin würde wach bleiben, um mit aufzupassen und die Fahrerin wach zu halten, während die jeweils Dritte von uns bei umgelegten Rücksitzen in einem Schlafsack hinten im Jeep Cherokee schlief. Ich fuhr meine Strecke; ich glaube, ich war als Erste dran. Dann achtete ich als Beifahrerin auf die Fahrerin. Daran habe ich sogar schöne Erinnerungen. Richtig friedliche. Ich mochte die beiden, mit denen ich unterwegs war. Ich mochte die offene Landschaft des Westens und die Wildnis. Keine Lichter anderer Fahrzeuge auf dem Highway. Nur wir. Dann war ich an der Reihe, hinten zu schlafen.
Wie ich erst viel später erfuhr, passierte Folgendes: Meine Freundin hatte den schlimmsten Teil der Strecke erwischt. Nämlich die Zeit in der Nacht, wenn es sich anfühlt, als wäre man als einziger Mensch auf der ganzen Welt wach. Es war aber nicht nur mitten in der Nacht, sondern wir befanden uns auch noch mitten in Wyoming. Sehr dunkel, sehr weit, sehr einsam. Sehr wenig, um einen wach zu halten. Gegen vier Uhr morgens schlief meine Freundin ein. Sie döste weg, verzog dabei das Steuer und geriet auf den Rüttelstreifen. Das weckte sie, aber sie übersteuerte den Wagen beim Korrigieren. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Meine Freundinnen, die vorne saßen, waren angeschnallt. Ich, die ich auf den umgeklappten Rückbänken im Schlafsack geschlafen hatte, wurde aus dem Auto und in die Nacht geschleudert. Die rechte Vorderseite meines Kopfes schlug auf die Fahrbahn auf. Der Rest von mir blieb im Schlafsack.
Ich erlitt eine traumatische Gehirnverletzung. Genauer gesagt: eine diffuse Axonenverletzung (diffuse axonal injury = DAI). Bei einer DAI ist das Gehirn Scherkräften ausgesetzt, meist durch starke Rotationsbeschleunigung, wie sie bei Autounfällen relativ häufig vorkommt. Stellen Sie sich vor, was bei einem Verkehrsunfall mit hoher Geschwindigkeit passiert: Durch die plötzliche und extreme Änderung der Geschwindigkeit wird Ihr Körper abrupt gestoppt, doch das Hirn unter der Schädeldecke bewegt sich oder rotiert sogar noch weiter. Das sollte natürlich eigentlich nicht sein. Manchmal schlägt es dabei sogar gegen die Schädeldecke, was ebenfalls nicht sein sollte. Die Kräfte, die meinen Kopf auf den Highway prallen und meinen Schädel brechen ließen, waren natürlich ebenfalls nicht hilfreich.
Unser Gehirn soll sich eigentlich in einem sicheren Raum befinden. Geschützt durch den Schädel und gepolstert durch mehrere dünne Membranen, die Hirnhäute, und durch die Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit. Der Schädel ist zwar Freund des Hirns, doch die beiden sollten sich eigentlich nie berühren. Die Scherkräfte einer schweren Kopfverletzung überdehnen und zerreißen Neuronen und deren Fasern (Axone) im Gehirn. Wie elektrische Kabel sind Axone von einer Schutzschicht ummantelt, der sogenannten Myelinscheide. Selbst wenn ein Axon nicht durchtrennt wird, kann die Beschädigung der Myelinscheide die Geschwindigkeit, mit der Informationen von einem Neuron zum anderen transportiert werden, merklich beeinträchtigen.
Bei einer DAI betrifft die Verletzung das gesamte Hirn, im Gegensatz zu einer herdförmigen Verletzung wie einer Schusswunde, bei der eine spezifische Stelle beschädigt ist. Alles, was das Gehirn tut, hängt von der Kommunikation der Neuronen ab; sind Neuronen überall im Hirn beschädigt, ist unvermeidlich auch deren Kommunikation gestört. Wenn Sie also eine DAI erlitten haben, wird Ihnen kein Arzt erklären: »Nun, Ihr motorischer Bereich ist beschädigt, also werden Sie Schwierigkeiten beim Bewegen haben.« Oder: »Es hat Ihr Sprachzentrum getroffen, daher werden Sie Probleme beim Sprechen und Verarbeiten von Sprache haben.« Man wird nicht wissen, ob Sie sich erholen, wie gut Sie sich erholen und auch nicht, welche Hirnfunktionen betroffen sein werden: Wird Ihr Gedächtnis beeinträchtigt sein? Ihr Gefühlsleben? Ihre räumliche Vorstellung? Ihre Feinmotorik? Angesichts der geringen Kenntnisse über DAIs ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arzt eine exakte Prognose abgeben kann, zu vernachlässigen.
Nach einer DAI ist man ein anderer Mensch. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Wie Sie denken, fühlen, sich ausdrücken, reagieren und interagieren – all diese Dimensionen sind betroffen. Dazu kommt noch, dass Ihre Fähigkeit, sich selbst zu verstehen, wahrscheinlich auch Schaden genommen hat, sodass Sie nicht in der Lage sind, zu erkennen, wie genau Sie sich verändert haben. Und niemand – NIEMAND – kann Ihnen sagen, was Sie erwartet.
Lassen Sie mich erklären, was nach meinem Verständnis damals mit meinem Gehirn passiert ist: (Bitte hier das Zirpen von Grillen einfügen.)
Okay, ich befand mich also im Krankenhaus. Natürlich war mein Studium am College unterbrochen, und meine Ärzte bezweifelten ernstlich, dass ich jemals kognitiv wieder fit genug sein würde, um es wieder aufzunehmen. Angesichts der Schwere meiner Verletzung und der Statistiken über Leute mit ähnlichen Verletzungen meinten sie: Rechnen Sie nicht damit, das College beenden zu können. Sie werden wieder in Ordnung kommen – »sehr funktionsfähig sein« –, aber wahrscheinlich sollten Sie sich eine andere Beschäftigung suchen. Ich erfuhr, dass sich mein IQ um dreißig Punkte verringert hatte – zwei Standardabweichungen also. Das wusste ich nicht, weil ein Arzt es mir erklärt hätte. Ich wusste es, weil der IQ Teil einer zweitägigen Reihe von neuropsychologischen Tests war, die man mir gegeben hatte; das Ergebnis stand dann in dem langen Bericht, den ich anschließend erhielt. Die Ärzte fanden es nicht wichtig, mir das zu erklären. Glaubten sie, ich sei nicht intelligent genug, um es zu verstehen? Oder hielten sie es nicht für wichtig genug? Ich will dem IQ nicht mehr Bedeutung beimessen, als er verdient; und schon gar nicht will ich behaupten, daraus ließen sich Vorhersagen über das spätere Leben ableiten. Aber er war doch etwas, wovon ich annahm, es quantifiziere meine Intelligenz. Ich war also nicht mehr klug, und das traf mich hart.
Ich erhielt Ergotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, Logopädie, Physiotherapie und Psychotherapie. Etwa sechs Monate nach dem Unfall verbrachte ich den Sommer zu Hause, und ein Paar, das zu meinen engsten Freunden gehörte und das sich merklich von mir zurückgezogen hatte, erklärte mir: »Du bist einfach nicht mehr dieselbe.« Wie konnten zwei der Menschen, die mich doch am besten verstehen sollten, mir sagen, ich sei nicht mehr ich selbst? Inwiefern war ich denn anders? Sie erkannten mich nicht mehr, und ich erkannte mich selbst nicht mehr.
Eine Kopfverletzung bewirkt, dass man sich verwirrt, verunsichert und frustriert fühlt. Wenn einem dann die Ärzte eröffnen, dass sie nicht wissen, was einen erwartet, und die Freunde konstatieren, man sei anders, dann vergrößert das die Verwirrung, Unsicherheit und Frustration beträchtlich.
Das darauffolgende Jahr verbrachte ich in einer Art Nebel – ängstlich und desorientiert traf ich falsche Entscheidungen und war mir nicht sicher, was ich als Nächstes tun sollte. Danach kehrte ich ans College zurück. Doch es war noch zu früh. Ich konnte nicht denken. Ich konnte gesprochene Informationen nicht angemessen verarbeiten. Es kam mir vor, als höre ich jemand zur Hälfte in einer Sprache sprechen, die ich verstand, und zur Hälfte in einer, die ich nicht beherrschte, was mich nur noch mehr entmutigte. Ich musste die Schule wieder abbrechen, weil ich meine Kurse nicht bestand.
Obwohl ich mir bei dem Unfall viele Knochen gebrochen und ein paar hässliche Narben davongetragen hatte, sah ich äußerlich gesund aus. Und weil traumatische Hirnverletzungen oft für andere unsichtbar sind, bekam ich zu hören: »Wow, du hast solches Glück gehabt! Du hättest dir ja auch das Genick brechen können!« Glück?, dachte ich. Und dann fühlte ich mich schuldig und schämte mich meiner Frustration über solche gut gemeinten Reaktionen.
Unsere Art zu denken, unser Intellekt, unsere Affekte, unsere Persönlichkeit – das sind lauter Dinge, bei denen wir nie mit Veränderung rechnen. Wir betrachten sie als selbstverständlich. Wir fürchten vielleicht, dass wir nach einem Unfall gelähmt sind, uns nicht mehr ungehindert bewegen können, unser Gehör oder Augenlicht verlieren. Aber wir rechnen nicht mit einem Unfall, bei dem wir uns selbst verlieren.
Noch viele Jahre nach meiner Kopfverletzung hatte ich den Eindruck, als mein früheres Selbst durchzugehen … obwohl ich nicht einmal genau wusste, was dieses frühere Selbst ausmachte. Ich fühlte mich wie eine Hochstaplerin, eine Hochstaplerin in meinem eigenen Körper. Ich musste das Lernen neu erlernen. Ich versuchte immer weiter, wieder damit anzufangen, weil ich nicht akzeptieren konnte, dass man mir diese Fähigkeit absprach. Wenn mir jemand erklärte, ich könne keinen Collegeabschluss erlangen, dann forderte mich genau das heraus.
Ich musste viel mehr als andere lernen. Langsam zwar, aber zu meiner unbeschreiblichen Erleichterung begann meine geistige Klarheit zurückzukehren. Schließlich beendete ich das College vier Jahre später als meine Klassenkameraden aus der Zeit vor dem Unfall.
Einer der Gründe, warum ich durchhielt, war, dass ich etwas gefunden hatte, was ich studieren wollte: Psychologie. Nach dem College gelang es mir, einen Beruf zu ergreifen, der ein voll funktionsfähiges Gehirn erfordert. Wie schon Anatole France schrieb: »Alle Veränderungen … besitzen ihre eigene Melancholie; denn was wir hinter uns lassen, ist ein Teil unserer selbst; wir müssen einem Leben Lebewohl sagen, bevor wir ein anderes beginnen können.« Wenig erstaunlich, dass ich mich auf diesem Weg zu einem Menschen entwickelt habe, für den all diese Fragen der Ausstrahlung und Macht, des Vertrauens und des Zweifels von großer Bedeutung sind.
Meine Verletzung brachte mich dazu, die Wissenschaft der Ausstrahlung zu studieren, doch es war mein TED-Talk, der mich erkennen ließ, wie universell die Sehnsucht nach Ausstrahlung ist. Denn eines steht fest: Die meisten Menschen sehen sich tagtäglich stressigen Herausforderungen gegenüber. Menschen überall auf der Welt und in den unterschiedlichsten Lebenssituationen versuchen, ihren Mut zusammenzunehmen, um vor ihrer Klasse zu sprechen, ein Bewerbungsgespräch zu führen, für eine Rolle vorzusprechen, sich der täglichen Not zu stellen, dafür einzustehen, woran sie glauben, oder einfach nur ihren Frieden mit sich selbst zu finden. Das gilt für Obdachlose genauso wie für diejenigen, die nach gängiger Vorstellung extrem erfolgreich sind. Topmanager, Staranwälte, begnadete Künstler und Schauspieler, Opfer von Mobbing oder Vorurteilen oder sexuellem Missbrauch, politische Flüchtlinge, Leute mit einer psychischen Erkrankung oder schweren körperlichen Verletzung – sie alle stehen vor diesen Herausforderungen. Genauso wie diejenigen, die den davon Betroffenen helfen wollen – Eltern, Partner, Kinder, Therapeuten, Ärzte, Kollegen und Freunde von Menschen, die zu kämpfen haben.
All diese Menschen – und der größte Teil davon sind keine Wissenschaftler – haben mich gezwungen, meine eigenen Forschungsergebnisse mit anderen Augen zu betrachten: Sie führen mich weg von der Wissenschaft und bringen mich ihr gleichzeitig näher. Ihre Geschichten zu hören, verpflichtete mich zu der Überlegung, wie sozialwissenschaftliche Erkenntnisse sich eigentlich in der Realität auswirken. Also fing ich an, darauf zu achten, dass meine Forschung Leben zum Besseren verändert. Aber ich begann auch damit, grundlegende Fragen zu stellen, die mir vielleicht nie in den Sinn gekommen wären, wenn ich nur im Labor geblieben und mich nur in die Fachliteratur vertieft hätte.
Zunächst war ich von der Wirkung meines TED-Talks überwältigt. Ich fragte mich sogar, ob es ein großer Fehler gewesen war, meine Arbeit und meine persönliche Lebensgeschichte zusammen publik zu machen. Schließlich hatte ich nicht erwartet, dass so viele Fremde sich das Video ansehen und ich mich dadurch so unglaublich verletzlich und exponiert fühlen würde. Doch das passiert jedem, auf den das Internet aufmerksam wird und der dann auf einen Schlag in der ganzen Welt bekannt wird. Manche Leute erkennen einen dann in der Öffentlichkeit. Das ist seltsam, und man muss erst lernen, damit umzugehen. Etwa damit, dass jemand einen bittet, wie Wonder Woman für ein gemeinsames Selfie zu posieren, oder dass jemand aus einer Fahrradrikscha (wie in Austin passiert) ruft: »Hey! Das ist das TED-Girl!«
Aber vor allem schätze ich mich unglaublich glücklich. Glücklich, weil ich die Chance hatte, diese Forschungsergebnisse und meine Geschichte mit so vielen Menschen zu teilen. Und noch glücklicher, weil so viele dieser Menschen ihre Geschichten mit mir geteilt haben. Ich liebe die akademische Welt, aber ich finde so viel mehr Inspiration außerhalb von Labor und Hörsaal. Einer der großen Vorzüge meiner Tätigkeit an der Harvard Business School besteht darin, dass man dazu ermuntert wird, die Grenze zwischen Forschung und Praxis zu überwinden. So hatte ich bereits begonnen, mit Leuten in Organisationen über die Anwendung der Ergebnisse zu sprechen. Darüber, was funktioniert, wo die Haken sein können und solche Dinge. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass diese enorme Welt der nachdenklichen Fremden dermaßen offen auf mich zukäme, nachdem der TED-Talk veröffentlicht wurde.
Ich liebe diese Leute und fühle mich ihnen auf immer verbunden und verpflichtet. Ich möchte ihnen meine Reverenz erweisen, für ihre Bereitschaft, es zu versuchen – wieder in den Sattel zu kommen oder anderen dabei zu helfen, es weiter zu versuchen –, und für ihre Bereitschaft, sich hinzusetzen und mir, einer Fremden, in einer E-Mail von ihren Bemühungen zu berichten. Oder mir auf einem Flughafen oder im Café einer Buchhandlung davon zu erzählen. Jetzt weiß ich, dass ein Vortrag wie ein Lied wirken kann – dass Menschen ihn personalisieren, mit sich selbst in Verbindung bringen und sich bestätigt fühlen, wenn sie erfahren, dass jemand genauso empfunden hat wie sie. Oder wie der Musiker Dave Grohl einmal gesagt hat: »Das ist eine der großartigen Eigenschaften von Musik: Du kannst 85 000 Menschen einen Song vorsingen, und sie werden ihn aus 85 000 verschiedenen Gründen mitsingen.« Ich habe einmal mit Jugendlichen in einer Obdachlosenunterkunft gesprochen und sie gebeten, mir von Situationen zu erzählen, die sie als besonders stressig empfanden. Ein Teenager meinte: »Auf der Türschwelle dieser Unterkunft zu stehen.« Eine junge Frau in einer anderen Einrichtung sagte: »Irgendwo anrufen und etwas in Anspruch nehmen, um Hilfe oder Unterstützung bitten. Ich weiß, dass ich dann lange warten muss und der Mensch am anderen Ende der Leitung verärgert und voller Vorurteile sein wird.« Darauf reagierte eine andere Frau: »Ich habe mal in einem Callcenter gearbeitet und wollte gerade sagen: ›Anrufe von Leuten entgegennehmen, von denen man schon weiß, dass sie frustriert und wütend sein werden, weil sie lange warten mussten, während ich doch versucht habe, hundert andere Anrufe abzuarbeiten.‹«
Tausende Menschen haben mir geschrieben, um von einer Menge verschiedener Herausforderungen zu berichten. Diese Vielfalt haut mich geradezu um, denn das sind Zusammenhänge, von denen ich niemals vermutet hätte, dass diese Forschungsergebnisse darauf anwendbar wären. Hier mal ein Auszug der E-Mail-Betreff-Zeilen, die oft mit den Worten beginnen »Wie Ihr Vortrag geholfen hat …«: Alzheimerfamilien, Feuerwehrleuten, dem Überlebenden einer Hirnverletzung wie Ihrer, beim Abschluss des größten Deals meines Lebens, bei den Verhandlungen über einen Hauskauf, bei einer Collegebewerbung, Erwachsenen mit Behinderung, einem Weltkriegsveteranen, der seinen Stolz verloren hatte, bei der Überwindung eines Traumas, bei der Weltmeisterschaft im Segeln, Kindern, die gemobbt werden, bei fehlendem Selbstvertrauen in der Dienstleistungsbranche, Fünftklässlern mit Angst vor Mathematik, meinem Sohn mit Autismus, einer Opernsängerin bei einem schwierigen Vorsingen, beim Präsentieren einer neuen Idee vor meinem Chef, beim Finden meiner Stimme, als ich einen Vortrag halten musste. Und das ist nur eine kleine Auswahl.
Alle Reaktionen, die ich auf den TED-Talk bekam, waren Geschenke, weil sie mir geholfen haben, besser zu verstehen, wie und warum diese Forschung solche Resonanz hervorruft. Kurz gesagt: Diese Geschichten haben mir geholfen zu begreifen, wie ich dieses Buch schreiben sollte, und mich motiviert, es zu tun. Sie stammen aus der ganzen Welt, von Menschen aus allen Schichten, und auf den folgenden Seiten möchte ich viele davon mit Ihnen teilen. Vielleicht klingt darin ja auch Ihre eigene an.