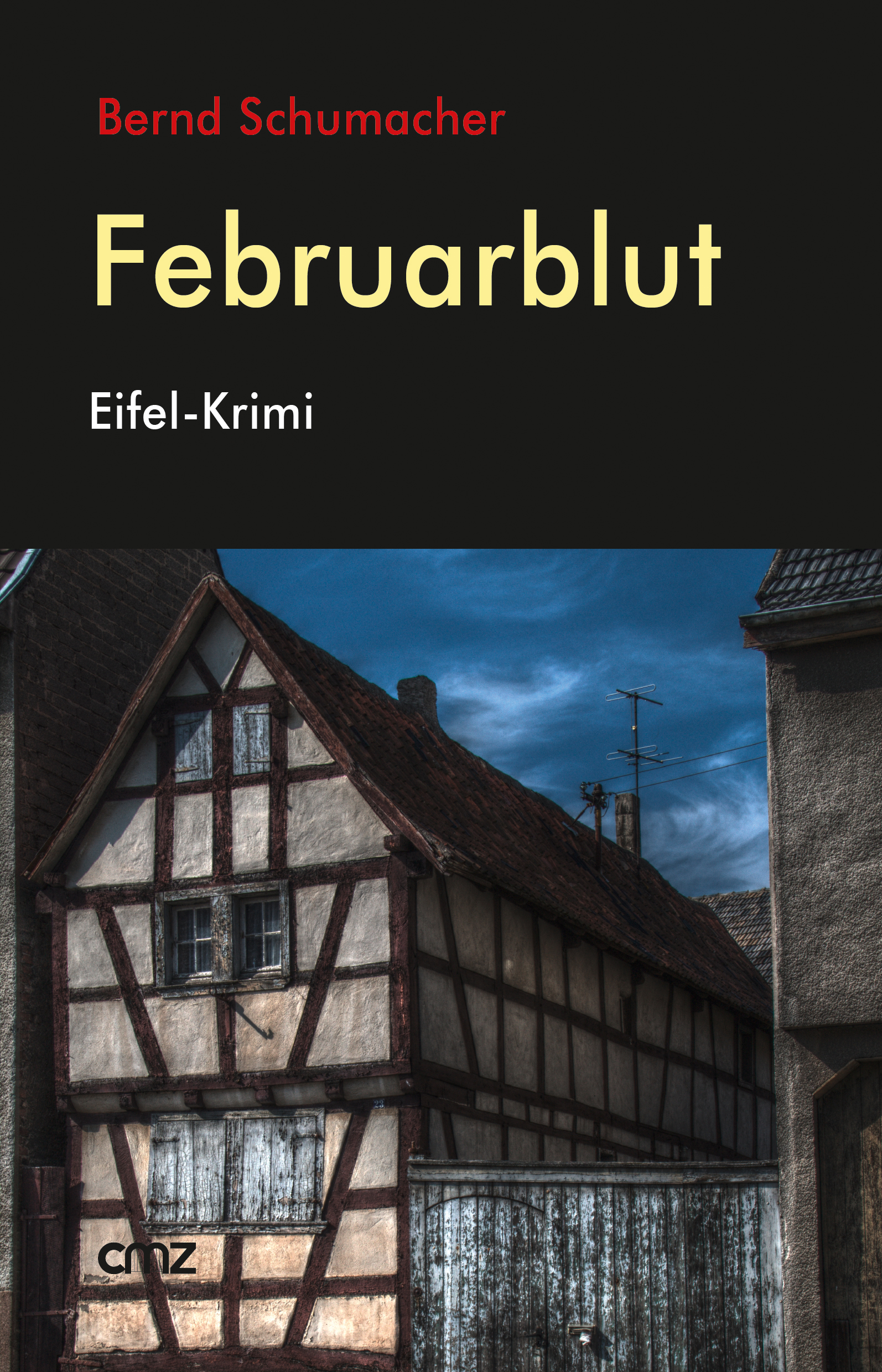
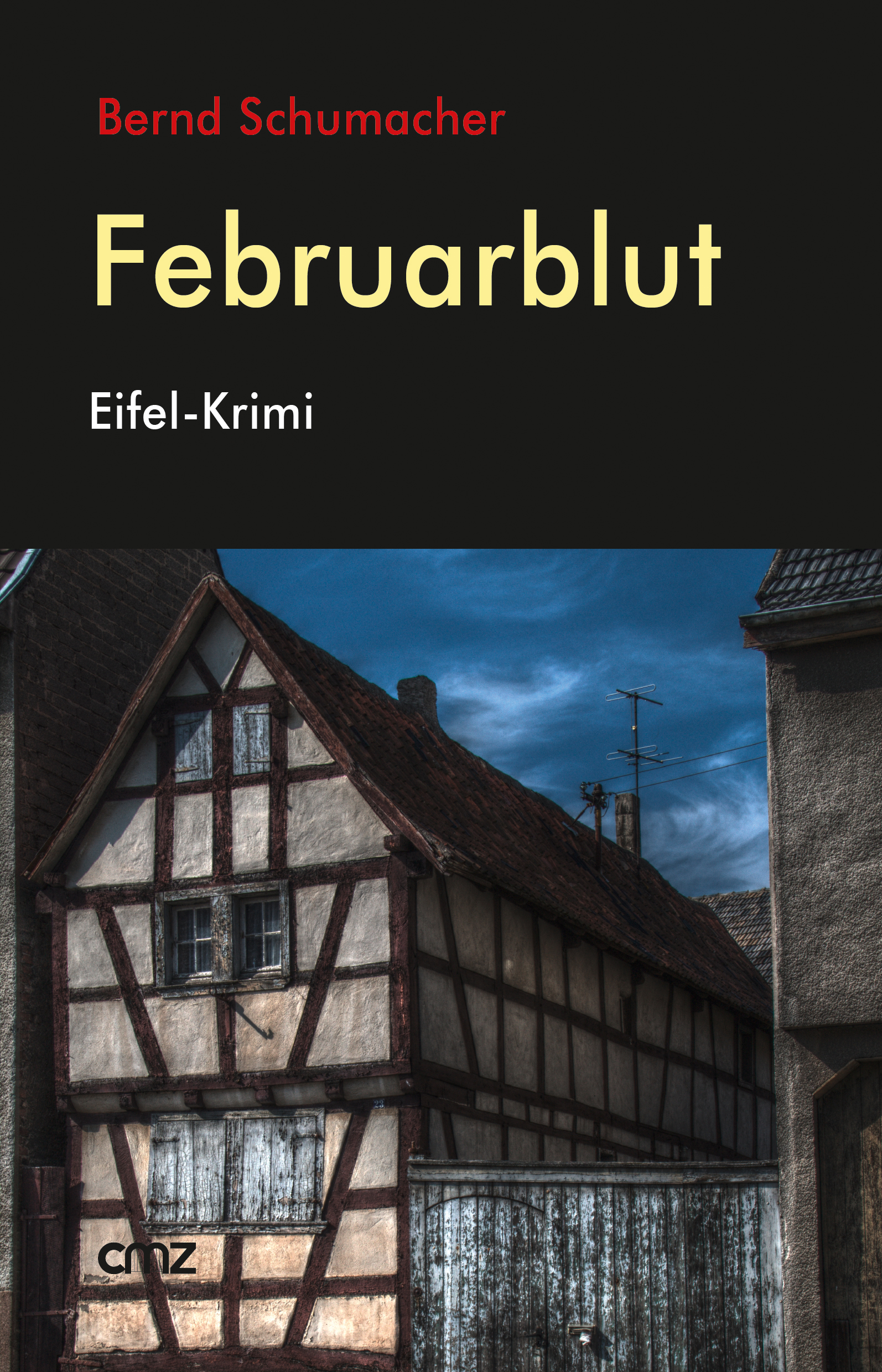
Autoreninfo
Bernd Schumacher, Jahrgang 1952, ist verheiratet und lebt in Rheinbach. Er ist seit 1981 Lehrer am Staatlichen Berufskolleg Glas Keramik Gestaltung des Landes NRW Rheinbach. Seit über vierzig Jahren ist er außerdem Frontmann der Rheinbacher Rockgruppe »Tiebreaker«. Bei cmz erschien 2014 sein im 17. Jahrhundert spielender Kriminalroman »Die Rückkehr der Hexe«.
Haupttitel
Bernd Schumacher
Eifel-Krimi

Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2016 by CMZ-Verlag
An der Glasfachschule 48, 53359 Rheinbach
Tel. 02226-9126-26, Fax 02226-9126-27, info@cmz.de
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagbild:
Fachwerkhaus (Slick, Wikimedia Commons)
Umschlaggestaltung:
Lina C. Schwerin, Hamburg
eBook-Erstellung:
rübiarts, Reiskirchen
ISBN Paperback 978-3-87062-166-7
ISBN epub 978-3-87062-271-8
ISBN mobi 978-3-87062-272-5
20160219
www.cmz.de
www.schumacher-rheinbach.de
Widmung
Für meine Frau Ruth
und meine Töchter Susanne und Jennifer,
die mich ermutigt haben,
diesen Roman zu schreiben.
Erstes Kapitel
Montag, 9. Februar 1953, 13 Uhr 25
Montag, 9. Februar 1953, 16 Uhr 10
Zweites Kapitel
Dienstag, 10. Februar 1953, 11 Uhr 20
Dienstag, 10. Februar 1953, 12 Uhr 10
Dienstag, 10. Februar 1953, 16 Uhr 50
Dienstag, 10. Februar 1953, 20 Uhr 35
Drittes Kapitel
Mittwoch, 11. Februar 1953
Mittwoch, 11. Februar 1953, 10 Uhr 50
Mittwoch, 11. Februar 1953, 16 Uhr 38
Viertes Kapitel
Donnerstag, 12. Februar 1953, 7 Uhr 12
Donnerstag, 12. Februar 1953, 9 Uhr 12
Donnerstag, 12. Februar 1953, 10 Uhr 35
Donnerstag, 12. Februar 1953, 16 Uhr 10
Donnerstag, 12. Februar 1953, 17 Uhr 50
Fünftes Kapitel
Freitag, 13. Februar 1953, 7 Uhr 58
Freitag, 13. Februar 1953, 8 Uhr 20
Freitag, 13. Februar 1953, 10 Uhr 45
Freitag, 13. Februar 1953, 12 Uhr 25
Freitag, 13. Februar 1953, 15 Uhr 25
Freitag, 13. Februar 1953, 17 Uhr 12
Sechstes Kapitel
Samstag, 14. Februar 1953, 6 Uhr 42
Samstag, 14. Februar 1953, 10 Uhr 23
Samstag, 14. Februar 1953, 19 Uhr
Siebtes Kapitel
Sonntag, 15. Februar 1953, 0 Uhr 15
Sonntag, 15. Februar 1953, 8 Uhr 47
Sonntag, 15. Februar, 11 Uhr 15
Sonntag, 15. Februar 1953, 14 Uhr 40
Achtes Kapitel
Rosenmontag, 16. Februar 1953, 8 Uhr
Rosenmontag, 16. Februar 1953, 16 Uhr 50
Rosenmontag, 16. Februar 1953, 19 Uhr 12
Neuntes Kapitel
Veilchendienstag, 17. Februar 1953, 6 Uhr 45
Veilchendienstag, 17. Februar 1953, 14 Uhr 5
Veilchendienstag, 17. Februar 1953, 15 Uhr 40
Zehntes Kapitel
Dienstag, 17. März 1953, 8 Uhr 45
Nachwort
Die »Februarblut«-Wanderung
»Tassilo, Tassilo!« Der Ruf des Jungen hallte von den Wänden des stillgelegten Steinbruchs wider, verstärkt durch die klare Luft des kalten Winters im Februar des Jahres 1953, der die Voreifel schon seit mehr als drei Wochen nicht aus seinen Klauen ließ.
Er war, wie jeden Tag nach der Schule, auf seiner Runde mit dem Jagdhund seines Vaters unterwegs, die ihn von seinem Zuhause, der Ölmühle, an den Rand des Rheinbacher Stadtwaldes führte. Dort hatte er zunächst auf dem Schwanenweiher einige Bahnen auf dem zugefrorenen See gedreht, bevor er sich zu seinem Lieblingsspielplatz aufmachte, der wie kein anderer Ort die Abenteuerlust eines Zehnjährigen weckte. Wie schon oft hatte er mit seinen Spielkameraden die steilen Hänge erklettert oder war im Geiste auf dem Rücken seines Pferdes von einer Seite des Steinbruchs zur anderen galoppiert. Doch jetzt war dafür keine Zeit. Seine Mutter wartete mit dem Mittagessen.
»Tassilo, Tassilo!« Seine schrille Stimme schreckte einige Kolkraben auf, die mit frechem Gekrächze aus den Wipfeln einer Buche davonflogen. Warum hörte der Hund nicht?
Seine Aufmerksamkeit musste durch etwas Besonderes in Anspruch genommen worden sein, denn er war gut erzogen und gehorchte ansonsten aufs Wort. Der Junge lief einige Schritte und stieg dann in ein Gebüsch, in das er Tassilo hatte verschwinden sehen. Nachdem er sich durch die verschneiten Zweige des Dickichts gezwängt hatte, konnte er den Hund sehen, der wie wild in dem gefrorenen Boden scharrte. Schnee und gefrorene Erdbrocken wirbelten dem Jungen entgegen. Er hielt die Hände schützend vors Gesicht.
»Mensch, Tassilo«, rief er verärgert. »Was machst du denn hier? Mama wartet doch mit dem Essen auf uns.«
Doch weder die unmittelbare Nähe des Jungen noch seine mahnenden Worte konnten den Hund von seinem Tun abhalten. Erst ein harter Klaps auf sein Hinterteil zeigte Wirkung. Jaulend drehte sich Tassilo um und zeigte seine Beute. Der Junge erkannte einen großen Knochen, den der Hund triumphierend zwischen seinen starken Kiefern hielt.
»Was hast du da schon wieder ausgegraben?«, fragte der Junge ungeduldig und versuchte Tassilo den Knochen zu entreißen. Das war gar nicht so einfach, denn der Hund war nicht gewillt, seine Beute so rasch wieder aufzugeben. Erst als der Junge mehrmals heftig an dem Knochen zerrte, ließ er ihn los.
»Jetzt aber ab nach Hause!«
Der Junge leinte seinen Hund an und warf den Knochen, so hoch er konnte, in den Hang des Steinbruchs. Dort rutschte er noch einige Meter die Böschung hinab, bevor er sich in einem Ginsterbusch verfing.
Schwester Maria Ignatia war schon seit siebenunddreißig Jahren Ordensschwester im Rheinbacher Kloster, welches der Orden der »Schwestern unserer lieben Frau« im Jahre 1911 in Rheinbach erbaut hatte. Das mächtige, im Neobarock-Stil erbaute Gebäude lag an der Tomberger Straße, einer schönen Baumallee, die den Südwesten der Kleinstadt mit dem Stadtwald verband. Es war Maria Ignatia zur lieben Gewohnheit geworden, kurz vor der Dämmerung und dem gemeinsamen Abendgebet dem muffigen Geruch des Klosters zu entfliehen und einen ausgedehnten Spaziergang im Klosterpark zu machen. Besonders der hintere Teil des Parks hatte es ihr angetan.
Hier erfreute sie sich im Sommer an den von den Klostergärtnern angelegten Blumenbeeten mit ihrer bunten Pracht. Obwohl diese jetzt im Winter verschwunden waren und auch die kalte Witterung der alten Ordensschwester arg zusetzte, wollte sie nicht auf die liebgewonnene Abwechslung verzichten.
Mit einem langen, gefütterten Wintermantel und dicken Wollhandschuhen stieg sie die Treppe zur Nebenpforte hinunter.
Leise ließ sie die schwere Eingangstür hinter sich ins Schloss fallen, denn sie wusste, dass Schwester Ludwiga, die Oberin des Klosters, es gar nicht gerne sah, dass die älteren Schwestern im Winter bei Schnee und Glatteis das Kloster verließen.
Mit kleinen Schritten trippelte sie von der Pforte auf den verschneiten Parkweg. Das Geräusch ihrer Schuhe auf dem verharschten Schnee bereitete ihr sichtlich Vergnügen. Sie zog ein kleines Büchlein aus dem Ärmel ihres Mantels: der Sonnengesang des Heiligen Franziskus, ihre Lieblingslektüre, in der der Heilige den Schöpfer so wundervoll für die Vollkommenheit der Natur pries.
Sie kannte den Weg so gut, dass sie es sich leisten konnte, ihre Aufmerksamkeit den Liedern des Buches zu widmen, ohne in Gefahr zu geraten, vom Weg abzukommen.
Nach einer Weile, als sie sich auf der Höhe einer kleinen Tannenschonung im hinteren Teil des Klosterparks befand, glaubte sie ein Geräusch zu hören. Sie unterbrach ihren Spaziergang und lauschte in die Stille.
Nichts. Sie schüttelte den Kopf.
Wer sollte sich um diese Uhrzeit auch in diesen Winkel des Parks verirren? Tiere des nahen Waldes konnten es auch nicht sein, da das Klostergelände von einem hohen Zaun umgeben war.
Doch dann hörte sie wieder etwas!
Nein, es konnte keine Einbildung sein. Es war ein Geräusch, als würde jemand gegen Metall klopfen.
In diesem Augenblick sah sie ganz deutlich Fußspuren auf dem Weg, der in die Tannenschonung hineinführte. Auch das war ungewöhnlich. Sie war sich ganz sicher: Diese Spuren waren gestern Abend noch nicht dagewesen. Der Weg führte zu einer Bunkeranlage, die sich die Ordensschwestern 1942 hatten bauen lassen.
Jetzt waren diese Bunker, Gott sei Dank, nutzlos. Jeder im Kloster mied diesen Ort, der so sehr an die schrecklichen Geschehnisse des Krieges erinnerte.
Einen Moment zögerte sie.
Ihre Vernunft sagte ihr, dass sie besser so schnell wie möglich zum Kloster zurückkehren sollte, um ihre Beobachtungen zu melden. Schließlich siegte jedoch ihre Neugier. Langsam folgte sie dem kleinen Pfad in die Schonung. Als sie die Bunkeranlage von weitem sehen konnte, glaubte sie, Licht aus dem Treppenabgang zum Bunker schimmern zu sehen. Gerade hatte sie sich entschlossen weiterzugehen, als das Licht erlosch.
Instinktiv suchte sie Schutz hinter einer kleinen Fichte.
Eine Gestalt in einem langen, schwarzen Ledermantel stieg langsam die Betontreppe empor, die in das Innere des Bunkers führte. Der Mann hatte eine Taschenlampe in der Hand. An der obersten Stufe verharrte er noch einen Moment, schaute sich prüfend um und setzte sich dann in Richtung der alten Schwester in Bewegung.
Hatte er sie gesehen?
Einen Augenblick glaubte sie, dass ihr Herz vor Angst stehen bliebe. Nun war er so nah, dass sie ihn hätte berühren können. Sie begann zu beten: »Gegrüßest seist du, Maria …« Als sie mit großer Erleichterung sah, dass sich der Mann mit schnellen Schritten entfernte, war es ihr ein Bedürfnis, das Gebet an ihre Schutzpatronin aus Dankbarkeit bis zum Ende zu sprechen.
Eine Weile harrte sie noch in ihrem Versteck aus und lauschte den Schritten. Als sie nichts mehr hörte, tastete sie sich langsam in Richtung Bunkereingang und stieg die Treppe hinunter. Sie erkannte, dass jemand die schwere Eisentür, die normalerweise den Weg in den Bunker versperrte, aufgebrochen hatte. Als sie die letzte Stufe erreicht hatte, öffnete sie vorsichtig die Tür.
Ein penetranter Geruch aus Blut und Schweiß stieg ihr entgegen. Obwohl die einsetzende Dämmerung den Bunkerraum kaum erhellte, konnte sie schemenhaft das Innere des Bunkers erkennen. Sie glaubte zunächst ein riesiges Kreuz zu sehen, ähnlich dem, das über dem Altar der Klosterkapelle hing. Doch als sie einige Schritte näherkam, wusste sie, dass sie sich getäuscht hatte.
Sie prallte zurück.
Was Schrecklicheres hatte sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Die Szenerie erinnerte sie an die Gestalten der apokalyptischen Bilder der Maler Breughel und Bosch, die die Fantasien ihres bigotten Geistes schon so oft geängstigt hatten. Es war ein Mensch, der dort an den Armen an der Bunkerdecke aufgehängt war.
Der Kopf war eine einzige blutige Masse. Obwohl er vornüberhing, konnte sie die starren Augen und die heraushängende Zunge erkennen. Der Körper war auf Höhe der Kniekehlen eingeknickt, so dass die Knie fast den Boden berührten.
Schwester Maria Ignatia wollte schreien, aber ihrem Mund entfuhr nur ein kehliger Laut. Sie drehte sich um und hastete nach draußen. Durch den Schock hatte sie die Orientierung verloren und prallte mit dem Kopf gegen die Eisenzarge der Bunkertür. Trotzdem gelang es ihr, die Treppenstufen zu erreichen. Benommen kroch sie auf allen vieren nach oben.
Als sie das Ende der Treppe erreicht hatte, spürte sie, wie ihr das Blut von der Stirn auf ihre Lippen lief.
Ihr wurde schwarz vor Augen.
Dann brach Schwester Maria Ignatia zusammen.