

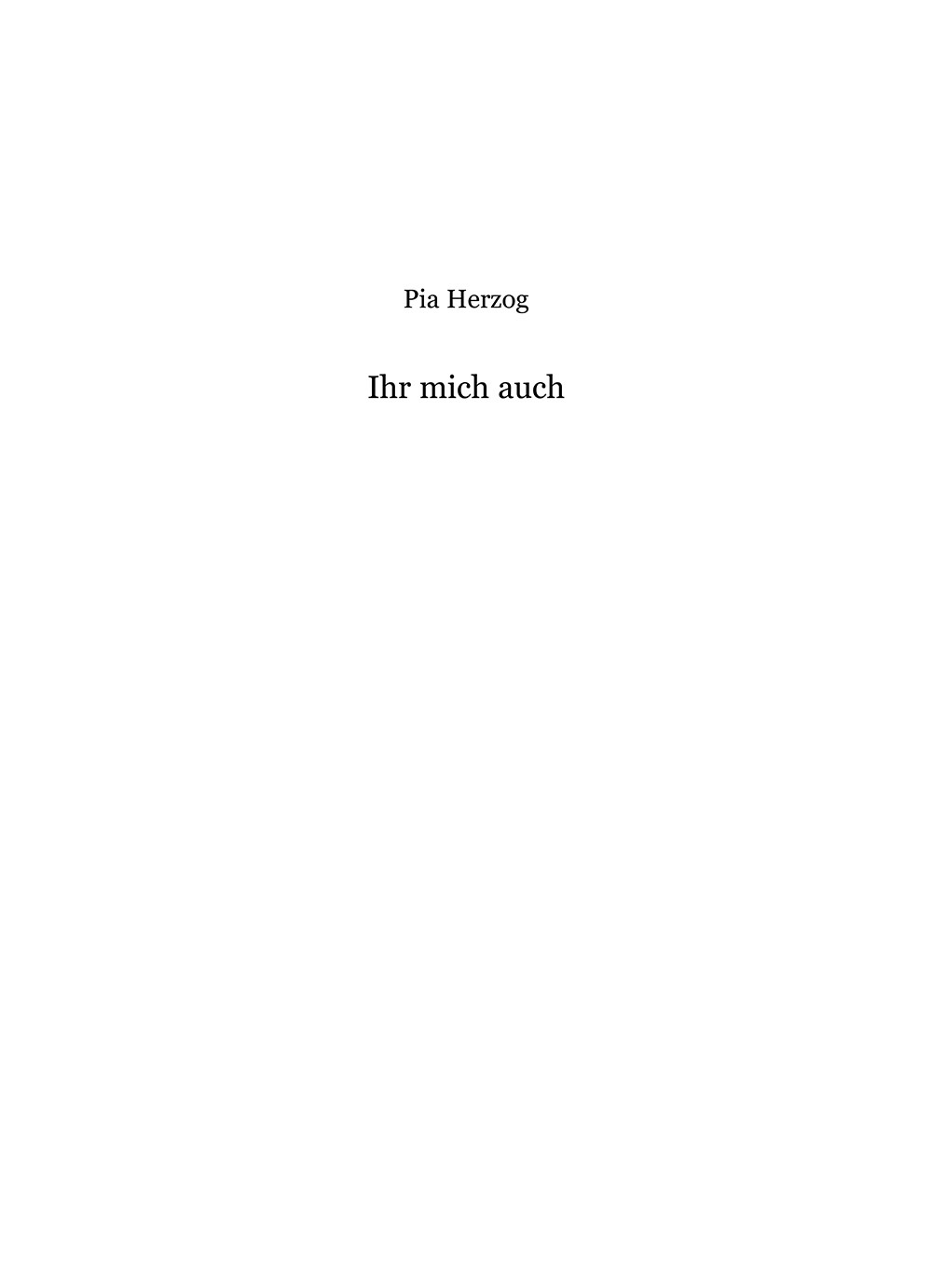
Originalcopyright © 2019 Südpol Verlag, Grevenbroich
Autorin: Pia Herzog
Titelillustration: Corinna Böckmann
E-Book Umsetzung: Leon H. Böckmann, Bergheim
ISBN: 978-3-96594-002-4
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Mehr vom Südpol Verlag auf:
www.suedpol-verlag.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
1
Vor dem Drogeriemarkt hielt ich an und holte tief Luft. Ich würde da jetzt reingehen, mir die Farbe greifen, sie unter meinem T-Shirt verstecken und kackendreist wieder rausmarschieren. War doch nichts dabei, oder?
Zugegeben, das wäre Diebstahl. Egal. Ich musste das Zeug haben. Nicht wegen des Nervenkitzels, sondern weil ich es haben wollte. Also fasste ich mir ein Herz, betrat den Laden und zog das Ding durch.
Wo die Farbe stand, wusste ich genau. Schließlich war ich schon neunmal dran vorbeigeschlichen, an drei verschiedenen Tagen. Heute griff ich zu.
Aber irgendwie war die Packung größer, als ich in Erinnerung hatte. Wenn ich sie unter mein T-Shirt steckte, sah ich vermutlich aus, als sei ich mit einem Schuhkarton schwanger.
Ich zögerte – einen Moment zu lang. Plötzlich war der Gang voll mit Menschen. Die wollten sich doch nicht alle die Haare färben?
Ich wich einen Schritt zurück. Und noch einen. Vor so vielen Zuschauern konnte ich unmöglich etwas klauen. Verdammt. Am besten brach ich die ganze Sache ab. Kurzentschlossen drehte ich um und steuerte auf den Ausgang zu. Dabei musste ich mich zwingen, nicht zu rennen.
Fünf Meter vor der Tür fiel mir auf, dass ich die Farbe noch in der Hand hielt. Das durfte doch nicht wahr sein!
Aber wenn bisher niemand was gemerkt hatte, konnte ich sie eigentlich auch mitgehen lassen. Ohne weiter drüber nachzudenken, klemmte ich mir die Packung unter die Achsel und machte, dass ich rauskam.
Sobald ich mit meiner Beute auf der Straße stand, atmete ich aus. Und dann erwischte mich die Adrenalinwelle mit voller Wucht. Mein Herz raste und ich keuchte wie nach einem Boxkampf. Mit beiden Armen hielt ich meinen Körper umklammert und presste das Haarfärbemittel fest an meinen Bauch.
Da landete eine Hand auf meiner Schulter. „Wen haben wir denn hier?“
Ohne mich umzudrehen, riss ich mich los und rannte. Der andere immer hinterher. Ich hörte das Geräusch seiner Schritte auf dem Asphalt und warf den Turbo an. Schnell vergrößerte sich mein Abstand zum Tatort. Trotzdem blieb der Kerl mir auf den Fersen. Im Zickzack hetzte ich durch die Gassen der Innenstadt und betete, dass ihm irgendwann die Luft ausging. Doch das passierte nicht. Stattdessen merkte ich, wie ich selbst an die Grenzen meiner Puste kam.
Als ich nicht mehr konnte, bog ich in einen Hinterhof ein und quetschte mich in den nächstbesten Hauseingang. Da stand ich nun und bemühte mich, so leise wie möglich zu japsen. Aber mein Verfolger hatte mich gesehen. Schon hörte ich seine Schritte auf mich zukommen. Ich saß in der Falle und er wusste es.
Ach ja, nur um eins klarzustellen: Dass ich geklaut hatte, war keine Mutprobe oder so was. Falls das vielleicht einer gedacht haben sollte und enttäuscht ist, dass niemand kam, um mich zu beglückwünschen oder mir auf die Schulter zu klopfen. Wegen dieser Aktion würde ich nicht in irgendeine angesagte Clique aufgenommen werden. Dieser Diebstahl war reine Notwendigkeit. Mutproben hatte ich nicht nötig. Und eine Clique erst recht nicht.
Ich drückte mich noch tiefer in die Nische und presste die Augen fest zu, als ob ich dadurch unsichtbar wurde. Die Schritte hielten genau vor mir. Gleich würde der Typ mich packen und zur Polizei schleifen. Und dann würde ich so lange auf der Wache festgehalten werden, bis meine Mutter mich abholen kam.
Doch nichts dergleichen geschah, obwohl mein Verfolger mich auf keinen Fall übersehen haben konnte. Misstrauisch wagte ich einen Blick.
„Rhys!“ Die Erleichterung schoss durch meinen Körper wie vorhin das Adrenalin.
Rhys war mein für den Rest der Welt unsichtbarer Freund und ich war höllisch froh, ihn zu sehen. Doch die Freude währte nicht lange. Diese Moralapostel-Schnute, die er inzwischen aufgesetzt hatte, kannte ich nämlich nur zu gut. Rhys war imstande und brachte mich dazu, das Diebesgut zurückzubringen und mich freiwillig der Polizei zu stellen. Darauf war ich im Moment nicht besonders scharf, deshalb stieß ich mich von der Hauswand ab und machte, dass ich wegkam.
Mit wenigen Schritten holte er mich ein. „Mann, Lu, was soll der Scheiß? Wirst du jetzt ’ne Diebin oder was?“
Ich presste die Lippen fest aufeinander und tat so, als sei er Luft. Doch Rhys ließ nicht locker. „Such dir lieber ein paar anständige Freundinnen, damit du nicht immer so hirnverbrannte Alleingänge startest!“
„Ich brauche keine Freundinnen.“
„Ha, ha, ha. Dann wenigstens einen Freund. Aber einen richtigen. Einen zum Knuuutschen!“ Demonstrativ schmatzte er Küsschen ins Weltall.
Zum Dank für diesen geistreichen Wortbeitrag bekam er von mir den Mittelfinger gezeigt. Ich hatte mir abgewöhnt, lange zu reden, wenn sich die Dinge auch auf diese Art klären ließen.
Taten sie aber nicht. Rhys lästerte weiter. Also trat ich ihn vors Schienbein. Er jaulte auf und krümmte sich – nur um eine Sekunde später aufzuspringen und mich auszulachen. „Ich bin ein Phan-tooom, schon vergessen?“
Er war kein Phantom. Er war mein zweites Ich, mein Alter Ego. Bloß dass niemand außer mir ihn sehen oder hören konnte.
Vielleicht ist Alter Ego nicht ganz das richtige Wort, aber mir fällt kein besseres ein. Manche Leute verwandelten sich nämlich in ihr Alter Ego. Superman zum Beispiel. Das konnte ich nicht. Das heißt, ich lief nicht plötzlich rum wie Rhys oder so. Obwohl ich das ziemlich cool gefunden hätte, denn manchmal war er viel mehr Ich als ich selbst.
Mittlerweile befanden wir uns auf dem Weg zur Bushaltestelle und weit genug weg von der Drogerie, sodass ich es wagen konnte, Rhys meine Beute zu zeigen.
„Pink?“ Zweifelnd sah er von dem Etikett zu mir und zurück und schüttelte den Kopf. Dann grinste er.
Ich grinste ebenfalls. Rhys hatte mal pinke Haare gehabt. Früher, als wir uns kennenlernten. Wegen einer Wette. Damals ging es darum, wie lange er es durchhielt, jeden Tag etwas Pinkes anzuziehen. Die gefärbten Haare hatten ihm mehrere Monate gebracht und die Chucks auch. Letztere waren meine Idee gewesen. Inzwischen sahen sie allerdings mehr grau aus als pink.
Bisher hatte ich noch nie versucht, meine Haare zu färben. Sie fielen mir bis auf den Rücken, waren aber struppig und widerspenstig. Und blond. Blond ist was für brave Mädchen. Dieser Gattung gehörte ich schon seit dem Kindergarten nicht mehr an.
Im Bus war es heiß und stickig, aber zum Glück nicht voll. Rhys lümmelte sich auf dem Sitz neben mir. In meiner Vorstellung war er größer als ich und ein bis zwei Jahre älter. Natürlich hatte er leuchtend grüne Augen. Die waren so umwerfend grün, als hätte er in Chlorophyll gebadet. Er war nicht der erste Freund, den ich erfunden hatte, aber bei Weitem der aufregendste.
Das mit den erfundenen Freunden fing an, als ich noch mit meiner Mutter in Ghetto-Neustadt wohnte. Einem Stadtteil, wo jede Menge Hochhäuser aus dem Asphalt wuchsen. Damals wollte meine Mutter mir nicht erlauben, allein auf den zwei Blocks entfernten Spielplatz zu gehen. Also behauptete ich, dass ich gar nicht allein sei. Selma war doch dabei.
In Wirklichkeit gab es keine Selma. Doch nachdem ich sie an jenem Nachmittag erfunden hatte, konnte ich draußen tun und lassen, was ich wollte.
Seitdem trafen Selma und ich uns öfter. Bald kannte ich sie in- und auswendig. Und meine Mutter auch, denn ich erzählte zu Hause ständig von ihr. Mit der Zeit wurde Selma für uns beide immer echter. Ich wusste, was sie anzog, wo sie wohnte und wie sie tickte.
Als sie ein halbes Jahr später zu meiner Geburtstagsfeier kommen sollte, flog auf, dass sie gar nicht wirklich existierte. Da war sie aber schon meine beste Freundin.
Wahrscheinlich ist meine Mutter nur mit mir aufs Land gezogen, um sie loszuwerden. Selma wohnte ja in Ghetto-Neustadt und einfach mitnehmen konnte ich sie nicht. Ich habe dann auch tatsächlich angefangen, mich mit den Kindern in meiner neuen Klasse zu verabreden. Doch irgendwie war das nicht dasselbe.
Meine nächste selbsterfundene Freundin hieß Aurelie. Sie war total hübsch, zog immer Mädchenkleider an und machte sich nie schmutzig. Nach ein paar Monaten verboten ihre Eltern ihr allerdings, mit mir durch die Pfützen auf den Feldwegen zu rennen oder im Müll nach brauchbaren Dingen für unsere Bude zu wühlen.
Da war Daphne schon besser. Allerdings guckte sie lieber Fernsehen, als dass sie mit mir durch die Gegend zog und Straßenlaternen austrat.
Nacheinander erfand ich noch drei oder vier andere beste Freundinnen, bis ich eines Tages Rhys kennenlernte. Damals lehnte er im Bus am Entwerterkasten. Mit seinen grünen Augen zwinkerte er mir zu und baumelte wenig später kopfüber zwischen den Halteschlaufen von der Querstange. Ganz egal, dass ihm dabei die Jacke über die Ohren rutschte. „Wetten, dass ich durchhalte, bis du aussteigen musst?“
„Wetten nicht?“
Er hielt durch. Auch wenn sein Kopf hinterher genauso pink leuchtete wie seine Haare.
Heute benahm er sich im Bus wesentlich zivilisierter als damals. Außer, dass er gerade mit den Fingerknöcheln einen Beat gegen die Rücklehne seines Vordermannes trommelte. Aber mich störte das nicht. Ich hatte sowieso nur meine neue Haarfarbe im Sinn.
Zu Hause angekommen rannte ich die Treppe hoch, die wie eine Sammlung alter Schiffsplanken knarzte. Meine Mutter war noch nicht da, also schloss ich die Tür auf und schob Rhys rein. Da unsere Wohnung unterm Dach lag, war es hier noch viel heißer und stickiger als im Bus. Ich ließ mich auf mein Bett fallen, um mir in aller Ruhe die Gebrauchsanweisung der Packung durchzulesen. Dabei warf ich versehentlich mein Handy vom Nachttisch, das dort am Ladekabel hing. Automatisch hob ich es auf und guckte aufs Display: keine neuen Nachrichten, keine verpassten Anrufe. Hätte mich auch gewundert, mich versuchte nie jemand zu erreichen. Also legte ich es wieder weg. Während ich den Beipackzettel auseinanderfaltete, hängte sich Rhys an den dicken Holzbalken unterm Dach und machte Klimmzüge.
Fürs Haarefärben brauchte ich ein altes Handtuch. Nichts leichter als das. Alte Handtücher hatten wir massenweise. Großzügig entschied ich mich für das hässlichste.
Und dann ein altes Hemd. Auch damit konnte ich dienen. Sämtliche meiner Klamotten erbte ich von meinem Cousin. Der gute Cedric war zwei Jahre älter als ich. Außerdem schien er in letzter Zeit massiv in die Breite gegangen zu sein. Die meisten der Erbstücke hätte ich bequem als Zelt benutzen können. Doch mit Hilfe einer scharfen Schere und meiner Uralt-Nähmaschine hatte ich noch jedes Teil in Form gebracht. Dass die ursprünglichen Designer bei meinem Anblick Bauchschmerzen bekommen würden, war so gut wie sicher.
Während die pinke Farbe einwirkte, verzockten Rhys und ich die Zeit. Er gewann ein Computerrennen nach dem anderen und grinste wie ein Gummibärchenmilliardär. Den Rechner hatte ich übrigens auch von meinem Cousin geerbt. Sogar ins Internet kam ich mit der Kiste.
Schließlich beschloss ich, dass wir lange genug gewartet hatten. Unter kaltem Wasser wusch ich die getrocknete Farbe aus meinen Haaren. Danach rubbelte ich alles mit dem hässlichen Handtuch trocken. Das Ergebnis war perfekt.
„Wow“, staunte Rhys und fuhr mir mit beiden Händen durch die pinken Zotteln. Auch ich war zufrieden und machte mich ans Auskämmen.
Als ich zur Hälfte durch war, hörte ich den Schlüssel im Schloss unserer Wohnungstür. Hektisch griff ich nach dem Handtuch und wickelte es mir um den Kopf. Keine Sekunde zu früh.
Meine Mutter erschien im Flur, stürzte auf mich zu und riss mich in ihre Arme, sodass ich fast keine Luft mehr bekam.
„Ich hab einen Job!“, kreischte sie mir ins Ohr.
Halb taub wich ich zurück. Sie ließ mich los und tanzte durch den Flur. „Ich hab einen Job! Ich hab einen Job!“
Rhys und ich sahen uns gegenseitig an. Job klang nach Geld. Und Geld konnten wir gut gebrauchen.
„Was für ein Job ist das denn?“
Anstelle einer Antwort packte sie mich an den Händen und walzte mit mir durch die Wohnung. Wir fegten etliche Papiere vom Tisch, rissen den alten Kerzenständer um und brachten die Büchereibücher durcheinander, die im Flur gestapelt waren. Derweil bemühte sich Rhys, nicht im Weg rumzustehen.
Lachend und keuchend landeten wir schließlich auf meinem Bett. Dabei rutschte mir das Handtuch vom Kopf. Als meine Mutter die pinken Haare sah, bekam sie einen Schreikrampf. Hatte ich es nicht geahnt?
„Soll ich uns vielleicht einen Tee kochen?“ Was Besseres fiel mir auf die Schnelle nicht ein. Mit etwas Glück funktionierte es trotzdem, denn meine Mutter gehörte zu den Leuten, für die Tee das Allheilmittel schlechthin ist.
Tatsächlich ging ihr Schreien in ein Röcheln über und hörte irgendwann ganz auf. Sie erhob sich, schnaubte vor sich hin und wankte in die Küche. Wahrscheinlich wollte sie mal wieder von einer höheren Macht wissen, womit sie so eine missratene Tochter wie mich verdient hätte.
Ich unterdrückte ein Stöhnen, folgte ihr und setzte schon mal den Kessel auf. Anschließend durchwühlte ich sämtliche Schränke auf der Suche nach Keksen. Ich fand keine.
„Frag sie nach ihrem Job“, raunte Rhys mir zu. „Sonst versucht sie gleich wieder, ihren Psychologie-Mist auf dich anzuwenden.“
Nach ihrer Ausbildung zur technischen Zeichnerin hatte meine Mutter angefangen, Sozialpädagogik zu studieren, und hätte sie nicht jedes Mal vor dem Examen kalte Füße bekommen, wäre sie mit dem Studium schon seit Jahren fertig. Dass sich das Ganze so lange hinzog, konnte aber auch daran liegen, dass sie sich ständig Freisemester nahm, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Psychologie war eins ihrer Hobbys und sie ließ keine Gelegenheit aus, an praktischen Beispielen zu üben. Meistens an mir. Das ging selten gut, deshalb tat ich, was Rhys mir geraten hatte, und fragte sie: „Was ist denn das für eine Stelle?“
„Jemand hat sich auf den Aushang im Supermarkt gemeldet. Ein Herr Kunzendorff. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Nette Studentin sucht Nebenjob, weißt du noch?“
Ich wusste nicht mehr. Ich nickte trotzdem. Währenddessen hängte ich die Teebeutel in die Kanne.
Rhys schnitt eine Grimasse. Nette Studentin!
Dabei sah er dermaßen komisch aus, dass ich nur mit Mühe ein Kichern unterdrücken konnte.
Der Job bestände darin, tagsüber auf Kunzendorffs Tochter aufzupassen, berichtete meine Mutter. Das Mädchen hatte einen schweren Autounfall hinter sich und war lange im Krankenhaus gewesen. Da ihr Vater nicht wollte, dass sein Töchterchen allein zu Hause war, während er im Büro saß, sollte meine Mutter ihr Gesellschaft leisten. Er hatte nicht mal etwas dagegen, dass sie während der Arbeitszeit lernte. Hauptsache, sie war körperlich anwesend.
„Klingt das nicht fantastisch?“ Das Leuchten kam zurück in ihre Augen.
In der Tat klang das fantastisch. Ein bisschen zu fantastisch, ehrlich gesagt. „Wie viel zahlt er dir?“
„Hundertzwanzig Euro am Tag.“
Wow.
„Das sind 2400 Euro im Monat! Wochenenden nicht mitgerechnet.“ Rhys konnte es kaum fassen. Damit wären auf einen Schlag sämtliche offenen Rechnungen bezahlt. Inklusive der Miete für die nächsten Monate. Der Kessel pfiff. Ich beeilte mich, das Wasser aufzugießen.
„Wo ist der Haken?“
„Kein Haken.“ Meine Mutter lachte.
Das war unmöglich. Niemand bezahlte einem Babysitter fünfzehn Euro in der Stunde. „Was musst du noch alles machen? Putzen? Kochen? Bügeln?“
„Dafür gibt es eine Haushälterin.“
Ihr Glück. Meine Mutter war eine ziemliche Niete in solchen Dingen. Meistens musste ich mich darum kümmern, alles, was aussah, als entwickelte es in nächster Zeit ein Eigenleben, aus der Küche in die Biotonne zu verbannen. Andernfalls wurden wir wahrscheinlich irgendwann von unserem eigenen mutierten Müll gefressen.
Kopfschüttelnd stellte ich zwei große Tassen auf den Tisch. Bei der einen fehlte der Henkel und die andere war so ausgeblichen, dass das ursprüngliche Motiv schon nicht mehr zu erkennen war.
Ich gab Rhys zu verstehen, dass er mit aus meiner Tasse trinken müsse. Wenn ich Geschirr für ihn deckte, regte sich meine Mutter immer so auf und das konnte ich gerade nicht gebrauchen.
Warum gerieten Erwachsene auch so leicht in Panik, wenn ein Mädchen in meinem Alter einen Fantasiefreund hatte? Andere erfanden einen Vater. Dem schrieben sie sogar Briefe. Das war doch noch viel schlimmer.
Obwohl mir ein erfundener Vater auch nicht geschadet hätte. Besser als gar keiner. Oder vielmehr einer, der sich schon vor Jahren verkrümelt hatte und anscheinend weder mit meiner Mutter noch mit mir je wieder etwas zu tun haben wollte.
„Was sind das für Leute?“ Der Name Kunzendorff sagte mir nichts. „Kenne ich die?“
Meine Mutter zuckte die Schultern. „Glaube ich nicht. Bisher war das Mädchen irgendwo in der Schweiz im Internat.“
Rhys pfiff durch die Zähne. Sowohl Schweiz als auch Internat bedeuteten Geld. Umso seltsamer, dass der Mann eine Studentin anheuern wollte und keine professionelle Kinderpflegerin. Aber meine Mutter war manchmal ein bisschen naiv, was solche Dinge anging. Das war nicht der erste Job, dem sie so begeistert entgegensah, und es würde nicht der letzte sein, den sie nach ein paar Tagen wieder hinschmiss. Demnach war hier Vorsicht geboten.
Mit einem Kopfnicken wies Rhys mich darauf hin, dass der Tee lange genug gezogen hatte. Ich warf die Teebeutel in den Ausguss und schenkte uns ein. Meine Mutter griff nach ihrer Tasse und pustete versonnen auf die Oberfläche, sodass ihre Brille vom Wasserdampf beschlug. Nachdem sie ein paarmal genippt hatte, lehnte sie sich zurück, streckte die Beine aus und sagte: „So, und jetzt zu dir. Wo hast du diese abartige Farbe her?“
Ich wusste, dass sie mir nicht glauben würde, wenn ich ihr vorschwindelte, dass das Zeug ein Werbegeschenk war und ich es im Briefkasten gefunden hatte. Deshalb versuchte ich auch gar nicht, irgendwas zu beschönigen. Mit ziemlich schlechtem Gewissen berichtete ich von dem Diebstahl. Die ganze Aktion war echt locker gewesen, solange nur Rhys und ich davon wussten. Aber einen Erwachsenen einzuweihen, machte alles hochoffiziell und viel ernster als nötig.
Kaum hatte ich geendet, fragte mich meine Mutter: „Hast du die Packung aufbewahrt?“
Mit gesenktem Kopf nickte ich.
„Sehr gut. Sobald ich mein erstes Geld in der neuen Stellung verdient habe, gehst du zur Drogerie zurück, gestehst deine Tat und bezahlst das Färbemittel.“
2
Nachdem meine Mutter ihren Tee ausgetrunken hatte, erzählte sie mir, wo die Kunzendorffs wohnten. Das Haus lag zwei Kilometer außerhalb unseres Örtchens, also gar nicht weit von hier. Komisch, dass wir die Familie nicht kannten.
„Heute Abend um halb neun bin ich mit ihm verabredet, um die Formalitäten zu erledigen und seine Tochter schon mal kennenzulernen.“
„Können wir mitkommen?“, fragte ich und berichtigte mich im selben Atemzug: „Kann ich mitkommen?“
Rhys zielte mit dem Zeigefinger auf mich und drückte ab. Ich verdrehte die Augen.
„Dich soll ich mitnehmen?“ Meine Mutter schnaubte.
Ich nickte kräftig. Einer musste schließlich aufpassen, dass sie es nicht vermasselte.
„Dich? Mit pinken Haaren?“ Entschieden schüttelte sie den Kopf.
„Dann warte ich eben draußen vorm Haus.“
„Du bist echt neugierig, weißt du das?“
Ich grinste nur.
„Außerdem wird es bestimmt spät. Und morgen ist Schule.“
„Egal. Ich hab in den ersten beiden Stunden frei.“
Meine Mutter seufzte. „Na schön, wenn’s unbedingt sein muss ...“ Sie goss sich Tee nach und verzog sich mit der Tasse in ihr Allerheiligstes. Ganz früher war das mal unser Wohnzimmer gewesen. Mittlerweile war es jedoch in ein Arbeits- und Schlafbüro mutiert. Überall lagen Papierstapel, lebenswichtige Notizen und jede Menge Bücher herum. Nichts davon durfte von Unwissenden berührt oder womöglich verändert werden.
Für das Vorstellungsgespräch am Abend zog meine Mutter ihre Stöckelschuhe an und schminkte sich sogar. Darüber lachte Rhys sich halb tot. „Meine Güte, sieht das affig aus!“
Leider musste ich ihm zustimmen. Umso wichtiger, dass wir mitkamen.
Im Gänsemarsch überquerten wir den Hof, um unsere Fahrräder aus dem Schuppen zu holen. Meins quietschte und eierte und die Gangschaltung war Schrott. Übertroffen wurde es bloß noch von dem Drahtesel meiner Mutter, auf dem sie hockte, als hätte sie einen Stock verschluckt. Ich konnte nur beten, dass ihr neuer Arbeitgeber nicht aus dem Fenster guckte und uns kommen sah.
Die Adresse war nicht schwer zu finden. Hinter dem Ortsausgangsschild ging es nur noch geradeaus die Landstraße entlang. Das riesige Grundstück lag mitten zwischen Feldern und Weiden. Es wurde von einer Mauer begrenzt, die gerade so hoch war, dass sich alles, was sich dahinter befand, neugierigen Blicken entzog.
Auf der Einfahrt stellte meine Mutter ihr Fahrrad neben einem angeberischen Audi ab. Sie zupfte ihre Klamotten zurecht und klingelte am Tor. Ich wünschte ihr viel Glück. Dankbar lächelte sie mich an.
Wenig später ertönte ein Türsummer und sie trat ein. Rhys und ich spähten durch den Eingang, konnten aber außer einem riesigen Garten nichts erkennen.
Als meine Mutter verschwunden war, versteckten wir unsere Drahtesel ein Stück abseits im Graben. Dann huschten wir die Mauer entlang, bis wir einmal herum waren. Nirgends befand sich eine Stelle, an der wir uns durch die Mauer hätten zwängen können. Deshalb beschlossen wir drüberzuklettern, und zwar an der Hinterseite. Dort konnte uns wenigstens niemand von der Straße aus beobachten.
Die Mauer war nicht gerade niedrig, doch Rhys gelang es, sich daran hochzuziehen und auf der anderen Seite wieder runtergleiten zu lassen.
„Siehst du was?“, flüsterte ich neugierig.
„Komm rüber, Lu“, flüsterte er zurück.
War klar, dass mir das nicht erspart blieb. Fluchend und mit Abstrichen in der B-Note zog ich mich ebenfalls an der Mauer hoch. Oben angekommen machte ich mich erst mal platt wie ein Schnitzel und orientierte mich.
Das Haus stand vielleicht zehn Meter von der Mauer entfernt. Ein moderner Bau mit vielen Fenstern, die bis zum Boden gingen. Im hinteren Bereich des Gartens wuchsen höhere Bäume und einige Büsche. Wie dafür gemacht, um sich dahinter zu verstecken und anzupirschen. Rhys hockte in einem Ginster und machte mir ein Zeichen, ihm zu folgen. Also sprang ich von der Mauer und rannte geduckt zu dem Busch. Unter seiner Führung schlichen wir uns näher.
Es war noch hell genug, um ins Haus zu sehen. Die breite Fensterfront, auf die wir zusteuerten, gehörte offenbar zum Wohnzimmer. Davor lag eine Terrasse mit einigen zusammengeklappten Gartenmöbeln. Drinnen konnte ich eine Sitzgruppe erkennen. Weißes Leder. Der Boden war schwarz gefliest und glänzte wie in der Putzmittelwerbung.
Kunzendorff und meine Mutter waren tatsächlich hier. Von einem Mädchen war allerdings weit und breit nichts zu sehen.
Meine Mutter hockte auf einem der weißen Sessel, aber auf höchstens zwei ihrer vier Buchstaben. In der Hand hatte sie ein zerbrechlich wirkendes Sektglas, das schon halb leer war. Der Mann stand und redete. Meine Mutter nickte dazu. Hoffentlich erzählte er ihr nicht seine ganze Lebensgeschichte!
Er besaß ein ziemlich sympathisches Lächeln, wie ich zugeben musste. Ein Lächeln, dem man sofort Vertrauen schenken wollte. Trotzdem sah er irgendwie müde aus.
Ansonsten war er korrekt gekleidet, um nicht zu sagen: spießig. Er trug sogar Pantoffeln. Ich ahnte schon, dass seine Schweizer-Internats-Tochter nicht mit pinken Haaren und geerbten Jungen-Klamotten herumlief.
„Eins der Fenster steht auf Kipp. Wenn wir uns flach auf die Terrasse legen, können wir vielleicht hören, was sie sagen“, wisperte Rhys in mein Ohr. Es kitzelte und ich unterdrückte ein Kichern. Anstelle einer Antwort kroch ich los, er immer dicht hinter mir.