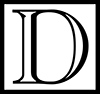
Paulus Hochgatterer
Fliege fort, fliege fort
Roman
Deuticke
Der meisterhafte neue Roman von Paulus Hochgatterer: Psychiater Horn und Kommissar
Kovacs, das Duo aus den Bestellern »Die Süße des Lebens« und »Das Matratzenhaus« ermitteln.
Der Sommer hält Einzug in Furth am See. Während sich die Hotelterrassen füllen und
die Schüler auf ihre Zeugnisse warten, nehmen besorgniserregende Ereignisse ihren
Anfang. Auf immer grausamere Weise werden Gewalttaten gegen ältere Menschen verübt.
Die Opfer scheint nur eins zu verbinden — das Bestreben zu schweigen. Schließlich
verschwindet auch noch ein Kind. Der Psychiater Raffael Horn und Kommissar Ludwig
Kovacs — das aus den Bestsellern »Die Süße des Lebens« und »Das Matratzenhaus« bekannte
Ermittlerduo — beginnen die spärlichen Anhaltspunkte zu verknüpfen und in lang vergangene
dunkle Geschichten einzutauchen. Der meisterhafte neue Roman von Paulus Hochgatterer
— Spannung auf höchstem literarischen Niveau.
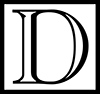
Paulus Hochgatterer
Fliege fort, fliege fort
Roman
Deuticke
Die erste Erfahrung, die ein Kind von der Welt macht,
ist nicht die, dass die Erwachsenen stärker sind,
sondern dass es selbst nicht zaubern kann.
Walter Benjamin
Alle sehen ihn. Er läuft schräg über die Wiese, dann den Feldweg entlang. Er stolpert, fällt hin, richtet sich wieder auf. Die Sonne liegt auf ihm, und sein Haar strahlt weiß. Es ist, als würde er durch ein Bild laufen, denkt sie. Manchmal nimmt sie die Dinge wahr, als seien sie nichts als gemalte Bilder. Er läuft kollernd wie ein kleines rundliches Tier. Wie ein junger Bär, denkt sie. Oder wie ein Wombat, nicht in Australien, sondern hier bei uns, mitten im September. Der Sommer war sehr groß, denkt sie, demnächst wird jemand seinen Schatten auf die Sonnenuhren legen, und auf den Fluren die Winde … Rilke-Blabla. Warum sie nicht anders kann, als sich für Pathos schlecht zu fühlen, weiß sie nicht.
Am Himmel bläht sich eine Wolke von Staren, zieht sich zusammen, fächert sich wieder auf. Vor ihr fällt die Wiese steil ab, braun gepunktet von unzähligen Maulwurfshügeln. Dahinter der Wald, ganz rechts der Teich, an der Zufahrt zum Bootssteg in flammendem Rot die beiden Wildkirschbäume.
Seine Arme machen kurze, schaufelnde Bewegungen, während er läuft. Sie erinnert sich, dass die braune Cordhose, die er trägt, dunkelgrüne Aufnäher über den Knien hat und dass sein Hemd hellgelb ist, mit feinen blauen Streifen. Der Rucksack mit seinen Sachen steht noch da, unmittelbar neben dem Eingang zum Speisesaal.
»Er kommt wieder«, sagt die Sozialarbeiterin und setzt sich an einen der Terrassentische. Sie nimmt eine Flügelmappe mit Gummizug aus ihrer Tasche, legt sie vor sich hin und kramt nach einem Stift. »Er kennt sich hier nicht aus«, sagt sie, »irgendwann wird er müde sein und umkehren.«
Sie sieht das Grau am Haaransatz der Frau, die korallenroten Perlen ihrer Halskette und das rosa-weiße Karo der Bluse. Mit einem Ruck steht sie auf. »Ich werde ihn holen«, sagt sie. Die Sozialarbeiterin hebt den Kopf und blickt sie erstaunt an. »Wie Sie meinen«, sagt sie, »sind Sie neu?«
»Ja«, sagt sie, »ich bin neu.«
Er ist schon ziemlich nahe an der Straße. Das nimmt sie wahr, als sie losrennt. Er läuft in flachen Schlangenlinien, ein wenig x-beinig, manchmal hüpft er, so, als befinde sich ein Hindernis auf dem Weg.
Er ist neuneinhalb Jahre alt, das hat sie sich gemerkt, Geburtstag Anfang Mai, das vierte von sechs Geschwistern, dritte Klasse Volksschule, schlechte Noten in allen Fächern, äußerst unregelmäßige Teilnahme am Unterricht.
»Bleib stehen!«, ruft sie. Er reagiert nicht, zweigt an der Straße nach links ab, nimmt wenige Schritte später den Forstweg in Richtung Wald. Sie läuft locker und merkt, wie der Abstand zwischen ihnen kleiner wird. Sie wird ihn einholen, denkt sie, ihn von hinten umfassen und einfach halten. Er wird sich nicht wehren.
»Du bist eine Romantikerin«, hatte ihr Vater gesagt, als sie ihm erzählte, sie habe beschlossen, das Literaturwissenschaftsstudium aufzugeben. Sie hatte gelacht und gesagt, ja, absolut sentimental. Es gehe ihr schlicht und einfach darum, die Welt ein Stück besser zu machen. Er hatte sie angeschaut, mit den Schultern gezuckt und gesagt, was könne ein Vater schon tun, wenn seine Tochter so etwas sage.
Der Boden ist trocken und weich von den Lärchennadeln vergangener Jahre. »Bleib stehen, ich tu dir nichts!«, ruft sie, obwohl es ihr ziemlich blöd vorkommt. Er schaut sich nach wie vor nicht um. Seine Arme rotieren jetzt, als wolle er sich irgendwo eingraben. Sie ist inzwischen so nahe, dass sie sein Keuchen hören kann. Sie reduziert ihr Tempo. Haare wie helles Stroh, denkt sie. »Bleib doch stehen«, ruft sie noch einmal, »keiner tut dir was.« Er schlägt einen Haken nach links, durchbricht einen schmalen Streifen Fichtensetzlinge und rennt im Zickzack den flachen Hang hinauf. Unmittelbar neben einer jungen Kiefer tappt er in ein Loch und fällt der Länge nach hin.
Sie steht neben ihm, mitten in den Heidelbeersträuchern. Er spricht nach wie vor kein Wort. Als er ihr schließlich das Gesicht zuwendet, weiß sie, dass sie noch nie so eine Art von Verzweiflung gesehen hat, so grenzenlos und so leer. Sie streckt ihm die Hand hin und zieht ihn hoch. Seine Finger sind warm. Was sie auf seinem hellgelben Hemd als Streifen in Erinnerung hatte, sind in Wahrheit Reihen winziger Hirschkäfer.
Ab dem ersten Schritt ihres Rückweges spürt sie das Bedürfnis zu reden. Sie hat keine Ahnung, woher es kommt, sie weiß nur, dass es mit Sonnenuhrschatten oder sonstigem romantischen Zeug nichts zu tun hat.
Sie erzählt von den Dingen, die sie über ihn weiß, aus dem Akt und aus dem Bericht der Sozialarbeiterin im Vorfeld der Überstellung. Sie erzählt davon, dass seine leiblichen Eltern nicht in der Lage gewesen seien, ihn und seine Geschwister zu versorgen. Der Vater habe seine Stelle in der Kunstdüngerfabrik verloren und dadurch noch mehr getrunken als zuvor, die Mutter sei psychisch labil und mit den sechs Kindern so überfordert gewesen, dass sie nicht einmal mehr Windeln für die Kleinsten habe besorgen können. Schließlich seien die Konflikte zwischen den beiden so eskaliert, dass man die Mutter in eine psychiatrische Anstalt einliefern habe müssen. Die zwei Kleinen seien in ein Säuglingsheim gebracht worden. Die Pflegeeltern, zu denen er mit den drei anderen gekommen sei, hätten seit Jahren Kinder aufgenommen. Es habe nie eine Klage gegeben, ganz im Gegenteil, bei den jährlichen Kontrollen durch das Jugendamt habe man stets einen hervorragenden Eindruck gehabt. Es sei wohl auf die einschichtige Lage des Bauernhofes zurückzuführen gewesen, auf das Fehlen eigentlicher Nachbarn, weshalb es so lange gedauert habe, bis die Wahrheit ans Licht gekommen sei, und auch der Umstand, dass jener Futtermittelvertreter bei seinem Besuch die neue Freundin dabeigehabt habe und es sich bei ihr um einen ausgesprochen netten und zugleich ausgesprochen neugierigen Menschen gehandelt habe, könne letztlich nur als eine glückliche Fügung bezeichnet werden. Es sei jedenfalls außerordentlich mutig von seiner Schwester gewesen, dieser fremden Frau den Ziegelrohbau neben dem Wagenschuppen zu zeigen, die versifften Matratzen, die Blechspinde, die Maurerböcke mit der Pressspanplatte oben drauf, die als ihr Tisch gegolten hätten.
Als sie die Straße erreichen, bleibt sie stehen. Sie verstehe, dass er davonlaufen müsse, sagt sie, wie solle er nach diesen Erfahrungen auch in der Lage sein, sich auf irgendjemanden zu verlassen. Trotzdem solle er zumindest versuchen, ihr zu glauben, dass es hier an diesem Ort keine Blechspinde, keine einfach verglasten Fenster und keine Stallarbeit ab Morgengrauen gebe. Ob denn das möglich sei? Der Bub blickt zu Boden und saugt seine Wangen ein. Von den Rändern seiner Ohrmuscheln schält sich die Haut. Sonnenbrand im September, denkt sie, und zugleich denkt sie, wie kindisch sie sich an etwas Nebensächlichem wie an einer Alliteration freuen könne und dass das wohl auch zu einer Romantikerin gehöre.
Sie gehen am überdachten Fahrradständer, am Schuppen für die Gartengeräte und am Kaninchenstall vorbei. Sie benennt die Dinge, als sei er gerade dabei, eine neue Sprache zu lernen: Fahrradständer, Geräteschuppen, Kaninchenstall. »Was hast du eigentlich in deinem Rucksack?«, fragt sie im Treppenhaus. Er blickt sie überrascht an und sagt nichts. »Entschuldige«, sagt sie und weiß nicht, warum. Sie fragt ihn, ob es ihn interessiere, wo er schlafen werde und wer seine künftigen Bettnachbarn seien. Als Nächstes werde man ihm vermutlich sein Bett zeigen und seine Plätze im Speisesaal und im Lernzimmer; außerdem werde man ihn mit den anderen bekannt machen. Letzteres solle ihn nicht beunruhigen, allen sei klar, dass man zu einem Neuen nett zu sein habe.
Sie durchqueren den Speisesaal in Richtung Terrasse. Draußen am Tisch der Sozialarbeiterin sitzt der Direktor, das ist von innen gut zu sehen. An der Brüstung lehnt der große, dunkelhaarige Erzieher, den sie Jimi nennen, und raucht. Er heißt so, weil er ausschließlich Jimi-Hendrix-T-Shirts trägt und behauptet, er habe eine Fender Stratocaster zu Hause. Als sie auf die Terrasse treten, packt die Sozialarbeiterin ihre Flügelmappe in die Tasche und erhebt sich. »Dann kann ich ja gehen«, sagt sie. Sie schüttelt dem Direktor die Hand. »Ich werde dich besuchen kommen«, sagt sie zum Buben, »obwohl dir ja nichts passieren kann, wenn du so engagierte Leute um dich hast.« Dann geht sie.
Der Bub steht da und starrt auf einen Punkt vor seinen Füßen. Mit dieser Vorgeschichte sei es nur allzu verständlich, dass das Kind in einer Situation, in der alles unvertraut sei, Angst habe, sagt sie. Wenn keiner etwas dagegen habe, werde sie ihn jetzt mitnehmen und ihm die wichtigsten Dinge zeigen, sein Bett, den Kleiderschrank, die Waschräume.
Der Direktor wendet sich dem Buben zu. Er streicht sich mit Daumen und Zeigefinger über den Nasenrücken und schüttelt langsam den Kopf. Es tue ihm leid, aber ganz so einfach sei die Sache leider nicht. Bei einem Heim für Kinder und Jugendliche handle es sich um eine hochsensible Einrichtung, die auf gewisse Arten von Erschütterung viel empfindlicher reagiere, als man sich das als Außenstehender vorstelle. Daher könne vor allem ein Angriff auf die Fundamente unter keinen Umständen unkommentiert bleiben. Noch einmal streicht er sich über die Nase, und plötzlich geht alles sehr schnell. Der Erzieher richtet sich auf, schnippt seinen Zigarettenrest übers Geländer und fixiert den Buben. Der Direktor macht zwei, drei Schritte auf ihn zu, fasst mit der linken Hand an sein Kinn, drückt es nach oben, holt mit der rechten aus und schlägt sie ihm flach ins Gesicht.
»Weglaufen wird hier unter keinen Umständen geduldet«, sagt er, »auch nicht bei Neuankömmlingen. Merk dir das.«
Irgendetwas versackt in ihrem Kopf, gerät durcheinander, und für ein paar Augenblicke gelingt ihr kein klarer Gedanke. Weglaufen werde bestraft, und Weglaufen werde verhindert, sagt der Direktor, auch sie solle sich das einprägen. Dabei lächelt er.
Der Erzieher steht breitbeinig da und sieht den Direktor fragend an.
»Erstens die Glatze«, sagt der Direktor, »zweitens der Einzug in Jerusalem.«
Der Erzieher grinst. »Wird gemacht«, sagt er.
Was werde gemacht, will sie wissen, was bedeute die Glatze und was der Einzug in Jerusalem. Der Direktor sagt, das Leben mancher Kinder verlaufe so, dass man es ab einem gewissen Punkt nur besser machen könne, langsam allerdings, Schritt für Schritt, Maßnahme für Maßnahme.
In diesem Moment hebt der Bub den Kopf und sieht sie an. »Du hast alles falsch gesagt«, sagt er.
»Was habe ich falsch gesagt?«, fragt sie.
»Über mich«, sagt er, »alles. Du weißt nicht einmal, dass mein Vater im Gefängnis sitzt. Für immer.«
Der Dicke liegt auf der Couch und schnarcht. Er trägt dunkelbraune Bermudashorts, die vermutlich noch nie eine Waschmaschine gesehen haben, ein Captain-America-T-Shirt und Schnürstiefel ohne Bänder — Doc Martens, behauptet er, aber alle wissen, dass das nicht stimmt. Ob echt oder nicht, sei auch völlig egal, sagt Fritz The Cat, in erster Linie sei es wichtig, dass er die Stiefel nicht ausziehe. Fritz hält sich am liebsten in der Nähe des Dicken auf, aus Gründen der emotionalen Sicherheit, sagt sie. Seine hundertzwanzig Kilo hätten etwas Stabilisierendes für die Umgebung, seien sozusagen das Gegenteil von einem Erdbeben. Fritz heißt in Wahrheit Friederike, ist dünn und rothaarig und behauptet, es gebe auf ihrer Körperoberfläche keinen Quadratzentimeter ohne Sommersprossen. Sie sagt, sie sei genderqueer, Subtyp drei b, rapid cycling, was bedeute, alle paar Wochen wechsle ihre Geschlechtsidentität, manchmal noch rascher. Chirurgische Maßnahmen, Hormontherapie oder der Verlauf der innerpsychischen Transformation sind daher kein Thema, und wenn irgendein ahnungsloser Mensch beginnt, von Brustamputation oder Testosteronboostern zu reden, kann es sein, dass sie wirklich böse wird. Dann fliegen Gegenstände, Flaschen zum Beispiel, Sitzmöbel oder die Mobiltelefone anderer Leute. Wenn sich Fritz in einer weiblichen Phase befindet, ist sie freundlich, heiter und ausgesprochen aufmerksam. Vor allem dem Dicken liest sie dann jeden seiner Wünsche von den Augen ab, bringt ihm Coca-Cola und Hotdogs und schnurrt, wenn er ihr seine Patschhand in den Nacken legt. Keiner versteht das. Norbert sagt, das Fundament dieser Beziehung sei vermutlich so etwas wie eine Perversion ohne Sexualität, und Natascha sagt darauf, so ein Blödsinn, im Grunde seien die beiden doch Kinder. Jetzt sitzt Fritz vor der Couch auf dem Teppich, hat die Ohren zugestöpselt und hört Musik vom Handy. Ihre rechte Fußspitze wippt.
Alles ist ruhig. Ich liebe meine Arbeit. — Ab und zu muss sie sich solche Dinge vorsagen. — Ich liebe dieses seltsame Souterrainlokal, das früher einmal eine Gerberei gewesen sein soll, ich liebe die dicken Mauern dieses Hauses, und ich liebe die Jugendlichen, die ihren Irrsinn nirgendwo sonst abladen können. Meine Kollegen liebe ich auch, manchmal. Sie geht in einer Schlangenlinie durch den Fernsehraum und sammelt Getränkeflaschen ein, fettgetränkte Pizzakartons und leere Zigarettenschachteln. Aus dem Casino hört sie das Knallen des Tischfußballs. In Ermangelung eines Gegenspielers schießt Malik einfach aufs Tor. Bis es hinten durch ist, hat er gesagt, als ihn Norbert gefragt hat, wie lang er das denn machen wolle. Sie wirft einen Blick in den Raum, hebt grüßend die Hand und geht wieder. Malik ist ihr unheimlich. Er ist blass, schwarzhaarig, muskulös und trägt einen schütteren Vollbart. Er behauptet, seine Mutter sei Prostituierte in der Ukraine gewesen und sein Großvater Geschäftsmann in Grosny. Bei ihm sei er aufgewachsen, und von ihm habe er seinen Vornamen. Trotzdem habe ihn der Großvater töten wollen.
Sie steckt alles bis auf die Flaschen in den Restmüll und steigt die paar Stufen zur Eingangstür hoch. Oben wendet sie sich um. Der Dicke heißt so, weil er dick ist, denkt sie, das Casino ist ein großer Raum, in dem ein Tischfußballtisch und ein Flipperautomat stehen, in dem also gespielt wird, und Malik wirkt zwar wie die personifizierte Selbstkontrolle, hat aber zu Hause vielleicht doch eine Kalaschnikow im Schrank. Ich mag es, wenn die Dinge klar benannt werden, denkt sie. Das Jugendzentrum selbst heißt Come In, ein Name, den sie blöd findet, der ihnen aber bei Gründung von der Stadtverwaltung aufs Auge gedrückt wurde. Sie kann Anglizismen nicht leiden, ebenso wenig Begriffe, die aus einem romantischen Willkommenspathos stammen: Kommt nur, hier darf ein jeder herein − so ein Schmarrn! Für die Namen, die das Team selbst damals wollte, hätte es kein Geld gegeben: Die Gosse, Kinderzimmer oder Saustall. Jetzt heißt das Ding Come In, und das öffentliche Geld wird trotzdem immer weniger.
Der Sommer bricht über sie herein, als sie die Tür öffnet, grell und heiß. Sie tritt auf die Straße, überquert den Körnermarkt, einen schmalen, rechteckigen Platz, geht die Salamander-Apotheke entlang, dann vorbei an Gerrit van Dalens Antiquariat mit seinem vollgeräumten Schaufenster. Sie zweigt links in eine kurze Stichstraße ab und steht nach wenigen Schritten vor dem Altstoffsammelplatz. Aus den Biomüll-Behältern stinkt es. Auf den gelben Bauch des Weißglascontainers hat jemand mit roter Farbe »Mario will be killed« gesprayt und etwas ungelenk einen Totenkopf daneben hingemalt. Graphomotorisch nicht gerade genial, denkt sie. Als sie die letzte PET-Flasche versenkt, merkt sie, wie sauer sie auf ihre Kollegen ist, auf Natascha wegen ihrer Besserwisserei, die sie mit drei Semestern Psychologiestudium rechtfertigt, auf Norbert und auf Iorgos wegen ihrer Macho-Allüren und auf Joseph, weil er ist, was er ist, ein Versager von Gottes Gnaden. In drei Tagen werden sie Supervision haben, da wird sie all diese Dinge zur Sprache bringen, direkt und kompromisslos. Die anderen werden überrascht schauen, und Rosemarie, ihre Supervisorin, wird zufrieden sein. Sie mag es, wenn die Dinge auf den Tisch kommen, das ist in dem Jahr, seit dem sie das Team berät, deutlich geworden.
»Du mit deinen blauen Haaren«, wird sie zu Natascha sagen, »— so, als wärst du selbst erst sechzehn«, und zu Iorgos, dass er sie mit seinem sentimentalen PASOK-Getue und überhaupt mit Griechenland in Ruhe lassen soll. Er solle sich endlich wirklich zuständig fühlen und nicht nur groß daherreden, Norbert, sein Zwilling im Nichtstun, genauso. Joseph Bauer gegenüber wird sie wahrscheinlich wieder einmal den Mund halten. Ein Benediktinerpater, den man ins Streetwork-Team gesteckt hat, weil er selbst einen zumindest genauso großen Knall hat wie die Jugendlichen, die er betreuen soll — was soll man da schon sagen. Er ist da und wird vom Orden bezahlt, aus, fertig, und dass er manchmal versucht, um fünf Uhr früh mit ein paar sechzehnjährigen Halbleichen so etwas wie ein Morgenlob abzuhalten, ändert nichts. »Er spricht mit Gott und bumst eine Volksschullehrerin, halleluja!«, hat der Dicke unlängst gesagt. Das bringt die Sache auf den Punkt. Stella Jurmann, besagte Lehrerin, liebt die Kinder, die sie unterrichtet, und sie liebt Joseph Bauer, irgendwie zumindest. Sie selbst ist sich bezüglich Letzterem ziemlich sicher, denn Stella ist ihre Schwester.
Vor Gerrits Schaufenster bleibt sie stehen. Ganz vorne liegt eine Reihe Rolf-Torring-Hefte aus den 1930ern, dahinter ein paar Bände Jörn Farrow’s U-Boot-Abenteuer. Links am Rand, gar nicht prominent platziert, entdeckt sie eine Erstausgabe von Selma Lagerlöfs Gösta Berlings Saga, im schwedischen Original. Achthundertzwanzig Euro. Ein halbes Monatsgehalt, denkt sie, und dann denkt sie, dass Gerrit zwar ein netter Mensch ist, ein kluger Kopf sowieso, der beinahe alle Bücher kennt, die jemals erschienen sind, dass sie aber jedes Mal, wenn sie mit ihm zu tun hat, ein seltsames Gefühl bekommt — so, als sei entweder sein Großvater ein Nazi-Offizier gewesen oder er selbst Sekretär in einem Geheimbund für die Pflege nordischer Runenschrift. Außerdem sind seine Ringfinger beinahe gleich lang wie seine Mittelfinger, an beiden Händen. Ich merke mir die blödesten Dinge, denkt sie.
Als eine Gruppe asiatischer Touristen vorbeigeht, streifen mehrere Leute ihren Rücken. Sie würde sich am liebsten umdrehen und laut schreien. Aus dem Augenwinkel sieht sie breitkrempige Strohhüte und einen aufgespannten schwarzen Regenschirm. Seit vor ein paar Jahren die Reiseveranstalter Furth am See entdeckt haben, werden ab Mitte Mai Busladungen von Menschen durch die Stadt geschleust. Die Stiftskirche, das gotische Viertel, eine Rundfahrt über den See, ein Eiskaffee auf einer der Hotelterrassen — immer dieselbe Route. Mittendrin das Come In. Das war nicht so geplant, führt aber regelmäßig zu spannenden Begegnungen. Etwa, wenn Fritz The Cat eine schlechte Phase hat und sich auf die Straße stellt, um sich durch den Blick jedes zweiten Vorbeigehenden diskriminiert zu fühlen. Zuletzt hat sie bei einer derartigen Gelegenheit einer Frau aus Berlin die Sonnenbrille vom Gesicht gerissen und mitten entzweigebrochen. Auf die Frage der Polizei, warum sie das gemacht habe, hat sie geantwortet, sie schaue faschistischen Menschen gern in die Augen. Danach fühle sie sich immer so frei.
Von weitem sieht sie Joseph vor dem Eingangstor stehen und mit beiden Armen heftig winken. »Regina!«, brüllt er. Sie beschleunigt ihren Schritt. »Was ist?«, fragt sie. Joseph trägt Jeans und ein verwaschenes graues T-Shirt. »Bist du ausgetreten?«, fragt sie. Er schaut sie überrascht an. »Nein, wieso?«, fragt er. Sie deutet auf seine Kleidung.
»Wo ist dein Habit?«
»In der Wäsche«, sagt er.
Drinnen dauert es einige Sekunden, bis sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Dann sieht sie, dass der Dicke nicht mehr schläft, sondern mitten im Raum steht und jemanden von hinten umfangen hält. Es ist Lisbeth. Sie tritt mit den Beinen um sich und brabbelt unverständliches Zeug. Auf der Couch liegt Magdalena, rundlich, blass, tief atmend, die Augen nach oben verdreht. Die anderen stehen rundherum.
Er habe die beiden Mädchen auf dem Rasen des Stiftsparks aufgelesen und in seinem Auto mitgenommen, erzählt Joseph, das sei ihm angesichts ihres offensichtlichen Ausnahmezustandes am vernünftigsten erschienen. Lisbeth habe sich schon dort hypermotorisch verhalten, Magdalena eher apathisch, beide seien jedenfalls ziemlich verwirrt gewesen.
»Und sie sind trotzdem einfach mitgefahren?«, fragt sie.
»Einfach stimmt nicht.«
»Sondern?«
Er habe sie vor die Wahl gestellt: entweder ins Kloster oder hierher, und sie hätten sich für hierher entschieden.
Sie schaut ihn ungläubig an. »War das dein Ernst?«, fragt sie.
»Was?«, fragt er zurück.
»Das mit dem Kloster?«
Irgendwie schon, sagt er, etwas Besseres sei ihm nicht eingefallen. Er steht da, in der Hand etwas, das aussieht wie ein Stapel DVDs. »Und, was machen wir jetzt?«, fragt er. Sie mustert ihn von oben bis unten. Wie ein kleines Kind, denkt sie, dann erinnert sie sich an einen Rat, den ihnen Rosemarie in ihrer letzten Team-Supervision für den Umgang mit komplexen Krisensituationen gegeben hat. »Wir wechseln die Ebene«, sagt sie.
Sie bittet Malik, das Blutdruckmessgerät zu holen. Zugleich greift sie nach einem von Lisbeths Handgelenken, um ihr den Puls zu fühlen. Der Dicke, der Lisbeth nach wie vor festhält, grinst. »Mir auch, bitte«, sagt er. »Vergiss es«, sagt sie, »du stinkst!«
Ein paar Minuten später hat sich die Sache beruhigt. Lisbeth und Magdalena sitzen nebeneinander auf der Couch, trinken Eiswasser mit Zitronenscheiben und wirken nicht mehr so, als würden sie demnächst sterben. Auf die Frage, was mit ihnen los sei, schauen sie einander an und bekommen einen kleinen Lachanfall. »Die Hitze«, sagt der Dicke, und Fritz murmelt etwas davon, wie sich eine Kombination von qualitativ hochwertigem Cannabis und MDMA auswirken könne. Malik dreht einen Tischfußball zwischen den Fingern und schüttelt den Kopf. »Was meinst du?«, fragt sie.
»Egal«, sagt er.
»Gar nicht egal«, sagt sie.
Malik schaut ins Leere. »Manchmal ist es die Hitze«, sagt er.
»Was?«, fragt sie.
»Was Menschen durcheinanderbringt.« Manchmal seien es auch die Dinge, die man zu sich nehme, sagt er, und manchmal das, was einem widerfahre. Jetzt schaut er sie an. »Und?«, fragt sie. Manchmal sei es auch das, was man tue, sagt er. Sie denkt an ukrainische Prostituierte und an Maschinenpistolen im Schrank, und dann denkt sie, dass es Dinge gibt, die einfach plausibel sind, wenn die richtigen Menschen sie aussprechen.
Joseph sagt, eigentlich habe er einen gemeinsamen Filmabend vorschlagen wollen − Der Herr der Ringe, er habe alle drei Teile mitgebracht. Der Dicke sagt, ja, Teil zwei, die Schlacht um Helms Klamm, das könne er gar nicht oft genug sehen, und Magdalena bekommt erneut einen Lachanfall. »Was ist?«, fragt Fritz. »Aragorn«, sagt Lisbeth, streckt lasziv die Zunge aus dem Mund und prustet dann ebenfalls los.
Während der Vorspann läuft, steht sie auf, in der Absicht, ins Büro zu gehen. Ein paar Rechnungen sind abzulegen, und das Service für die Gastherme ist fällig. Zugleich stellt sie sich vor, wie Viggo Mortensen sie von der Leinwand herab anschaut. Joseph folgt ihr. »Ich habe vorhin etwas vergessen«, sagt er, es sei wahrscheinlich nicht von Bedeutung. Anfangs habe sich im Stiftspark eine dritte Person bei den Mädchen befunden, ein junger Mann, von dem er nicht wisse, ob er auch ins Gymnasium gehe wie die beiden Mädchen, der jedenfalls ab und zu im Come In auftauche. Er habe sich lediglich gemerkt, dass sie, Regina, ihn einmal wohlstandsverwahrlost genannt habe. »Dünn, ernst und Brille?«, fragt sie. Ja, dünn, ernst und Brille, sagt er. Sie lacht. »Kaiser Max«, sagt sie, einer, der auch gern wichtig wäre.
Die Amsel sang seit ein paar Minuten. Er war wach geworden, kurz bevor sie begonnen hatte. In den letzten paar Wochen lief es täglich gleich: Er wachte auf, wartete, dann ging es los. Ein Amselmännchen beherrscht vierhundert verschiedene Strophen, hatte er gelesen. Wenn er den Oberkörper ein wenig anhob, konnte er den Vogel auf dem First der Scheune sitzen sehen, schwarz, schlank, sehr entschlossen. Irene würde demnächst ihre Augen öffnen, empört protestieren und sich dann den Polster über den Kopf ziehen. Einstweilen lag sie ruhig da, auf der Seite und von ihm abgewandt.
Er betrachtete sie. Meine Frau wird bunt, dachte Raffael Horn, sie hat immer schon den schönsten Rücken der Welt gehabt, aber in letzter Zeit wird sie auch noch bunt. Rot, braun, sonnengelb, die Haut voller Punkte und Flecken. Wie von Jackson Pollock gemalt, dachte er, zugleich, dass er ihr selbst so etwas nicht sagen durfte. Du kommst mit meinem Alter nicht zurecht − das war ihr Standardvorwurf, und er wusste, dass es sinnlos war, dagegen zu argumentieren. Irene war neunundfünfzig, drei Jahre älter als er. »Du bist die schönste Vierzigjährige, die ich kenne«, sagte er manchmal. Sie verdrehte daraufhin nur die Augen.
Horn schlüpfte vorsichtig aus dem Bett, nahm die Kleider, die er auf einem Stuhl bereitgelegt hatte, und verließ den Raum. Im Badezimmer fiel ihm ein, dass er das Schlafzimmerfenster eigentlich hätte schließen können. Egal, sie würde es selbst tun. Davor würde sie dem jungen Amselherrn ein paar Unfreundlichkeiten zurufen.
Die Sonne stieg hinter den Fichtenstämmen des Wäldchens hoch und tauchte die gegenüberliegende Hügelseite in orangefarbenes Licht. Horn saß vor dem Haus, trank Kaffee und aß Toast mit Zwetschgenmarmelade. Er dachte daran, dass Irene am Morgen länger schlief als er, dass sie gern im Bett frühstückte und er das hasste, und dass sie grundsätzlich zu frieren begann, wenn er den Vorschlag machte, den ersten Kaffee doch im Freien zu trinken. Er fragte sich, ob die Vorstellung, das Funktionieren einer Beziehung hänge von der richtigen Balance zwischen Unterschieden und Gemeinsamkeiten ab, nicht bloße Romantik war und es in Wahrheit auf viel banalere Dinge ankam, auf die Körpergröße zum Beispiel oder auf die Frequenz des Geschlechtsverkehrs. Er sei der einzige Brillenträger, den sie küssen könne, ohne dass eine Kollision mit ihrer eigenen Brille passiere, nur deswegen sei sie mit ihm beisammen, sagte Irene, wenn die Sprache auf die Hintergründe ihrer Beziehung kam, und er sagte darauf, er gehe davon aus, dass sie alle in Frage kommenden Brillenträger durchprobiert habe.
Etwas später überquerte Raffael Horn den Vorplatz des Hauses in Richtung Scheune. Die Sonne stand auf Höhe der Baumwipfel, und der erste Anflug von Tageswärme war zu spüren. Horn blieb stehen und lauschte. Die Amsel war verstummt.
Als er um die Ecke bog, erschrak er. Das Scheunentor stand offen, davor Tobias, eine Axt in der Hand. »Was hast du vor?«, fragte Horn. »Ein paar Leute erschlagen«, gab Tobias zur Antwort, »das macht man doch im Morgengrauen.«
»Du bist in deinem ganzen Leben noch nie um halb sechs Uhr früh aufgestanden.«
»Eben«, sagte Tobias, »haben wir eine Kettensäge?«
»Wofür brauchst du eine Kettensäge?«
Er könne sich nicht vorstellen, dass er das wirklich wissen wolle, sagte Tobias, aber okay, er könne auch zu Michael fahren, der habe erstens in der Firma mit Sicherheit eine Kettensäge und stelle zweitens keine blöden Rechtfertigungsfragen.
Horn hob beschwichtigend die Hand. »Ist schon gut«, sagte er, »komm mit.«
Er machte Licht, ging ins Hintere der Scheune, kramte in einem der beiden Weichholzschränke und holte eine alte Husqvarna-Motorsäge mit kurzem Schwert hervor. Er füllte Kettenöl und Benzin nach und reichte sie Tobias. »Wirf sie aber erst später an«, sagte er, »deine Mutter schläft noch.« Tobias bedankte sich mit einem Nicken. Im Weggehen wandte er sich um. »Haben wir eigentlich irgendwo Katzenfutter?«, fragte er. Horn schüttelte erstaunt den Kopf. »Wieso Katzenfutter?«, fragte er, »Mimi ist vor vier Jahren gestorben.« »Hätte ja sein können«, erwiderte Tobias. Dann verschwand er um die Ecke.
Raffael Horn betrachtete seine ölverschmierten Hände. Es geht nichts über Kinder, dachte er, man rackert sich für sie ab, man sorgt sich, man macht sich dreckig, und zum Dank dafür reden sie erst monatelang nichts mit einem und dann fragen sie nach Kettensägen und Katzenfutter. Er geht mir auf die Nerven, dachte er, ich finanziere sein Leben, er tut seit zwei Jahren nichts, und wenn ich mich erkundige, schnauzt er mich an.
Tobias hatte maturiert, unter anderem mit einer recht passablen Fachbereichsarbeit über den sozialen Wohnbau in Wien, hatte begonnen, in Salzburg Geschichte und Soziologie zu studieren, und war nach einem Semester auf Politikwissenschaften umgestiegen. Das war vor zweieinhalb Jahren gewesen, und kurze Zeit später hatte Irene zum ersten Mal geäußert, sie habe Angst davor, dass mit Tobias etwas Ähnliches passiere wie mit Michael. Michael, der ältere ihrer beiden Söhne, hatte auf Grund einer schweren Legasthenie so früh wie möglich die Schule verlassen und nur wenig später mit der Familie gebrochen, mit Irene genau genommen, von der er sich immer unzureichend unterstützt gefühlt hatte. Er hatte in einem kleinen Betrieb in Mooshaim Zimmermann und Tischler gelernt und war auf Grund seines Gefühls für das Material und auf Grund seiner Präzision innerhalb kurzer Zeit zum ringsum gefragten Spezialisten für Wand- und Deckenvertäfelungen geworden. Seine Rechtschreibung hatte für niemanden mehr Bedeutung gehabt. Die Brüder hielten zusammen. Michael ließ Tobias Gelegenheitsjobs zukommen, Fahrten mit dem Kleintransporter zum Beispiel oder Schiffbodennagelungen, und Tobias kümmerte sich um den Garten, wenn Michael und Gabriele auf Urlaub waren.
Mein Sohn braucht eine Axt und eine Kettensäge, dachte Raffael Horn, er sagt nicht, wofür, und das wirklich Traurige an der Sache ist, dass es mich nicht im Mindesten interessiert. Er soll studieren, dachte er, er soll Vorlesungen besuchen, und er soll Prüfungen machen, ansonsten soll er mich in Ruhe lassen, ganz einfach. Kürze ihm das Geld, hatte Irene gesagt. Mach es doch selbst, hatte er gedacht, aber nichts gesagt und bloß genickt. Meine Söhne, dachte er jetzt − ein Tischler mit Rechtschreibschwäche und ein verkrachter Student. Dann stieg er aufs Rad.
Er folgte der Straße bis zur Kehre, von der aus man zum ersten Mal einen freien Blick auf die Stadt hatte. Die Türme der Stiftskirche, die Stahlschlote des Holzwerks, die alten Hotels, ein Stück vom See. Unmittelbar danach bog er in einen Forstweg ein. Er fuhr erst den Begrenzungsrücken eines Grabens entlang, dann durch den Wald steil bergab. Ein Dachs, dachte er, einmal möchte ich auf dieser Strecke einem Dachs begegnen. Dachse graben Löcher in den Boden, damit sich die Menschen die Beine brechen, pflegte Irene zu sagen, Dachse fressen Igel, und sie stinken. Niemand frisst Igel, sagte er darauf, und sie sagte, doch, der Dachs sei ein abgefeimter Psychopath, der eine Technik entwickelt habe, zwischen den Stacheln an die weichen Bäuche der Igel zu kommen. Er wusste selbst nicht genau, was er an Dachsen so mochte. Sie waren lichtscheu, sie lebten in Familien, und sie hatten keine echten Feinde. Mit ihren Masken sahen sie aus wie Bankräuber. Vielleicht war es das. Wenn er in sich hineinhorchte, hatte ihn die Idee des Bankraubs immer schon fasziniert. Das Paradoxon, dass die Ungerechtigkeit der Besitzverhältnisse gerade im Moment des Rechtsbruchs sichtbar wurde. Der Bankkassier sitzt mit erhobenen Armen da, ein Repräsentant des nackten, zitternden Reichtums, ihm gegenüber der Räuber, immer noch ohnmächtig und immer noch arm, trotz seiner Waffe und seiner geldgefüllten Taschen. Deswegen sterben diese Verbrechen aus, hatte seine Kollegin Leonie Wittmann gesagt. Was stirbt aus?, hatte er gefragt, und sie hatte gesagt: Bankraub, Taschendiebstahl, Mord aus Eifersucht − die ehrlichen Verbrechen. Ehrlich?, hatte er gefragt, und sie hatte gesagt: Ja − ein Motiv, das auf ein gesellschaftliches Gefälle zurückgeführt werden könne, und eine Handlung, die ohne Internet auskomme −, das nenne sie ehrlich. Leonie Wittmann hatte einige Jahre an einer forensischen Klinik in Hamburg gearbeitet, vielleicht erklärte das ihre Haltung. Sie war klein, zart und im Kontakt extrem zurückhaltend — gar nicht das, was man mit Muttermördern oder Kindesmissbrauchern verband. Wenn man sie darauf ansprach, lächelte sie bloß und sagte kryptische Dinge wie: »Verblüffung ist eine ziemlich unterschätzte Interventionsform.«
Er querte eine sandige Zone auf dem Grund des Grabens. Die Reifen drehten kurz durch. Im Mai konnte man hier unter den Lattichblättern Morcheln finden. Jetzt war der Boden staubtrocken. Keine Spur von einem Pilz. Die Wurzeln der Weiden, die sich dort und da unvermittelt hochkrümmten, umkurvte er, ohne das Tempo zu reduzieren. Helm? Er trug nie einen Helm. »Ich habe den Kopf gern frei«, sagte er, wenn Irene mäkelte, außerdem, dass kein Fahrradhelm der Welt einen Genickbruch verhindern könne. Eine Reduktion der Schönheit infolge von Gesichtsverletzungen sei in seinem Alter egal, und wenn er sich den Kopf anhaue und dadurch ein wenig dümmer werde, bedeute das lediglich, dass etwas eintrete, was früher oder später sowieso zu erwarten gewesen wäre. Irene ging mit Fäusten auf ihn los, wenn er so etwas sagte. Er umschlang sie dann und küsste sie, bis sie abklopfte, weil sie keine Luft mehr bekam.
Er würde ihr doch ein E-Bike schenken, dachte er, als er westlich der Biologischen Beobachtungsstation die Bundesstraße erreichte, einzig und allein, um sie dazu zu bringen, hin und wieder mit ihm Rad zu fahren. Der reine Eigennutz, natürlich. Wenig später verwarf er die Idee wieder. Und was mache ich mit dem Cello?! Packe ich es mir auf den Rücken? Oder dir? Oder lade ich es auf einen Anhänger? — Er entkam derartigen Fragen nicht, und wenn er vorschlug, sie solle ihr Instrument doch in der Musikschule lassen, sagte sie: Das meinst du aber nicht im Ernst?! Einmal hatte er aus Gedankenlosigkeit gesagt, es könne doch auch nicht falsch sein, über Alternativen zum Musizieren nachzudenken, etwa für den Fall, dass sie schwerhörig werde. Sie hatte ihn angeblickt, wortlos und mit einem Entsetzen im Gesicht, von dem er augenblicklich wusste, dass er ihm nie wieder würde begegnen wollen.
Die Pappeln in der Zufahrtstraße zum Krankenhaus sahen aus, als hätten sie sämtliche Blätter eng angelegt. Die Rhododendren in den Vorgärten warfen ihre letzten Blüten ab, und die Hortensien ließen sich mit der Ausbildung ihrer Dolden ganz offensichtlich Zeit. Es hatte seit Ostern nicht mehr geregnet. Daran würde sich in den kommenden Tagen nichts ändern. Über der Kammwand standen rot leuchtende Federwolken. Die Dunstschicht, die auf dem See lag, würde spätestens in einer Stunde verschwunden sein. Die ersten Gewitter waren in etwa zwei Wochen zu erwarten, gegen Schulschluss, diese Regel galt seit Jahrzehnten, Klimawandel hin oder her.
Der Bedienstetenparkplatz war halb leer. Der Schichtwechsel des Pflegepersonals hatte noch nicht begonnen. Raffael Horn schloss sein Fahrrad an einen der Stahlbügel. Früher hatte er es ins Büro mitgenommen. Inzwischen war es in einem Alter, das einen Diebstahl eher unwahrscheinlich machte. Die Freaks an seiner Abteilung, Günther und Thomas zum Beispiel, lächelten mitleidig, wenn er von seinen Radfahrten erzählte. Sie selbst nahmen an Amateur-Straßenrennen teil und befuhren in Oberitalien oder in Slowenien Mountainbikerouten, auf die sich ein durchschnittlicher Mensch nicht einmal zu Fuß wagte. Sie besaßen Räder, die so viel kosteten wie ein Gebrauchtwagen, und fanden das völlig normal. Experten, aber Helmträger, dachte Horn − alles hat seinen Preis.
Der Portier streckte Daumen und Zeigefinger in die Höhe, als Raffael Horn an seiner Loge vorbeiging. Zwei Aufnahmen während der Nacht. Horn bedankte sich. In manchen Situationen ging nichts über den Verzicht auf verbale Kommunikation. Wenn er so etwas Irene gegenüber äußerte, sagte sie drauf: »Warum sagst du das mir? Ich bin Musikerin.« Trotzdem fühlte sie sich offenbar angegriffen.
Auf dem Weg zu seinem Büro begegnete er Bertram Ofenauer, dem Chef der Hausarbeiter. Seit kurzem hieß das Bereichsleiter Facility-Management. Ofenauer selbst lachte darüber und sagte, jetzt, ein Jahr vor seiner Pensionierung, stehe er somit auf dem Gipfel seiner Wichtigkeit. Horn hob die Hand. »Schon in aller Herrgottsfrüh auf der Suche nach irgendeinem Schaden«, sagte er. »Genau wie Sie«, sagte Ofenauer, »die Tür vom OP II schließt nicht richtig, und der Lift zur Hubschrauberplattform macht bei Ankunft oben ein komisches Geräusch.« Nichts, was ihn betreffe, sagte Horn, und Ofenauer sagte, man könne nie wissen, außerdem — ein komisches Geräusch ganz oben, das klinge schon auch ein wenig nach psychiatrischer Zuständigkeit. Horn mochte den Mann, wegen seiner Zuverlässigkeit und wegen seines simplen Humors. »Ein Hausarbeiter muss die Sicherungen finden, wenn der Strom ausfällt«, sagte Christina gelegentlich, »aber er muss weder Austern essen noch Schopenhauer zitieren können.« Sie hatte hundertprozentig recht, fand Horn, Austern wurden eindeutig überschätzt, Intellektualität sowieso.
»Was werden Sie machen, wenn Sie das einmal nicht mehr haben?«, fragte Horn.
»Wenn ich was nicht mehr habe?«, fragte Ofenauer.
»Klemmende OP-Türen, defekte Brandmeldeanlagen und Ärzte, die noch nie einen Schraubenzieher in der Hand gehabt haben«, sagte Horn. »Die Frage ist eher: Was werdet ihr machen?«, sagte Ofenauer und grinste.
Der Computer war runtergefahren. Horn bewegte die Maus hin und her − nichts. Erst als er auf den Einschaltknopf drückte, wurde der Rechner lebendig. Das passierte ein- bis zweimal pro Monat, und wenn er in der EDV nachfragte, stammelten sie etwas von Systemupdate oder automatischer Abschaltung auf Grund von Spannungsschwankungen. Unsinn. Sie überwachten seine Anwesenheit, da war er sich ganz sicher, sie lasen seine E-Mails, und sie kontrollierten, in welchen Abständen er die Entlassungsbriefe validierte. Manchmal bin ich ein wenig paranoid, dachte er, aber ein Schuss Paranoia wurde der Realität viel eher gerecht als das Vertrauen auf das Gute im Menschen.
Er überflog seine E-Mails, löschte die Einladungen zu Kongressen, von denen er noch nie gehört hatte, und zum Abonnement von Journalen, die gar nicht existierten, außerdem die Werbungen für Bürostühle, Aktenvernichter und Archivierungssysteme. Dann bewilligte er gegen einen gewissen inneren Widerstand den Urlaubsantrag von Anja Fröhlich, der neuen Logopädin. Eigentlich sollte sie hierbleiben. Sie erfreut mein Auge, und sie erfreut mein Herz, dachte er, mit ihrem Lachen, mit ihrer Frechheit und mit ihren knappen Tops. Warum will sie auf Urlaub gehen? Die anderen würden mit ihren Anträgen wieder im letzten Moment daherkommen, alle auf einmal, es war jedes Jahr das Gleiche.
Der Bildschirm flackerte. Er tat in den Einstellungen von Helligkeit und Kontrast herum, erreichte jedoch keine Verbesserung. Manches im Haus war vermutlich von Anfang an Schrott, in großen Mengen eingekauft, Hauptsache, der Preis stimmte. Er stand auf und stellte sich ans Fenster. Der Abflussbereich der Ache, der Schilfgürtel, der See. Zwei Stockentenfamilien paddelten flussaufwärts, zwischen ihnen ein einzelner Haubentaucher. Ich lebe gern hier, dachte Horn. Er hatte zwar erst lernen müssen, Stockenten, Blässhühner und Haubentaucher auseinanderzuhalten, inzwischen hatte er die Grundlagen der Ornithologie aber ziemlich drauf. Die Idylle mit Sommertourismus ist immer noch besser als Sommertourismus ganz ohne Idylle, pflegte Irene zu sagen, wenn er darüber phantasierte, sich vielleicht doch zusätzlich eine Wohnung in Wien anzuschaffen. Sie hasste die Hauptstadt. Brachte Horn diesen Umstand damit in Zusammenhang, dass sie seinerzeit von den Symphonikern abgewiesen worden war, wurde sie böse und sprach von der billigen Masche der Psychoanalytiker, alle Entscheidungen im Leben mit Hilfe früherer Kränkungen zu erklären. Die Suggestion von Leidenszuständen durch die psychoanalytische Mafia sei ein Manöver, das ausschließlich der Erhaltung der eigenen Arbeitsplätze diene, sagte sie, und die Möglichkeit, über eine Kränkung hinwegzukommen, ohne fünfhundert Stunden auf der Couch zu liegen, werde in erster Linie als Geschäftsschädigung betrachtet. »Nicht wahr, Mister Psycho!?«, sagte sie, und ihm blieb angesichts ihrer glühenden Ohren nichts anderes übrig, als auf der Stelle zu kapitulieren. »Stimmt«, sagte er dann, »spiel mir was vor.« Sie holte ihr Instrument und spielte etwas aus den Suiten von Britten oder eines von Mendelssohns Liedern ohne Worte in einer Transkription für Violoncello, und er spürte nach wenigen Takten, wie sehr es ihm egal war, an welchem Ort er ihr zuhörte, in Wien, auf dem Mond oder in Furth am See. Ab und zu kam es vor, dass sie keine Lust hatte, zu spielen. Dann biss er sie ins Ohr, und sie gingen ohne Musik ins Schlafzimmer.
Die Station war versperrt. Raffael Horn öffnete die Tür, indem er seinen Transponder ans Lesegerät hielt. Er lauschte. Alles war ruhig. Im Sozialraum saß Christina, die Stationsschwester, und brütete über dem Dienstplan. Ihre Haare werden grau, dachte Horn. Er steckte eine Kapsel in die Espressomaschine, drückte auf den Knopf und wartete, bis der Kaffee durchgelaufen war. »Warum ist die Tür zu?«, fragte er. Christina hob den Kopf. »Wegen Eugen Wild«, sagte sie, »und wegen Katrin.« »Welche Katrin?«, fragte Horn.
»Eine Neue. War noch nie da.«
»Eine Neue?«
»Ja, neu. Und schwierig.«
»Wieso schwierig?«
»Weil sie mich an mich selbst erinnert«, sagte Christina. Katrin Nemecek, ein vierzehnjähriges Mädchen, sei am Vortag nach der Schule mit ihrer Freundin im Strandbad gewesen. Eis, Cola, Sonneliegen − alles sei völlig unauffällig verlaufen, bis drei fremde Burschen auf die Mädchen aufmerksam geworden seien. Katrin sei blond, zart, hübsch jedenfalls, und auf den ersten Blick sei für jemanden, der mit solchen Sachen nicht vertraut sei, ihre autistische Störung nicht zu erkennen. Nicht, dass sie finde, die Neckereien der Jungs gegenüber den Mädchen seien in Ordnung gewesen, aber mit Katrins Reaktion habe niemand rechnen können. Horn zog fragend eine Augenbraue hoch. »Erst hat sie gebrüllt, sie werde die Cola-Flasche zerbrechen und alle töten, dann ist sie mit dem Kopf gegen einen Baumstamm gelaufen«, sagte Christina. »Ups«, erwiderte Horn. Christina zog eine Augenbraue hoch. »Das ist aber nicht sehr professionell«, sagte sie.
»Was?«
»Ups. Das ist nicht sehr psychiatrisch.«
»Tut mir leid«, sagte Horn und rührte eine Löffelspitze Zucker in seinen Kaffee, »hat sie sich verletzt?« Nur eine Schramme, sagte Christina, das sei auch nicht das Problem gewesen, genauso wenig wie die Polizei, die gerufen worden sei, weil man sich nicht anders zu helfen gewusst habe.
»Sondern?«