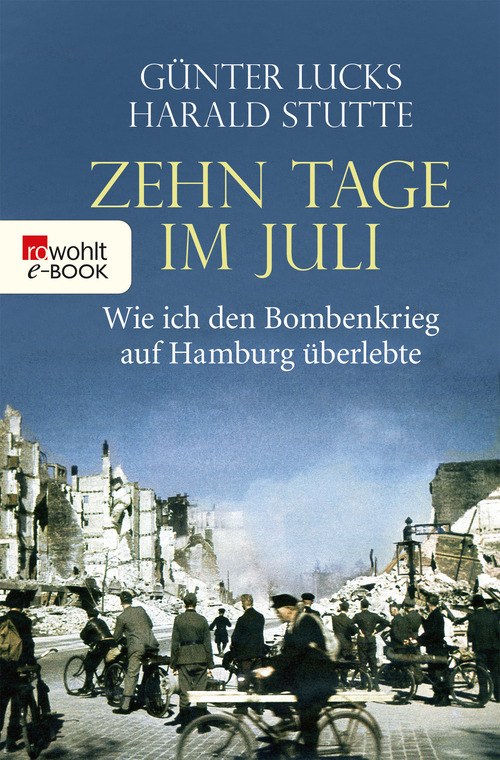
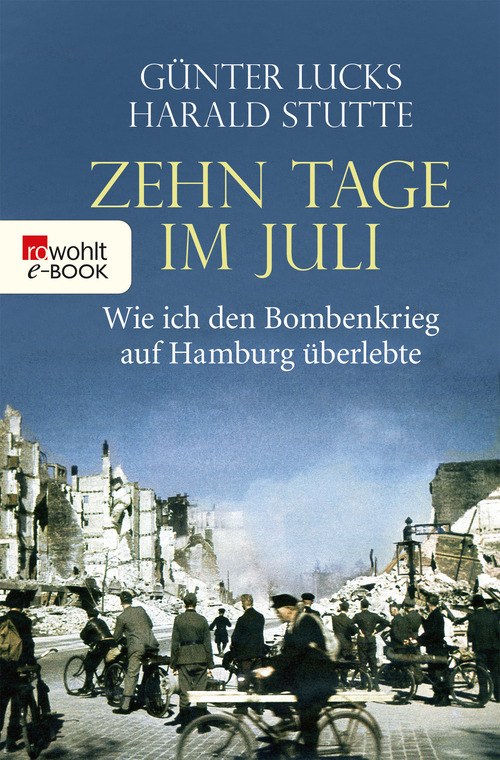
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Frank Strickstrock
Karten Peter Palm
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung ullstein bild - LEONE
Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00365-1
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
ISBN 978-3-644-00365-1
Die Toten sind unter uns Lebenden. In Wahrheit haben sie uns nie verlassen. Wenn ich durch das Gewerbegebiet in Hamburgs Stadtteil Hammerbrook gehe, entlang der Klinkerfassaden von Rothenburgsort oder Hamm, dann sehe ich die Bilder jener Nacht im Juli 1943. Ich sehe die von Tausenden Brandherden in rotes Licht getauchte nächtliche Stadt. Ich spüre die unerträgliche Hitze dieses Orkans, der durch die Straßenschluchten von Hammerbrook faucht. Ich höre sein markerschütterndes Heulen. Es klang, als hämmere da jemand alle Tasten einer Kirchenorgel gleichzeitig, ein Jaulen, das die Schreie der Menschen übertönte. Ich sehe die Menschen, die um ihr Leben durch den Feuersturm laufen, stürzen, liegen bleiben, im brüllend heißen Atem dieser infernalischen Bombennacht auf halbe Körpergröße schrumpfen. Ich sehe Menschen, die in Lachen aus flüssig gewordenem Straßenasphalt rennen, darin stecken bleiben und qualvoll sterben.
Plötzlich ist es wieder da, das Krachen einstürzender Fassaden. Und ich erinnere mich, wie angesichts dieser elementaren Bedrohung unbekannte, auf das nackte Überleben ausgerichtete Instinkte die Regie über mein Ich übernahmen. Wie ich unwillkürlich Dinge tat, ohne zu wissen, warum, die mein Leben gerettet haben. Wie ich zum Beispiel mit aufgerissenem Mund nach Sauerstoff lechzend inhalierte, was an halbwegs kühler Luft nur noch in den Ritzen des Kopfsteinpflasters der Straße zu finden war. Keuchend kroch ich am Boden herum, weil sich erst meine Nase, dann mein Mund dieser unerträglichen heißen Luft verweigerte. Und ich erinnere mich, wie ich zusammen mit einem mir völlig fremden, uralten Mütterlein – vielleicht wirkte die Frau auch nur so alt? –, wie wir beide aneinandergepresst, diesen Menschenfallen aus Flüssigasphalt ausweichend, durch diese brennenden Straßenschluchten taumelten. Eine schier endlos scheinende Zeit für die nicht einmal tausend Meter Wegstrecke benötigten, die unser zerstörtes Wohnhaus vom rettenden, weil glücklicherweise intakt gebliebenen Schulgebäude in der Norderstraße trennten.
Die Toten dieser Nacht – sie sind für immer unter uns Lebenden. Sie besuchen meine Träume, sie sind in meinen Erinnerungen, auf den Fotos, in den Gesprächen, auch in den Büchern, die ich heute schreibe. In Wahrheit ist mein geliebter Bruder nie von mir gegangen. Hermann, 14 Monate älter als ich, ist für alle Ewigkeit 15 Jahre jung geblieben. Er starb in den ersten Stunden des noch jungen 28. Juli, zwei Tage vor seinem 16. Geburtstag. Unser letzter gemeinsamer Moment, festgehalten in meinem Gedächtnis und in einer Endlos-Wiederholung tausend Mal wiedergegeben. Wie in einem Film, in dem ich als Komparse nur eine Nebenrolle spiele, sehe ich, wie mich Hermann vom Dachboden unseres brennenden Hauses über das Treppenhaus in den noch intakten Eingangsbereich im Parterre trägt. Ich hatte kurz zuvor die Besinnung verloren, weil eine brennende Holzwand eingestürzt war und ich mir reflexhaft die «Volksgasmaske» vom Gesicht gerissen hatte. Ich erinnere mich noch genau, wie heiß sich das flüssig gewordene Gummi der Maske an meinem Hals anfühlte, ich rieche die stechend-toxischen Gase des von den Brandbomben entfachten Feuers, das sich längst im Gebälk unseres Dachbodens ausgebreitet hatte. Bis zu dieser Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1943 ist Hermann für mich mein großer Bruder gewesen, der die Rolle unserer abwesenden Eltern übernommen hatte. Zu ihm hatte ich aufgeblickt, ihm vertraute ich, er hatte mich beschützt, wenn mich zum Beispiel größere Jungs bedroht hatten.
Doch in dieser Nacht, die ihn für immer verschlucken sollte, war Hermann in meinen Augen zu einer Art Übermensch geworden, wenn ihm das auch lediglich für die Dauer weniger Stunden vergönnt war. Es ist verrückt: Doch im Angesicht des Untergangs zeigte er sich mir von einer völlig neuen Seite. Von einer unergründlichen Energie getrieben sehe ich ihn bis heute, wie er half, wie er unter dem Eindruck der Katastrophe selbstlos Rettungsmaßnahmen organisierte und in Panik geratene Menschen, viel älter als er und ich, beruhigte und ermutigte.
Wie er mich dann zurückließ, mit dem festen Versprechen, Hilfe zu holen und schnell zurückzukommen. Heute, 76 Jahre später, weiß ich, dass es der Moment meines Lebens war, der mich am deutlichsten geprägt, vermutlich auch traumatisiert hat. Ich war in diesem Moment nicht fähig, ihm zu widersprechen, ihn zu halten, obwohl ich ahnte, dass er im Begriff war, einen schweren Fehler zu begehen. «Du bleibst hier liegen, ich hole Hilfe!» Und dann rannte er hinaus, rannte in diese Nacht, in der der Hamburger Osten einem Meer aus Lava glich. Es war das erste Mal, dass Hermann nicht Wort gehalten hat, nicht Wort halten konnte. Er kam nie zurück. Seine Spur verliert sich in dieser Nacht des Schreckens. Auch mir wurde das beinahe zum Verhängnis, denn ich blieb und wartete eine gefühlte Ewigkeit lang auf ihn, während über mir das Haus brannte.
Ich bin kein Historiker, ich erhebe nicht den Anspruch auf eine exakte, detailgetreue Wiedergabe der Ereignisse vom Juli 1943, jenes Bombeninfernos, das als «Operation Gomorrha» oder «Hamburger Feuersturm» in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Über den Untergang der Hansestadt sind bis heute viele Bücher erschienen, nahezu jedes Detail dieser zehn Tage im Juli 1943 scheint inzwischen aufgearbeitet zu sein.
Dieses Buch soll nicht viel mehr leisten, als unsere Geschichte zu erzählen, die Geschichte von zwei Jungen, die sich in jenen Tagen und Nächten im Zielgebiet der «Operation Gomorrha» aufhielten, des bis dahin schwersten konventionellen Bombardements einer zivilen Stadt, das schätzungsweise 35000 Menschenleben kostete. Das Todesurteil meines Bruders war wohl bereits am 27. Mai 1943 vom Oberbefehlshaber des Bomber Command der Royal Air Force, der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland unterzeichnet worden, so weiß man heute. Vier Wörter waren es, die unter Punkt 4 auf dem streng geheimen Einsatzbefehl Nr. 173 das Vorhaben in kalter Präzision umrissen: «Intention: To destroy Hamburg.» Übersetzt bedeutet das: Absicht: Hamburg zu zerstören.
Das klingt kalt und unmenschlich. Ich glaube aber nicht, dass Arthur Harris ein schlechter Mensch war, gar ein Mörder. Vielmehr tat der «Commander in Chief of Royal Air Force Bomber Command» das, was man damals von ihm erwartete: ein in seiner Existenz bedrohtes Land, nach Frankreichs Kapitulation 1940 das letzte Bollwerk der Alliierten gegen die Nazis, mit allen Mitteln zu verteidigen. Und diesem fanatischen, zu allem entschlossenen Feind einen größtmöglichen Schaden zuzufügen. Hitlers Krieg hatte keine «ethischen Standards», vom ersten Tag an waren alle Regeln außer Kraft gesetzt. Die Alliierten ließen sich darauf ein. Und die Aufgabe von Harris war es, dem Nazi-Reich maximal zu schaden, also seine Städte zu zerstören. Der 15-jährige Hermann Lucks hatte in diesen Überlegungen keinen Platz. Der kalten und zeitlosen Logik von Kriegen folgend.
Damals war Arthur Harris ein im Vereinigten Königreich gefeierter Mann. Schon nach dem Krieg war er es nicht mehr. Ihm wurde ein ehrenhaftes Gedenken verwehrt. Und das ist eine gute Entwicklung, weil sie zeigt, dass eine neue Zeit begonnen hatte. Aus dem Helden Harris wurde im Großbritannien der Nachkriegszeit das «Monster des Bomber Command». Seinen Piloten wurden Orden verweigert, das Land setzte auf eine «Kampagne des Vergessens». Schlimm ist nicht allein die Tatsache, dass es zu allen Zeiten Militärs gab und gibt, die ihr tödliches Handwerk mit solch kalter Perfektion verstehen wie Luftmarschall Sir Arthur Harris. Schlimm ist es, dass es Situationen gibt, in denen die kalte Logik dieser Militärs die Maximen des Handelns diktieren. Und diesen Krieg haben nicht die Briten begonnen.
Es liegt mir fern, die Ereignisse vom Juli 1943 und ihre Vorgeschichte zu bewerten, ich möchte auch nicht anklagen, weder historisch einordnen noch relativieren. Ich möchte unsere Geschichte erzählen, weil wir nur dann aus unserer Vergangenheit lernen können, wenn wir uns ihr stellen. Seit Jahren bin ich ehrenamtlich in der «Hamburger Zeitzeugenbörse» aktiv, besuche außerdem zusammen mit meinem Koautor Harald Stutte Schulen und erzähle von Krieg und Nazi-Zeit. Die Reaktionen der jungen Menschen sind bemerkenswert. Ich spüre eine große Neugier, ein Interesse an meinen Erlebnissen. Da erreichen mich Fragen von Teenagern, denen man auf den ersten Blick nicht zutrauen würde, dass sie sich für Geschichte interessieren. Und das stimmt mich zuversichtlich. Womöglich gehöre ich ja doch der letzten Generation Deutschlands an, die einen Krieg erleiden musste.
Meine Geschichte spielt zwar in Hamburg, doch sie könnte sich auch im spanischen Guernica, im englischen Coventry, im japanischen Hiroshima, im früheren Leningrad, in Vietnam, Afghanistan, in Tschetschenien oder in Syrien zugetragen haben. Oder überall dort, wo gewöhnliche Menschen in die Mühlen des Krieges geraten sind.
Ich fand es bemerkenswert, wie Hamburg nach dem Krieg mit dem erlittenen Leid umgegangen ist. Obwohl Hamburg die höchste Zahl an zivilen Opfern aller deutschen Städte zu beklagen hatte und 53 Prozent seines Wohnraums verloren hat, hat man die Zerstörung von 1943 nach dem Krieg nie politisch instrumentalisiert. Die Stadt gefiel sich nie in der Rolle permanenter Mahnung oder eines Opferkultes. Und das, obwohl die Ruinen von Hammerbrook, Rothenburgsort oder Hamm die vermutlich größten Friedhöfe dieser Stadt ohne Grabsteine waren. Den Nährboden für neuen Hass zumindest bildeten sie nie. Vielleicht ist Hamburgs Umgang mit dem Unrecht auch «hanseatisch» – worunter man ja weitläufig Verlässlichkeit, Anständigkeit, Fairness versteht. Wenn Hamburg bereits vor dem Krieg die vermutlich «britischste Stadt» Deutschlands war, so ist sie es bis heute geblieben, trotz «Gomorrha», das diese enge Bindung zu unserem Nachbarn nicht zu zerstören vermochte.
Es ist nicht allein das typische Schmuddelwetter, das wir Hamburger mit der 700 Kilometer weiter westlich gelegenen britischen Hauptstadt teilen. Ab dem 19. Jahrhundert war es eine Selbstverständlichkeit, dass Hamburger Kaufmannssöhne für einen längeren Zeitraum «rüber» in die englische Welt geschickt wurden. Bei ihrer Rückkehr importierten sie nicht unwesentliche Teile englischer Lebensart in die Heimat – vom «Klubwesen» bis hin zu den «englischen Sportarten» wie Hockey, Rudern, Golf oder Polo. Die Nazis vermochten nicht zu unterbinden, dass die sogenannte Swing-Jugend, die sich auch «Swing Boys» nannte und Benny Goodman und Duke Ellington hörte, während der NS-Zeit von allen Städten des Reiches in Hamburg am aktivsten war, sodass sich die NS-Gauleitung genötigt sah, viel drastischer als in anderen Städten vorzugehen. Viele der jungen Rebellen, die eigentlich nur tanzen wollten, wurden in Konzentrationslager eingewiesen.
Zu den britischen Einflüssen auf Hamburgs Geschichte gehört auch, dass sich der englische Architekt Gilbert Scott im 19. Jahrhundert mit dem Bau der St.-Nikolai-Kirche im Hamburger Stadtbild verewigte. Ebenjener späteren Hauptkirche, deren Turm dann im Juli 1943 zum Orientierungspunkt und zur Zielmarkierung für die britischen und amerikanischen Bomber werden sollte und heute ein Mahnmal ist, gewidmet «den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft zwischen 1933 und 1945». Zu den wohl glücklicheren «britischen Momenten» Hamburgs zählt, dass auf der Reeperbahn mit den Beatles die moderne englische Popmusik geboren wurde.
Der erste Deutschlandbesuch der englischen Königin nach dem Krieg im Mai 1965 endete im Hamburger Hafen – wo auch sonst? Die geradezu entfesselten Hanseaten verabschiedeten Elisabeth II. und Prinz Philip, die auf ihrer königlichen Yacht Britannia die Heimreise antraten. Zu guter Letzt war es ein englischer Fußballer – nämlich Kevin Keegan –, der den Hamburger Sport-Verein 1979 fast im Alleingang zur ersten Bundesliga-Meisterschaft schoss. Es ließen sich noch Dutzende anderer Beispiele finden.
Die Hamburger haben im Krieg Schlimmes erlebt. Sie haben darauf nicht mit Bitterkeit und Trotz reagiert, sondern in der Nachkriegszeit die richtigen Schlüsse gezogen. In der Bundesrepublik wurde Hamburg wieder zu der von Toleranz und Weltläufigkeit geprägten Metropole, die es jahrhundertelang gewesen war. Und das war keine Selbstverständlichkeit. Das Hamburg, das im Juli 1943 innerhalb von zehn Tagen vier Mal von schweren und zwei Mal von kleineren Bombenflotten attackiert und in seiner damaligen Form ausgelöscht wurde, war zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr die Stadt, die mich in meiner Kindheit geprägt hatte. Das rote Hamburg, diese von sozialdemokratisch und kommunistisch gesinnten Arbeitern dominierte Welt im Osten der Hansestadt – dieses Hamburg war bereits lange vor 1943 untergegangen. Diese Welt, in der man stolz darauf war, dass die prominentesten Köpfe der kommunistischen Bewegung des Reiches aus Hamburg kamen oder hier wirkten – Ernst Thälmann, Etkar André oder Fiete Schulze zum Beispiel –, ein Teil davon hatte sich nach 1933 beinahe widerstandslos den braunen Machthabern ergeben. Aus stolzen Proletariern, die Jahr für Jahr am 1. Mai auf die Moorweide gepilgert waren, um sich dort eine Art Schaulaufen zu liefern, ob in der Hansestadt Sozialdemokraten oder Kommunisten mehr Menschenmassen zu mobilisieren vermochten, wurden zum Teil Antisemiten und völkische Nationalisten, die ihre Welt nur noch von jenem Kapitalismus befreien wollten, der angeblich jüdische Wurzeln hatte. Aufmärsche wurden hier jetzt von den Nationalsozialisten organisiert. Und auf derselben Moorweide, gegenüber dem Dammtor-Bahnhof, richteten sie ab 1941 Sammelpunkte ein, von denen aus die Juden der Stadt in die Vernichtungslager im Osten deportiert wurden.
Hamburg war 1943 keine «unschuldige Stadt», so etwas gab es im NS-Staat nicht mehr. Allerdings war Hamburg eine Stadt, in der nicht automatisch jeder Schuld und Verantwortung für die monströsen Verbrechen trug, die im Namen des Nationalsozialismus begangen wurden. Und so gesehen, wurden auch wir Hamburger zu Opfern eines Krieges, den die Führung unseres Landes begonnen hatte.
Wer heute eine «erinnerungspolitische Wende um 180 Grad» fordert oder die Zeit des Nationalsozialismus als «Vogelschiss» in der deutschen Geschichte relativiert, verhöhnt die Opfer der Nazi-Diktatur, die Toten des Zweiten Weltkriegs und auch die im Juli 1943 umgekommenen Hamburger. Hamburgs Untergang im Juli 1943 stellt kein isoliertes Ereignis dar, die Tragödie begann im Januar 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Wer die kausalen Zusammenhänge leugnet, hat die eigene Geschichte nicht verstanden. Oder ignoriert sie. Und «wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen», hat der amerikanische Philosoph George Santayana einst geschrieben. Es wäre schön, wenn dieses Buch einen bescheidenen Beitrag dazu leisten könnte, die Wiederholung solch schrecklicher Ereignisse auszuschließen.
Günter Lucks, Harald Stutte im Januar 2020
«Mein Junge, das gibt Krieg.»
Mein Vater Hermann Friedrich August Lucks,
Kommunist, im Sommer 1939
Als Zehnjähriger geduldig in einem Klassenzimmer zu sitzen, während die Augustsonne den Raum mit Licht flutet, fällt schwer. Das ist heute so wie vor achtzig Jahren. Wir, 32 Jungen, saßen an diesem Sommertag im Jahr 1939 in der Volksschule am Roßberg im Hamburger Stadtteil Eilbek und brüteten über einem Aufsatz. Unser Klassenlehrer, Herr Schwinck, ein Hauptmann der Reserve, war zu einer militärischen Übung eingezogen worden. Es war der letzte Friedenssommer, doch der Krieg warf bereits drohend Schatten voraus. Das öffentliche Leben in Deutschland war weitgehend militarisiert.
Zu unserer großen Freude musste also Otto Lüthje für unseren Klassenlehrer einspringen. Lüthje war der stellvertretende Schulleiter, damals ein Mann in den späten Dreißigern, der noch heute vielen Hamburgern ein Begriff ist. Als Schauspieler und Meister plattdeutscher Mundart gehörte Otto Lüthje an der Seite von Heidi Kabel zum Ensemble des berühmten Ohnsorg-Theaters, welches damals noch «Niederdeutsche Bühne» hieß. In der Nachkriegszeit wurde er deutschlandweit einem großen Publikum bekannt. Wir Schüler mochten ihn, weil er als Lehrer schreiend komisch und stets freundlich war, sich darin von den «ollen Kommissköppen», den ehemaligen Soldaten also, unterschied.
An jenem Sommertag brüteten wir über einem Aufsatz, dessen Thema lautete: «Von der Sütterlin zur deutschen Normalschrift». Wir sollten beschreiben, warum die bis dahin in Büchern gedruckte «altdeutsche Schrift», offiziell hieß sie Fraktur- und gotische Schrift, im neuen deutschen Reich keinen Platz mehr hatte; die Nazis nannten sie auch verächtlich «Schwabacher Judenlettern». Ersetzt wurde sie damals durch die auf dem lateinischen Alphabet basierende Antiqua-Schrift, die noch heute verwendet wird. Die sogenannte «Arisierung» im NS-Staat machte nicht einmal vor der Schrift halt.
Ich saß neben meinem Freund Bruno, das Aufsatzthema interessierte uns nicht, unser Text kam über den ersten Absatz nicht hinaus. Was uns wirklich fesselte, lag auf unseren Knien unter der Schulbank: Wir blätterten in der neusten Ausgabe des «Adler», einer Illustrierten, die unter uns Jungen heiß begehrt war.
Der Titel faszinierte mich. Japanische Soldaten stürmten da einem unsichtbaren Feind entgegen, die Gewehre geschultert. Mit aggressiv verzerrten Gesichtern, die mitgeführte Kriegsflagge mit der roten, aufgehenden Sonne flatterte im Wind, wirbelten sie Staub auf. Daneben stand in japanisch-anmutenden Druckbuchstaben «Japan. Erste Luftmacht in Fernost». «Der Adler», das Heft war im März 1939 erstmals erschienen, war unter uns Jungen schnell sehr populär geworden. Und das lag daran, dass es aufwendig illustriert und bebildert wurde, also sehr modern anmutete. Diese dünnen Heftchen informierten über die neuesten Entwicklungen der Luftkriegstechnik und erzählten Heldengeschichten von Fliegerassen in Reportage-Format. Und der Himmel war damals der Raum, der unsere Phantasie beflügelte. Dort passierten die Dinge, die uns staunen ließen. Gleich zwei Mal waren 1939 die Geschwindigkeitsweltrekorde in der Luft gebrochen worden – natürlich von deutschen Piloten, die in ihren Heinkel- oder Messerschmitt-Maschinen mit weit über 700 km/h durch die Lüfte fegten.
Meine Freunde sammelten die im Zwei-Wochen-Rhythmus erscheinenden Ausgaben. Und ich beneidete sie darum, denn mein Vater verweigerte mir die 15 Pfennige, die jedes Heft kostete. Er hatte bis zur Machtergreifung durch die Nazis zum «kommunistischen Establishment» Hamburgs gehört, war lange Zeit bis zu dessen Verbot aktiv im «Roten Frontkämpferbund» gewesen, dem militanten Arm der Kommunistischen Partei. Nach 1933 hatte er sich in eine Art innere Emigration begeben; er mochte die Nazis nicht, fand sich aber mit dem Unvermeidlichen ab. Der um sich greifenden Militarisierung der deutschen Jugend widersetzte er sich auf seine Weise, indem er mir und meinem 14 Monate älteren Bruder Hermann zum Beispiel keine Nazi-Propaganda-Heftchen kaufte. Und auch gegen die Mitgliedschaft beim Jungvolk und in der Hitlerjugend, den Nachwuchsorganisationen der Nationalsozialisten, sperrte er sich lange. Meine Eltern hatten sich getrennt, als ich fünf Jahre alt war. Seitdem wohnten Hermann und ich bei meinem Vater und seiner neuer Freundin.
Otto Lüthje an seinem Pult war wohl gerade etwas eingenickt, da wurde die mittägliche Ruhe im Deutschunterricht jäh gestört. Ein langgezogener, anhaltender Ton, ein Heulen bis dahin unbekannter Lautstärke flutete über den Roßberg und die umliegenden Straßen Eilbeks. Wir erschraken ob des Lärms. Der «Adler» segelte zu Boden. Wir Jungen guckten uns alle erschrocken an, mit der Ruhe im Klassenraum war es vorbei.
Der Lehrer war der Erste, der sich wieder gefasst hatte. «Beruhigt euch», rief er uns zu, «das ist eine dieser neuen Sirenen, die erprobt werden. Das werdet ihr jetzt öfter hören.»
Wie recht er doch haben sollte. «Für was sind die denn da?», fragte einer der Jungen.
«Es ist doch möglich, dass mal ein großes Feuer ausbricht. Die in der Nähe wohnenden Menschen können sich dann in Sicherheit bringen. Der Ton alarmiert auch die Feuerwehr», fügte Lüthje hinzu und versicherte uns: «Wir nehmen das Thema mal in den kommenden Wochen im Unterricht durch. Und jetzt schreibt weiter an euren Aufsätzen.»
Ich gab ein fast leeres Blatt ab.
In der Pause widmeten Bruno und ich uns wieder dem «Adler». Wir waren Experten im Erkennen der damaligen Kampfflugzeuge. Wir wussten alle technischen Details der neuen «Spaten-He» Heinkel 177, der JU-87 mit ihrem komischen, nicht einfahrbaren «Gamaschen-Fahrwerk» und des Stars der deutschen Luftwaffe, der pfeilschnellen Messerschmitt Me-109. «Der Adler» war für uns das, was für Jugendliche späterer Generationen die «Bravo» war. Wir hatten das Gefühl, dass es unsere Zeitschrift war, die gesammelt wurde und die Themen setzte, über die wir dann sprachen. Nur dass es eben, anders als in der «Bravo», nicht um Fragen der Pubertät oder um Musiktrends ging, sondern um Krieg. «Jungszeug» eben, was damals nicht ungewöhnlich war. Die im «Adler» geschilderten Augenzeugenberichte der Spanien- oder Eritrea-Kämpfer bildeten den Kontrast zu unserem Alltag in einer deutschen Großstadt. Und was sich am Boden oder auf dem Wasser abspielte, war längst zu langweilig geworden. Der technische Fortschritt am Himmel beflügelte unser Denken, unsere Phantasie. Da mochte sich mein Vater noch so mühen, das perfide System der Militarisierung der Jugend hatte mich längst infiziert.
«Papa, was ist eigentlich eine Risene?», fragte ich am Abend zu Hause.
«Eine was …?», fragte mein Vater zurück.
«Eine Risite», nahm ich einen neuen Anlauf, «so ein Ding, das so einen Lärm macht.»
Endlich begriff er, was ich meinte: «Ach, eine Sirene … Du musst mal in der Schule besser zuhören», sagte er.
Dann nahm er mich mit auf den Dachboden. Wir wohnten gegenüber unserer Schule, daneben war eine Kartonagenfabrik. Sirenen gab es natürlich schon längere Zeit in der Stadt, nur eben nicht in Eilbek.
Auf dem Dach der benachbarten Fabrik war das neuartige Ding erst vor kurzem installiert worden. Und weil es im Sommer länger hell ist, konnte man es auch noch deutlich erkennen. Es glich einem großen Pilz aus Metall. Als militärisch gut informierter Junge hatte ich aber eine andere Assoziation: «Das sieht ja aus wie der Stahlhelm eines englischen Soldaten auf einem Rohr», meinte ich belustigt. Mein Vater lachte. Doch er schien sich auch Sorgen zu machen. Er glaubte nicht, dass diese Sirenen nur für den Brandschutz installiert wurden. Wie viele Menschen ahnte er damals, dass etwas «in der Luft» lag – sprichwörtlich. Etwas, das mittelbar auch mit diesem «Stahlhelm auf Rohr», mit der Militarisierung der Gesellschaft zu tun hatte. «Mein Junge, das gibt Krieg», sagte er später, als wir wieder in der Küche saßen, sehr nachdenklich zu mir. «Hoffentlich fallen dann hier keine Bomben.»
Mein Bruder Hermann und ich – wir waren so etwas wie die menschliche Konkursmasse der gescheiterten Beziehung zweier Jungkommunisten, die einst die Welt verändern wollten. Aus heutiger Sicht weiß ich: Mein Vater Hermann Friedrich August Lucks, Jahrgang 1908, und meine gleichaltrige Mutter hatten viel zu früh geheiratet. Als meine Mutter schwanger wurde und sich beide zur Ehe entschlossen, waren sie Teenager. Sie träumten von der Revolution, von einer besseren Welt und waren weder willens noch fähig, sich bürgerlichen Dogmen wie Ehe und Familie zu unterwerfen. Kaum 20 Jahre jung, wurden sie Eltern. Diese Ehe scheiterte, als ich vier Jahre alt war, sie hat nicht einmal sieben Jahre lang gehalten. Für meine Eltern und für uns war es eine rabenschwarze Zeit. Die lange Arbeitslosigkeit meines Vaters, die politischen Aktivitäten in der Kommunistischen Partei, dann die ständig schwelende Drohung, von den NS-Machthabern eingesperrt zu werden – all das zerrte an ihren Nerven. Sie stritten sich ständig, wir Kinder litten darunter.
Meine Mutter Louise war eine schöne, auch etwas eitle, in jedem Fall aber emanzipierte und selbstbestimmte Frau. Im kommunistischen Milieu des Hamburger Ostens, das ich in meinem Buch «Der rote Hitlerjunge» detailliert schildere, war sie sogar eine lokale Prominente, bekannt als das «rote Lieschen». Was sich sowohl auf ihre roten Haare als auch auf ihre politische Überzeugung bezog. Ihre kommunistischen Ideale lebte sie selbstbewusst aus. Und dazu gehörte es eben auch, einen Mann zu verlassen, wenn man das Gefühl hatte, dass die Liebe zu ihm längst erloschen war.
Und so war sie 1934 zu ihrer neuen Liebe gezogen. Zu einem Genossen, der ausgerechnet ein Mitkämpfer meines Vaters aus dem zu diesem Zeitpunkt schon lange verbotenen Rotfrontkämpferbund war, dem paramilitärischen Arm der ebenfalls verbotenen Kommunistischen Partei. Helmut Kruschak hieß ihr «Neuer», den sie kurze Zeit später heiratete. Helmut genoss im roten Osten der Hansestadt eine Art Heldenstatus. Sein Markenzeichen war ein goldener Schneidezahn, der seinem Gesicht ein Alleinstellungsmerkmal gab. Der Goldzahn hatte sogar eine Geschichte, die natürlich etwas mit der damals allgegenwärtigen Gewalt der Straße, mit «Klassenkampf» zu tun hatte, wie man damals stolz erzählte. Während der zahllosen politischen Straßenkämpfe in den 20er Jahren hatte Helmut den Schlagstock eines Polizisten zu «schmecken bekommen», war also verdroschen worden. Sein Schneidezahn war abgebrochen. Für Jahre war da, sobald er den Mund öffnete, eine klaffende Lücke zu sehen. Den Besuch beim Zahnarzt konnte sich der Dauerarbeitslose nicht leisten. Diese «Investition» holte er aber nach, als er bei den Hamburger Klöckner-Motorenwerken Arbeit fand. Als Facharbeiter in Festanstellung gönnte er sich dann den Goldzahn, der zumindest meiner Mutter imponiert zu haben schien. Helmut war ein ehrlicher, freundlicher und obendrein kluger Mann. Weil meine Mutter als «Ehebrecherin» vom Familiengericht «schuldig» geschieden worden war, wurde ihr das Sorgerecht für uns verweigert. Hermann und ich lebten fortan bei meinem Vater, hielten aber stets Kontakt zu unserer Mutter.
Das familiäre Chaos, unter dem wir Kinder damals sehr litten, machte ich meiner Mutter aber nie zum Vorwurf. Ich war ein Kind des Hamburger Ostens. Und das ist mehr als eine geographische Ortsbestimmung. Der «rote Osten» Hamburgs stand bis tief in die 30er Jahre hinein für das bedeutendste und größte zusammenhängende, von den Arbeiterparteien SPD und KPD geprägte Proletariermilieu des Deutschen Reiches.
Mein Vater war mit seinen 1,68 Meter ein kleiner, dafür aber untersetzter und kräftiger Mann. Er hatte lediglich die Volksschule besucht und war schon früh im Jungsturm der KPD politisch aktiv gewesen. Im Alter von nur 15 Jahren gehörte er während des legendären Hamburger Aufstandes, der 1923 mindestens 100 Todesopfer forderte, als Fahrradkurier in Barmbek zum Stab der KPD-Legende Philipp Dengel, der für Verpflegung und Munition zuständig war. Das kommunistische, proletarische Umfeld prägte unsere Persönlichkeitsentwicklung und beherrschte unser Leben: Während andere Kinder zu Hause Kinder- oder Volkslieder lernten, sangen wir das «Lied vom kleinen Trompeter», «Dem Morgenrot entgegen» oder «Die Internationale».
Und während andere Eltern ihren Kindern so etwas wie Heimatliebe und Nationalstolz vermittelten, schwenkten wir zu jeder Gelegenheit kleine rote Fähnchen mit Hammer und Sichel. Zum Beispiel, wenn wir mit unseren Eltern zu den Aufmärschen der Kommunisten am 1. Mai auf der Hamburger Moorweide spaziert waren, was aber mit der Machtübernahme durch die Nazis endete. Quasi mit der Muttermilch nahmen wir die kommunistischen Grundüberzeugungen auf: dass der «Klassenkampf» zwischen Arbeitern und Kapitalisten der gesellschaftliche Motor sei, dass man die «Ausbeutung» der Arbeiter durch die Fabrikbesitzer überwinden müsse, dass es alsbald gesetzmäßig zu einer «Revolution» komme und das Ziel des Kampfes unserer Leute das Entstehen einer kommunistischen Gesellschaft sei. Und dass es ein Land auf der Welt gebe, wo das bereits Realität sei: die Sowjetunion, das Arbeiterparadies.
Unsere Eltern verehrten keinen Gott, doch gab es gottgleiche Überväter, die hießen Karl Marx, Friedrich Engels und Wladimir Iljitsch Uljanow, auch Lenin genannt. Ihre Enzykliken bekamen unsere Eltern nicht vom Heiligen Vater, aber von den Vorsitzenden der maßgeblichen Kommunistischen Parteien – von Ernst Thälmann in Deutschland und Josef Stalin in der Sowjetunion. Der Moskauer Kreml, das Machtzentrum des damals einzigen sozialistischen Landes der Erde, war für sie ungefähr dasselbe wie der Vatikan für die Katholiken. Letztlich waren meine Eltern von ihrer politischen Mission nicht nur überzeugt – sie waren Gläubige, ohne religiös zu sein. Und wir Kinder waren auch in diesem Geist aufgewachsen.
Zuerst hatten wir drei, Vater und wir beiden Jungen, im proletarisch geprägten Stadtteil St. Georg gewohnt, dann waren wir 1934 in eine Zweieinhalbzimmerwohnung in die Papenstraße im Stadtteil Eilbek gezogen. Für meinen Vater, der nach langer Zeit der Arbeitslosigkeit endlich wieder eine Anstellung gefunden hatte, war die Miete von 28 Mark monatlich in dieser eher bürgerlichen Gegend enorm hoch, wir mussten sie uns sprichwörtlich «abhungern». Hier zog alsbald die neue Frau meines Vaters ein, unsere Stiefmutter: Lizzy von Goedelt, drei Jahre jünger als Vater und aus einer wohlhabenden hanseatischen Familie stammend.