




Für Leigh Bardugo,
die mir nichts, aber auch gar nichts durchgehen lässt
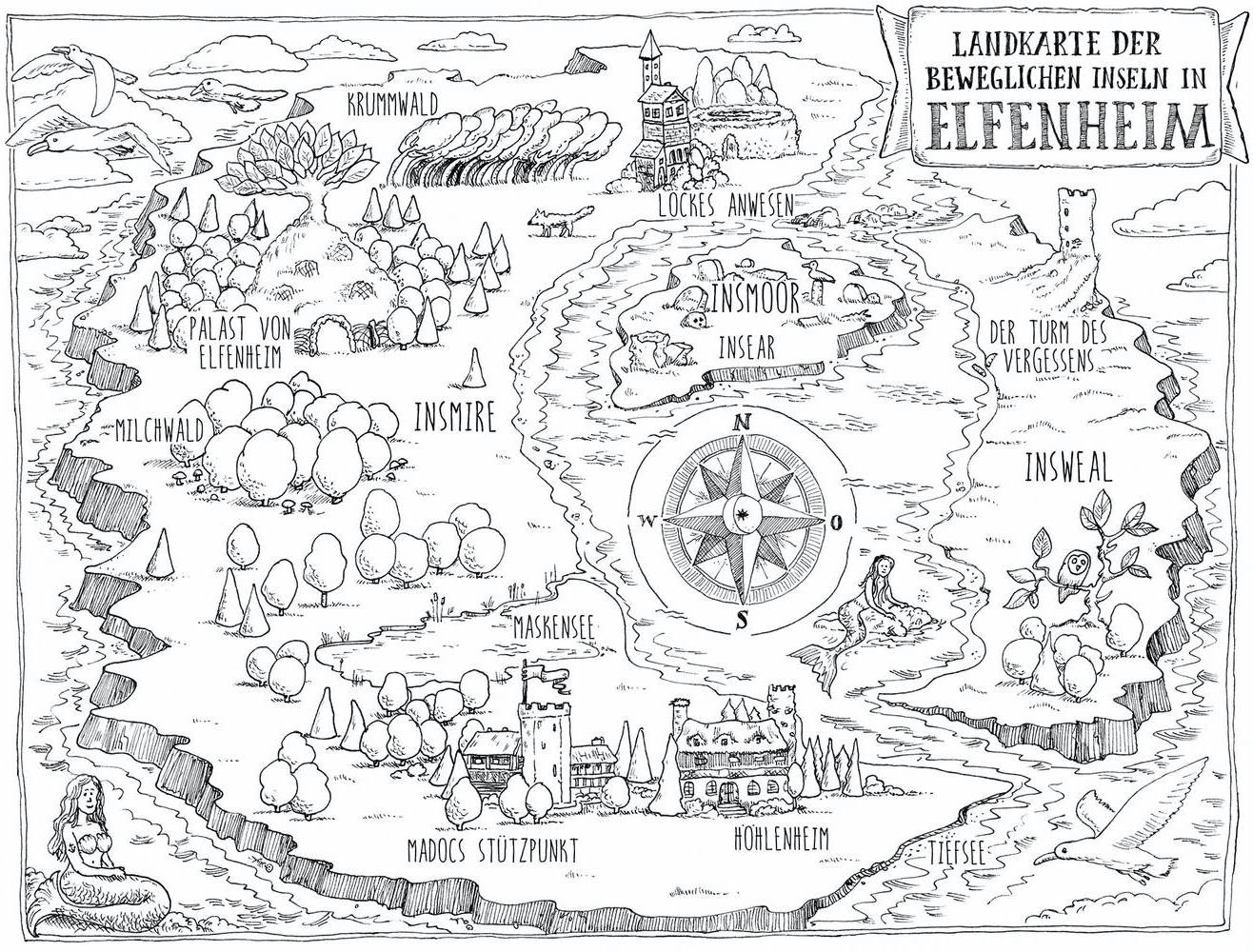

Und der Elfenkönig gelobte feierlich die Hochzeit
Mit einer Tochter der Erde, deren eigenes Kind sei
Durch das Kreuz und das Wasser geweiht
Vom Unheil der Elfen in Ewigkeit frei.
Und wenn einst ein Schicksalstag anbricht?
Er kommt noch lange nicht! Noch lange nicht!
– Edmund Clarence Stedman, »Elfin Song«
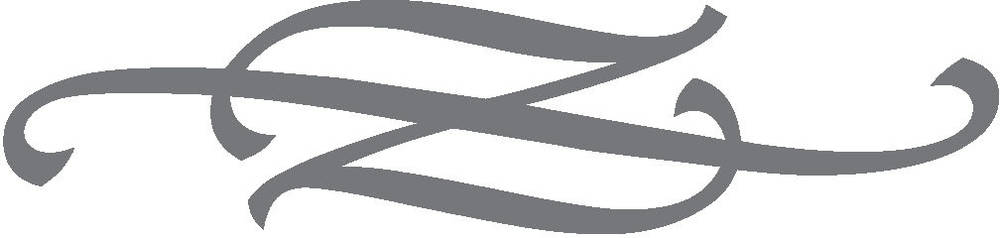
Der königliche Sterndeuter Baphen betrachtete mit zusammengekniffenen Augen die Himmelskarte und zwang sich, nicht zusammenzuzucken. Es sah ganz danach aus, als würde der jüngste Prinz von Elfenheim bald zu heiß gebadet werden.
Eine Woche war seit Prinz Cardans Geburt vergangen und nun wurde er endlich dem Hochkönig vorgestellt. Die vorherigen fünf Erben waren ihm jeweils unmittelbar, quäkend in rötlicher Frische präsentiert worden, doch Lady Asha hatte einen Besuch des Hochkönigs abgelehnt, bis sie sich vom Kindbett erholt hatte.
Das Baby war dünn und runzlig und fixierte Eldred stumm mit seinen schwarzen Augen. Der Junge schlug so kraftvoll mit seinem kleinen Schweif, der an eine Peitsche gemahnte, dass er beinahe sein Wickeltuch löste. Lady Asha hatte offensichtlich keine Erfahrung im Umgang mit Babys und hielt ihn so, als hoffte sie, dass ihr jemand diese Bürde möglichst bald wieder abnahm.
»Sag seine Zukunft voraus«, befahl der Hochkönig. Nur wenige Angehörige des Kleinen Volkes waren bei der Vorstellung des jüngsten Prinzen zugegen – der Sterbliche Val Moren, der als Hofdichter und Seneschall diente, und zwei Mitglieder des Lebendigen Rates: Randalin, der Minister der Schlüsselgewalt, und Baphen selbst. Die Worte des Hochkönigs hallten in dem leeren Saal wider.
Baphen zögerte, obwohl ihm die Antwort nicht erspart bleiben würde. Eldred war vor Prinz Cardan bereits mit fünf Kindern gesegnet worden, schockierend fruchtbar für jemanden aus dem Kleinen Volk mit seinem dünnen Blut und einer niedrigen Geburtenrate. Die Sterne hatten bei jedem kleinen Prinzen und jeder kleinen Prinzessin ein Lied ihrer Erfolge im Dichten und Singen, in der Politik, der Tugendhaftigkeit und sogar im Laster gesungen. Doch diesmal hatte er etwas vollkommen anderes in den Sternen gesehen. »Prinz Cardan wird Euer Letztgeborener sein«, antwortete der königliche Sterndeuter. »Er wird die Krone zerstören und den Thron in den Untergang führen.«
Lady Asha holte scharf Luft und drückte das Baby zum ersten Mal schützend an ihre Brust. Es wand sich in ihren Armen. »Ich frage mich, wer deine Deutung der Zeichen beeinflusst hat. Vielleicht hatte Prinzessin Elowyn ihre Finger im Spiel. Oder Prinz Dain.«
Vielleicht wäre es besser, wenn sie ihn fallen ließe, dachte Baphen unfein.
Hochkönig Eldred strich über sein Kinn. »Kann man nichts dagegen unternehmen?«
Es war Segen und Fluch zugleich, dass die Sterne Baphen so viele Rätsel aufgaben und so wenige Fragen beantworteten. Häufig wünschte er, die Geschehnisse schärfer und deutlicher zu erkennen, doch diesmal nicht. Er neigte den Kopf, um dem Hochkönig nicht in die Augen sehen zu müssen. »Ein großer Herrscher kann nur aus dem vergossenen Blut des Prinzen an die Macht kommen, aber erst, wenn das erfolgt ist, was ich eben vorhergesagt habe.«
Eldred wandte sich an Lady Asha und ihr Kind, die Herolde seines Unglücks. Das Baby war totenstill, weder schrie noch gluckste es. Nur der Schweif peitschte durch die Luft.
»Bring den Jungen fort«, sagte der Hochkönig. »Ziehe ihn nach deinem Belieben groß.«
Lady Asha wich nicht von der Stelle. »Ich werde ihn so erziehen, wie es seinem Stand gebührt. Schließlich ist er ein Prinz und Euer Sohn.«
Ihr Tonfall war spröde und erinnerte Baphen auf unangenehme Weise daran, dass einige Prophezeiungen aufgrund ebenjener Taten in Erfüllung gingen, die sie verhindern sollten.
Einen Augenblick lang sagte niemand etwas. Dann nickte Eldred Val Moren zu, der vom Podest ging und mit einer schmalen Holzschachtel zurückkehrte. Ein Wurzelmuster war in den Deckel eingraviert.
»Ein Geschenk«, sagte der Hochkönig. »Als Anerkennung für deinen Beitrag zur Linie der Stechwinde.«
Als Val Moren den Deckel anhob, kam eine prachtvolle Halskette aus schweren Smaragden zum Vorschein. Eldred legte sie um Lady Ashas Hals und strich mit dem Handrücken über ihre Wange.
»Ihr seid sehr großzügig, Mylord«, sagte sie ein wenig besänftigt. Das Baby umklammerte einen Edelstein mit seiner kleinen Faust und sah mit seinen unergründlichen Augen zu seinem Vater hoch.
»Geh nun und ruh dich aus«, sagte Eldred freundlicher. Diesmal gab sie nach.
Als Lady Asha mit hocherhobenem Kopf fortging, hielt sie das Kind fest an sich gedrückt. Baphen erschauerte unter einer Vorahnung, die nichts mit den Sternen zu tun hatte.
Hochkönig Eldred besuchte Lady Asha nie mehr und ließ sie auch nicht mehr zu sich rufen. Vielleicht hätte er seinen Unmut zurückstellen und sich seines Sohnes annehmen sollen. Doch da ein Blick auf Prinz Cardan die Aussicht in eine getrübte Zukunft eröffnete, verzichtete er darauf.
Als Mutter des Prinzen war Lady Asha wenn schon nicht beim Hochkönig, so doch bei Hofe sehr gern gesehen. Da sie zu Oberflächlichkeit und Albernheiten neigte, wollte sie das muntere Leben einer Hofdame rasch wieder aufnehmen. Mit einem Kleinkind im Schlepptau war dies unmöglich, und so fand sie eine Katze, die nach einer Fehlgeburt seine Amme wurde.
Diese Regelung galt, bis Prinz Cardan anfing zu krabbeln. Zu diesem Zeitpunkt war die Katze bereits wieder trächtig. Da er sich angewöhnt hatte, sie am Schwanz zu ziehen, flüchtete sie in die Ställe und verließ ihn ebenfalls.
Auf diese Weise wuchs er im Palast auf, von niemandem gekost oder in Schach gehalten. Wer würde es wagen, einem Prinzen zu verbieten, Speisen von den prächtig gedeckten Tischen zu stehlen und seine Beute herunterzuschlingen? Seine Brüder und Schwestern lachten nur und spielten mit ihm wie mit einem Hündchen.
Nur selten war er angezogen und gewandete sich stattdessen in Blumengirlanden. Wenn ihm ein Wachposten zu nah kam, warf er mit Steinen, und außer seiner Mutter, die seinen Ausschweifungen nur selten Einhalt gebot – eher im Gegenteil –, hatte ihm niemand etwas zu sagen.
»Du bist ein Prinz«, betonte sie, wenn er vor einem Konflikt zurückscheute oder seine Wünsche nicht durchsetzen konnte. »Dir gehört alles, du musst es dir nur nehmen.« Oder auch: »Das will ich haben. Hol es mir.«
Kinder des Kleinen Volkes sind angeblich nicht wie sterbliche Kinder. Sie brauchen nicht viel Liebe und müssen abends nicht ins Bett gebracht werden, weil sie genauso gut in einer kalten Ecke des Ballsaals oder in eine Tischdecke gewickelt schlafen. Man muss sie auch nicht füttern, da sie fröhlich den Tau aufschlecken und Brot und Sahne aus der Küche klauen. Sie weinen nur selten und müssen nicht getröstet werden.
Doch selbst wenn Elfenkinder wenig Liebe benötigen, sollten Elfenprinzen guten Rat nicht entbehren.
Ohne derlei Erziehung hatte Cardan keine Bedenken gegen den Vorschlag seines älteren Bruders, einem Sterblichen eine Walnuss vom Kopf zu schießen. Sein Benehmen war sprunghaft, sein Gebaren herrisch.
»Treffsicherheit beeindruckt unseren Vater sehr«, sagte Prinz Dain mit einem verhaltenen, neckenden Lächeln. »Aber vielleicht ist es zu schwierig. Tu’s besser nicht, dann kannst du nicht versagen.«
Für Cardan, dem sein Vater nicht die wohlwollende Aufmerksamkeit entgegenbrachte, die er so leidenschaftlich ersehnte, war die Verlockung groß. Er überlegte nicht, wer der Sterbliche war oder wie er an den Hof gelangt war. Cardan wäre nie darauf gekommen, dass Val Moren diesen Mann liebte oder dass der Seneschall vor Trauer wahnsinnig werden würde, falls er starb.
Woraufhin Dain eine höhere Stellung bei Hofe als rechte Hand des Hochkönigs einnehmen konnte.
»Zu schwierig? Ich soll es lieber gar nicht erst versuchen? So spricht ein Feigling«, entgegnete Cardan in kindlichem Draufgängertum. In Wirklichkeit fühlte er sich von seinem Bruder eingeschüchtert, doch das stachelte ihn nur noch weiter an.
Prinz Dain lächelte. »Dann wollen wir wenigstens die Pfeile tauschen. Wenn du danebenschießt, kannst du sagen, dass mein Pfeil das Ziel verfehlt hat.«
Prinz Cardan hätte diesem liebenswürdigen Angebot misstrauen sollen, doch da ihm wahre Freundlichkeit nur selten begegnet war, konnte er das Richtige nicht vom Falschen unterscheiden.
Stattdessen legte er Dains Pfeil an, spannte die Sehne seines Bogens und nahm die Walnuss aufs Korn. Dann wurde ihm bang ums Herz. Und wenn er nun nicht traf? Möglicherweise würde er den Mann treffen. Andererseits beflügelte ihn eine wütende Schadenfreude bei der Vorstellung, etwas so Abscheuliches zu tun, dass sein Vater ihn nicht länger mit Nichtachtung strafen konnte. Wenn er die Aufmerksamkeit des Hochkönigs nicht im Guten errang, dann vielleicht, indem er richtig, richtig böse war.
Cardans Hand bebte.
Der Sterbliche beobachtete ihn mit feuchten Augen und starr vor Angst. Natürlich war er verzaubert. Niemand würde sich freiwillig dort hinstellen. Und damit stand Cardans Entschluss fest.
Cardan lachte gekünstelt, nahm die Spannung von der Bogensehne und ließ den Pfeil fallen. »Unter diesen Bedingungen schieße ich einfach nicht«, sagte er und kam sich lächerlich vor, weil er einen Rückzieher gemacht hatte. »Der Wind kommt von Norden und zerzaust mein Haar. Es fällt mir ständig in die Augen.«
Doch Prinz Dain hob den Bogen und schoss den Pfeil ab, den Cardan mit ihm getauscht hatte. Er traf den Sterblichen in den Hals. Der Mann fiel beinahe geräuschlos zu Boden, mit geöffneten Augen, die nun ins Leere blickten.
Es geschah so schnell, dass Cardan nicht aufschrie oder überhaupt reagierte. Er sah nur seinen Bruder an, während allmählich die schreckliche Erkenntnis über ihn hereinbrach.
»Ah«, sagte Prinz Dain mit einem zufriedenen Lächeln. »So etwas Dummes, anscheinend hat dein Pfeil das Ziel verfehlt. Vielleicht kannst du dich bei unserem Vater beschweren, dass dir die Haare ins Gesicht gefallen sind.«
Trotz seiner Proteste wollte anschließend niemand hören, was Prinz Cardan zu sagen hatte. Dafür sorgte Dain. Er verbreitete die Geschichte von der Torheit des jüngsten Prinzen, von seiner Arroganz und seinem Pfeil. Der Hochkönig gewährte Cardan nicht einmal eine Audienz.
Obwohl Val Moren flehend bat, ihn hinzurichten, wurde Cardan für den Tod des Sterblichen auf die Weise bestraft, wie Prinzen eben bestraft wurden. Der Hochkönig ließ Lady Asha an Cardans Stelle in den Turm des Vergessens sperren – und Eldred war froh über diesen Anlass, da er sie sowohl ermüdend als auch lästig fand. Die Sorge für Prinz Cardan wurde Balekin übertragen, dem Ältesten unter den Geschwistern und dem Grausamsten, der zudem als Einziger willens war, ihn bei sich aufzunehmen.
So entstand Prinz Cardans schlechter Ruf. Er musste ihn nur weiter befördern.
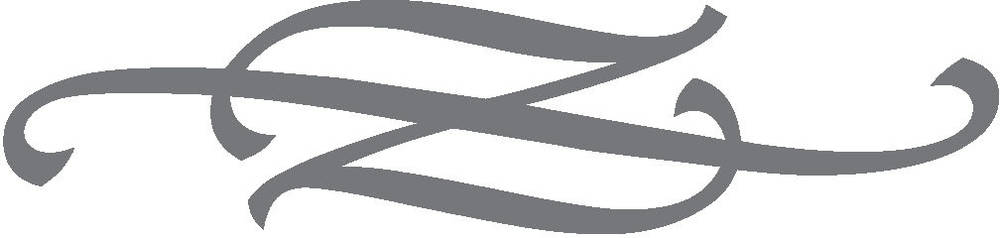
Ich, Jude Duarte, die im Exil lebende Hochkönigin von Elfenheim, verbringe den Morgen meist dösend vor dem Fernseher und schaue mir Kochwettbewerbe, Zeichentrickfilme und Wiederholungen einer Show an, in denen die Konkurrenten auf Kisten und Flaschen einstechen und einen Fisch im Ganzen aufspießen müssen. Nachmittags trainiere ich mit meinem Bruder Oak, wenn er denn mitmacht. Nachts erledige ich Aufträge für das Kleine Volk, das hier lebt.
Ich halte mich bedeckt, was ich vermutlich schon viel eher hätte tun sollen. Und wenn ich Cardan verfluche, muss ich mich selbst ebenfalls verfluchen, weil ich so dumm war, in seine Falle zu tappen.
Als Kind habe ich mir oft vorgestellt, in die Welt der Sterblichen zurückzukehren. Taryn, Vivi und ich riefen uns immer wieder ins Gedächtnis, wie es dort war, beschworen die Gerüche von frisch gemähtem Rasen und Benzin herauf und schwelgten in Erinnerungen, wie wir in den Gärten unseres Viertels Fangen gespielt haben und im Sommer in die gechlorten Swimmingpools sprangen. Ich träumte von Eistee aus Konzentrat und Eis am Stiel aus gefrorenem Orangensaft. Es waren die alltäglichen Dinge, nach denen ich mich sehnte: dem Geruch von heißem Asphalt, den schaukelnden Drähten zwischen Straßenlaternen oder lärmenden Werbesongs.
Jetzt, da ich auf Dauer in der Welt der Sterblichen festsitze, vermisse ich das Elfenreich mit einer schmerzhaften Intensität. Ich sehne mich nach Magie, nichts vermisse ich mehr. Möglicherweise vermisse ich sogar meine Ängste. Es fühlt sich an, als würde ich meine Tage verträumen, ruhelos, ohne jemals richtig wach zu werden.
Ich tippe mit den Fingerspitzen auf das lackierte Holz eines Picknicktisches. Im Frühherbst ist es in Maine bereits kalt. Jetzt, am späten Nachmittag, sprenkelt die Sonne den Rasen vor der Apartmentanlage, während ich Oak im Auge behalte. Er spielt mit Kindern aus der Nachbarschaft in dem Wäldchen zwischen der Anlage und dem Highway. Jüngere und ältere als er mit seinen acht Jahren und alle werden von demselben gelben Schulbus abgesetzt. Sie spielen ein vollkommen chaotisches Kriegsspiel und verfolgen einander mit Stöcken. Sie schlagen zu wie Kinder, zielen auf die Waffe statt auf den Gegner und kreischen vor Lachen, wenn ein Stock zerbricht. Auf diese Weise lernen sie nur Falsches über die Kunst des Schwertkampfs.
Dennoch schaue ich ihnen zu. Und deshalb merke ich es, als Oak seine Zauberkunst einsetzt.
Ich glaube, es geschieht unbewusst. Er schleicht sich an die anderen Kinder an, aber plötzlich gibt es keine gute Deckung mehr. Er geht trotzdem weiter, aber sie bemerken ihn nicht, obwohl er für alle sichtbar ist.
Immer näher und näher, während die Kinder weiterhin nicht in seine Richtung blicken. Und als er sich auf sie stürzt und seinen Stock schwingt, schreien sie glaubhaft überrascht auf.
Er war unsichtbar. Er hat sich verzaubert. Und ich, die ich durch das Fluchgelübde gegen diese Art von Täuschung gefeit bin, habe es erst gemerkt, als es fast vorbei war. Die anderen Kinder halten ihn für schlau oder meinen, er hätte Glück gehabt. Nur ich weiß, wie leichtsinnig das war.
Ich warte, bis die anderen Kinder nach Hause gehen. Einer nach dem anderen trödelt davon, bis nur noch mein Bruder übrig ist. Obwohl das welke Laub am Boden liegt, brauche ich keine Magie, um mich anzuschleichen. Mit einer schnellen Bewegung lege ich meinen Arm um Oaks Hals und drücke ihn fest genug gegen seine Kehle, um ihm Angst einzujagen. Er versucht, mich abzuwerfen, und hätte mich beinahe mit einem seiner Hörner am Kinn getroffen. Nicht schlecht. Er will sich befreien, aber nur mit halber Kraft. Oak weiß, dass ich es bin, und vor mir hat er keine Angst.
Ich verstärke den Griff. Wenn ich den Arm lange genug gegen seinen Hals drücke, wird er ohnmächtig.
Als er etwas sagen will, spürt er offenbar, dass er nicht genug Luft bekommt. Er vergisst sein Training und dreht durch, schlägt um sich, zerkratzt meine Arme und tritt gegen meine Schienbeine. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich wollte, dass er sich ein wenig fürchtet und dagegenhält, aber nicht, dass er zu Tode erschrickt.
Nachdem ich ihn losgelassen habe, taumelt er keuchend nach vorn, mit Tränen in den Augen. »Warum hast du das getan?«, will er wissen und sieht mich böse an.
»Um dich zu ermahnen, dass Kämpfen kein Spiel ist«, erkläre ich, als würde ich mit Madocs statt mit meiner eigenen Stimme sprechen. Ich möchte nicht, dass Oak so aufwächst wie ich, wütend und ängstlich. Überleben soll er aber schon, und Madoc hat mir beigebracht, wie das geht.
Wie soll ich herausfinden, was er genau braucht, wenn ich nur meine eigene beschissene Kindheit als Maßstab habe? Vielleicht weiß ich nur die falschen Dinge aus dieser Zeit zu schätzen. »Was würdest du gegen einen Angreifer unternehmen, der dir wirklich wehtun will?«
»Ist mir egal«, sagt Oak. »Das interessiert mich alles nicht. Ich will nicht König werden. Ich will niemals König werden.«
Einen Augenblick lang sehe ich ihn nur an. Es wäre schön, wenn er lügen würde, aber das kann er natürlich nicht.
»Wir können uns unser Schicksal nicht immer aussuchen«, sage ich.
»Regiere du doch, wenn du es so toll findest!«, sagt er. »Ich mach’s nicht. Niemals.«
Ich muss die Zähne zusammenbeißen, weil ich sonst geschrien hätte. »Das geht nicht, wenn ich dich erinnern darf. Ich wurde verbannt«, ermahne ich ihn.
Er stampft mit einem Huf auf. »Ich auch! Und ich bin nur in der Menschenwelt, weil Dad seine blöde Krone haben will, und du auch und überhaupt alle. Ich aber nicht. Sie ist verflucht.«
»Alle Macht ist verflucht«, erwidere ich. »Die Grausamsten unter uns werden alles dafür tun, sie zu erlangen, und diejenigen, die mit Macht am besten umgehen können, wollen sie nicht ausüben. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich für immer vor der Verantwortung drücken können.«
»Du kannst mich nicht zwingen, Hochkönig zu werden«, sagt Oak, dreht sich um und läuft zur Apartmentanlage.
In dem Bewusstsein, dass ich dieses Gespräch total vermasselt habe, setze ich mich auf die kalte Erde. In dem Bewusstsein, dass Madoc Taryn und mich besser vorbereitet hat als ich Oak. In dem Bewusstsein, dass ich arrogant und dumm gewesen war, als ich dachte, ich könnte Kontrolle über Cardan ausüben.
In dem Bewusstsein, dass ich in dem großen Spiel der Prinzen und Königinnen vom Spielbrett gefegt wurde.

In der Wohnung ist Oaks Tür geschlossen, Betreten verboten. Meine Schwester Vivienne aus dem Kleinen Volk steht an der Küchenarbeitsplatte und grinst in ihr Handy.
Als sie mich sieht, nimmt sie meine Hände und tanzt mit mir im Kreis, bis mir schwindelig wird.
»Heather liebt mich wieder«, sagt sie mit einem wilden Lachen in der Stimme.
Heather war Vivis menschliche Freundin. Sie hatte sich mit Vivis ausweichenden Antworten bezüglich ihrer Vergangenheit abgefunden. Sie hatte sich sogar damit abgefunden, dass Oak später mit ihnen in dieser Wohnung zusammengelebt hat. Doch als sie herausfand, dass Vivi kein Mensch war und sie darüber hinaus verzaubert hatte, machte sie Schluss und zog aus. Es tut mir leid, das zu sagen, weil mir das Glück meiner Schwester am Herzen liegt – und Heather sie glücklich gemacht hat –, aber diese Trennung war so was von verdient.
Ich löse mich von Vivi und blinzele verwirrt. »Was?«
Vivi wedelt mit dem Handy. »Sie hat mir geschrieben. Sie will zurückkommen. Alles wird wieder wie vorher.«
Laub wächst nicht wieder an Ranken, geknackte Walnüsse passen nicht wieder in ihre Schalen, und Freundinnen, die verzaubert wurden, wachen nicht plötzlich auf und beschließen, ihren grausigen Ex-Freundinnen alles durchgehen zu lassen.
»Zeig mal«, sage ich und strecke die Hand nach Vivis Handy aus. Sie gibt es mir.
Ich scrolle durch die Nachrichten, größtenteils von Vivi gesendet und voll mit Entschuldigungen, unüberlegten Versprechen und immer verzweifelteren Bitten. Von Heather kam hauptsächlich Schweigen und ein paar Nachrichten mit dem Inhalt »Ich brauche mehr Zeit zum Nachdenken«.
Und dann das:
Ich will das Elfenreich vergessen. Ich will vergessen, dass du und Oak keine Menschen seid. Ich will mich nicht mehr so fühlen wie jetzt. Wenn ich dich bitte, mich vergessen zu lassen, würdest du es tun?
Ich fixiere lange die Worte und halte den Atem an.
Obwohl ich nachvollziehen kann, wie Vivi die Nachricht verstanden hat, glaube ich nicht, dass Heather es so gemeint hat. Hätte ich das geschrieben, würde ich auf keinen Fall wollen, dass Vivi einverstanden ist. Ich würde mir wünschen, dass sie mir hilft einzusehen, wie sehr Vivi und Oak mich lieben, auch wenn sie nicht menschlich sind. Vivi sollte darauf bestehen, dass es nichts bringt, so zu tun, als gäbe es das Elfenreich nicht. Ich würde mir wünschen, dass Vivi ihren Fehler zugibt und verspricht, es nie wieder zu tun, unter keinen Umständen.
Hätte ich diese Nachricht geschickt, wäre das ein Test.
Ich gebe Vivi das Handy zurück. »Was willst du ihr sagen?«
»Dass ich alles tue, was sie will«, antwortet meine Schwester mit einem Versprechen, das schon für einen Sterblichen extrem leichtsinnig wäre, aber wahrhaftig furchterregend für jemanden, der sich daran halten müsste.
»Vielleicht weiß sie nicht, was sie will«, sage ich. Was auch immer ich tue, ich bin nicht loyal. Vivi ist meine Schwester, aber Heather ist ein Mensch. Ich schulde beiden etwas.
Im Augenblick will Vivi nur hören, dass alles gut wird. Sie schenkt mir ein breites, entspanntes Lächeln, nimmt einen Apfel aus der Obstschale und wirft ihn in die Luft. »Was hat Oak eigentlich? Er kam hier hereingestampft und hat die Tür zugeknallt. Wird er auch so ein Theater machen, wenn er in die Pubertät kommt?«
»Er will nicht Hochkönig werden«, antworte ich.
»Ach, das.« Vivi wirft einen Blick auf seine Tür. »Ich dachte, es wäre etwas Wichtiges.«
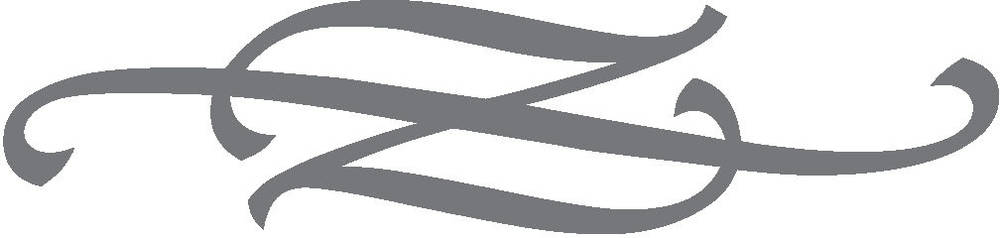
Heute Nacht empfinde ich es als Erleichterung, zur Arbeit zu gehen.
In der Welt der Sterblichen hat das Kleine Volk andere Bedürfnisse als in Elfenheim. Die freien Geister, die am Rande des Elfenreichs überleben, haben mit Festlichkeiten und den Machenschaften bei Hofe nichts im Sinn.
Wie sich zeigt, haben sie viele schräge Aufträge für jemanden wie mich, eine Sterbliche, die sich auskennt und vor dem ein oder anderen Kampf nicht fürchtet. Eine Woche nachdem ich Elfenheim verlassen habe, bin ich auf Bryern gestoßen. Er tauchte plötzlich vor der Apartment-Anlage auf – mit schwarzem Fell, Ziegenkopf, Ziegenhufen und einem Filzhut in der Hand – und gab sich als alter Freund von Kakerlak aus.
»Wenn ich das richtig verstanden habe, ist deine Situation einzigartig«, sagte er und sah mich mit seinen sonderbaren goldenen Ziegenaugen an, deren schwarze Pupillen ein liegendes Rechteck bildeten. »Wurdest du nicht für tot erklärt? Ohne Sozialversicherungsnummer. Keine sterbliche Schulbildung.«
»Und arbeitssuchend«, entgegnete ich. »Schwarz.«
»Schwärzer als bei mir geht’s nicht«, versicherte er mir und legte eine Klauenhand aufs Herz. »Ich darf mich vorstellen. Bryern. Ein Phooka, falls du es noch nicht erraten hast.«
Er bat nicht um einen Treueschwur oder andere Versprechen. Ich konnte so viel arbeiten, wie ich wollte, und die Bezahlung hing von meinem Wagemut ab.
Heute Nacht treffen wir uns am Wasser. Ich komme mit dem Gebrauchtfahrrad, das ich mir besorgt habe. Das Hinterrad ist schnell platt, aber das Fahrrad war billig und leistet mir auf meinen Wegen gute Dienste. Bryern ist wie üblich übertrieben sorgsam gekleidet: Ein Band um seinen Hut ist mit einigen leuchtend bunten Entenfedern geschmückt, und dazu passend hat er ein Tweedjackett angezogen. Als ich fast bei ihm bin, zieht er eine Uhr aus der Tasche, wirft einen Blick darauf und runzelt demonstrativ die Stirn.
»Oh, bin ich spät dran?«, frage ich. »Tut mir leid, ich bin es gewohnt, die Zeit an der Neigung des Mondscheins abzulesen.«
Er sieht mich genervt an. »Nur weil du am Hohen Hof gelebt hast, musst du nicht so vornehm tun. Du bist nichts Besonderes mehr.«
Ich bin die Königin von Elfenheim. Der Gedanke drängt sich ungebeten auf, und ich beiße mir auf die Wange, damit ich diese lächerlichen Worte nicht noch laut ausspreche. Er hat recht: Hier bin ich nichts Besonderes.
»Wie lautet der Auftrag?«, frage ich möglichst höflich.
»In Old Port frisst eine aus dem Kleinen Volk die Leute, die dort wohnen. Ich habe ein Vertragsangebot für jemanden, der ihr das Versprechen abnehmen will, damit aufzuhören.«
Ich kaufe ihm nicht ab, dass ihm das Schicksal von Menschen etwas bedeutet beziehungsweise dass sein Interesse so weit geht, dass er mich für gewisse Gegenmaßnahmen bezahlen will. »Menschen, die dort wohnen?«
Er schüttelt den Kopf. »Nein. Nein, welche von uns. Aus dem Kleinen Volk.« Dann fällt ihm wieder ein, mit wem er spricht, und er wirkt ein wenig verlegen. Ich gebe mir Mühe, sein Versehen nicht als Kompliment zu betrachten.
Jemand tötet und frisst Leute aus dem Kleinen Volk? Das hört sich nicht gerade nach einem leichten Job an. »Wer ist der Auftraggeber?«
Er lacht nervös auf. »Niemand, der mit der Tat in Verbindung gebracht werden will. Aber er ist bereit, sie dir zu vergüten.«
Bryern beschäftigt mich unter anderem deshalb gern, weil ich dem Kleinen Volk sehr nahe kommen kann. Keiner erwartet von einer Sterblichen, dass sie einen Dolch zückt, stiehlt oder jemandem eine Klinge in die Seite stößt. Genauso wenig rechnen sie damit, dass eine Sterbliche nicht verzaubert werden kann oder ihre Bräuche gut genug kennt, um ihre grässlichen Handelsangebote zu durchschauen.
Außerdem brauche ich dringend Geld und nehme deshalb Aufträge wie diesen an, die von Anfang an zum Himmel stinken.
»Die Adresse?«, frage ich, und er reicht mir einen gefalteten Zettel.
Ich öffne ihn und werfe einen Blick auf die Notiz. »Wehe, das ist nicht gut bezahlt.«
»Fünfhundert Dollar«, erwidert er, als wäre das eine ungeheuerliche Summe.
Unsere Miete beläuft sich monatlich auf eintausendzweihundert, ganz zu schweigen von Lebensmitteln und Nebenkosten. Da Heather nicht mehr da ist, muss ich die Hälfte, also ungefähr achthundert übernehmen. Außerdem hätte ich gern ein neues Hinterrad. Fünfhundert sind nicht annähernd genug für eine Nummer wie diese.
»Tausendfünfhundert«, kontere ich mit hochgezogenen Augenbrauen. »Cash, nachweisbar durch Eisen. Die Hälfte sofort, und wenn ich nicht wiederkomme, zahlst du Vivienne die andere Hälfte als Geschenk für meine leidtragende Familie.«
Bryern presst die Lippen aufeinander, doch ich weiß, dass er das Geld hat. Er will mir einfach nicht so viel zahlen, dass ich wählerisch werde, was die Aufträge angeht.
»Tausend«, bietet er als Kompromiss an und holt eine silberne Geldklammer mit einem dicken Bündel Scheine aus seinem Tweedjackett. »Hier, ich habe die Hälfte dabei, die kannst du haben.«
»Okay.« Wenn ich Glück habe und es bei einer Nacht bleibt, ist das eine gut bezahlte Mission.
Naserümpfend rückt er das Geld heraus. »Sag Bescheid, wenn der Auftrag erledigt ist.«
Mein Schlüsselanhänger ist aus Eisen. Ich fahre damit demonstrativ über die Ränder der Scheine, um mich zu vergewissern, dass sie echt sind. Es kann nicht schaden, Bryern daran zu erinnern, wie gewieft ich bin.
»Plus fünfzig für meine Auslagen«, fordere ich spontan.
Er runzelt die Stirn, doch im nächsten Augenblick greift er in die andere Jacketttasche und reicht mir die zusätzliche Kohle. »Bring es einfach aus der Welt«, sagt er. Es ist ein schlechtes Zeichen, dass er sich nicht einmal beschwert. Vielleicht hätte ich doch noch ein paar Fragen stellen sollen, bevor ich den Auftrag übernahm. Jedenfalls hätte ich unbedingt besser verhandeln sollen.
Zu spät.
Ich steige aufs Fahrrad, winke Bryern zum Abschied zu und mache mich auf den Weg ins Zentrum. Früher wollte ich einmal Ritterin hoch zu Ross werden und um Ehrenbezeigungen und Geschicklichkeit wetteifern. Wirklich schade, dass meine Begabung in einem gänzlich anderen Bereich liegt.
Ich könnte mich wohl mit einigem Recht als geschickte Mörderin des Kleinen Volkes bezeichnen, doch mein größtes Talent besteht darin, sie bis zur Weißglut zu reizen. Hoffentlich nützt mir das etwas, um eine Kannibalin zu überreden.
Bevor ich sie zur Rede stelle, hole ich lieber noch ein paar Erkundigungen ein.
Als Erstes begegne ich einem alten Kobold namens Magpie, der in einem Baum im Deering Oaks Park wohnt. Er hat gehört, sie wäre eine Rotkappe, was nicht gerade berauschend ist, aber da ich mit einer aufgewachsen bin, kenne ich mich mit ihrem Wesen zumindest gut aus.
Rotkappen stehen auf Gewalt, Blut und Mord – sie werden gereizt, wenn sie zu lange ohne auskommen müssen. Und wenn sie sich der Tradition verpflichtet fühlen, besitzen sie eine Kappe, die sie in das Blut ihrer verstorbenen Feinde tunken, um sich auf diese Weise angeblich die Lebenskraft des ermordeten Gegners zu sichern.
Ich frage nach ihrem Namen, doch Magpie kennt ihn nicht. Er schickt mich zu Ladhar, einem Cluricaun, der sich in den hintersten Ecken von Bars herumtreibt und den Schaum vom Bier trinkt, wenn niemand hinschaut, oder Sterbliche beim Glücksspiel betrügt.
»Das weißt du nicht?«, fragt Ladhar und senkt die Stimme. »Grima Mog.«
Beinahe hätte ich ihn des Lügens bezichtigt, obwohl ich es besser weiß. Dann gebe ich mich kurz, aber leidenschaftlich der Fantasie hin, Bryern aufzuspüren und ihm für jeden Dollar, den er mir gegeben hat, einmal den Hals umzudrehen. »Was zum Teufel macht die hier?«
Grima Mog ist die berüchtigte Generalin vom Hof der Zähne im Norden. Vor diesem Hof haben Kakerlak und Bombe die Flucht ergriffen. Als ich klein war, hat Madoc mir vor dem Schlafengehen aus den historischen Berichten über ihre Kriegskunst vorgelesen. Allein bei der Vorstellung, mich mit ihr zu messen, bricht mir der kalte Schweiß aus.
Ich kann nicht gegen sie kämpfen. Und ich glaube auch nicht, dass ich große Chancen habe, sie hereinzulegen.
»Rausgeflogen, sagt man«, meinte Ladhar. »Vielleicht hat sie einen von Lady Nores Lieblingen gefressen.«
Ich muss den Auftrag nicht übernehmen, ermahne ich mich. Schließlich gehöre ich Dains Hof der Schatten nicht mehr an. Und ich versuche auch nicht mehr, hinter Hochkönig Cardans Thron die Strippen zu ziehen. Es besteht keinerlei Anlass, ein hohes Risiko einzugehen.
Aber ich bin neugierig.
Wenn man das mit reichlich verletztem Stolz kombiniert, findet man sich in der Morgendämmerung auf den Stufen zu Grima Mogs Lagerhalle wieder. Ich bin nicht so dumm, mit leeren Händen zu kommen, und habe mir beim Metzger rohes Fleisch besorgt, das in einer Kühlbox aus Styropor liegt. Außerdem habe ich ein paar schlampig zubereitete Honig-Sandwichs in Alufolie und eine gute Flasche Sauerbier dabei.
In der Lagerhalle gehe ich durch einen Gang zu einer Tür, hinter der vermutlich eine Wohnung liegt. Nachdem ich drei Mal geklopft habe, kann ich nur hoffen, dass der Fleischgeruch wenigstens den Gestank meiner Angst überdeckt.
Als die Tür geöffnet wird, steckt eine Frau in einem Kittel den Kopf heraus. Sie hat einen Buckel und stützt sich auf einen Stock aus glatt poliertem schwarzem Holz. »Was willst du, Liebes?«
Da ich ihre Verzauberung durchschaue, sehe ich den grünen Hautton und ihre übergroßen Zähne. Sie sieht wie mein Stiefvater Madoc aus – der Typ, der meine Eltern auf dem Gewissen hat. Und der mir über ihre Kriegskunst vorgelesen hat. Madoc, einst Großgeneral am Hohen Hof und jetzt Feind des Throns und auch nicht wirklich ein Fan von mir.
Hoffentlich ruinieren er und Hochkönig Cardan sich gegenseitig.
»Ich bringe dir Geschenke«, sage ich und hebe die Kühlbox hoch. »Darf ich reinkommen? Ich möchte einen Handel abschließen.«
Sie runzelt ein wenig die Stirn.
»Du kannst dich nicht nach Belieben durch das Kleine Volk fressen, ohne dass jemand kommt und versucht, dich höflich davon abzubringen«, sage ich.
»Vielleicht fresse ich ja dich, mein hübsches Kind«, entgegnet sie besser gelaunt. Doch sie macht Platz und lässt mich in ihren Unterschlupf. Im Flur kann sie mich vermutlich nicht so gut fressen.
Die Wohnung ist ein Loft mit hohen Decken und Backsteinwänden. Schick, mit polierten Böden und Panoramafenstern, die viel Licht hereinlassen und eine gute Sicht auf die Stadt bieten. Die Einrichtung ist antik. Hier und da quillt die Polsterung heraus, und ich sehe einige Kerben, die von einem Messer stammen können. Es riecht durchdringend nach Blut, nach einer Mischung aus Kupfer, Metall und einer widerlichen Süße. Ich stelle meine Geschenke auf einen schweren Holztisch.
»Für dich«, sage ich. »In der Hoffnung, dass du mir die Unhöflichkeit meines unangemeldeten Besuches verzeihst.«
Sie beschnüffelt das Fleisch, dreht ein Honig-Sandwich um und öffnet die Bierflasche mit der Faust. Nachdem sie einen großen Schluck getrunken hat, mustert sie mich.
»Jemand hat dich angewiesen, nett zu sein. Warum, weiß ich wirklich nicht, Zicklein. Du bist ganz offensichtlich das Opfer, das man mir in der Hoffnung schickt, mein Appetit könnte mit Menschenfleisch gestillt werden.« Sie lächelt und zeigt die Zähne. Kann sein, dass sie in diesem Moment die Maske fallen lässt, doch da ich sie bereits durchschaut hatte, kann ich das nicht sagen.
Ich blinzele, sie blinzelt zurück und wartet sichtlich auf eine Reaktion.
Indem ich nicht schreiend zur Tür gelaufen bin, habe ich sie verärgert. Das merke ich sehr wohl. Ich glaube, sie hatte sich darauf gefreut, mich zu verfolgen.
»Du bist Grima Mog«, sage ich. »Die Anführerin von Armeen, der Ruin deiner Feinde. Willst du tatsächlich so deinen Ruhestand verbringen?«
»Ruhestand?« Sie wiederholt das Wort, als hätte ich sie übelst beleidigt. »Ich wurde zwar abgesetzt, aber ich werde mir eben eine neue Armee suchen, die ich anführen kann. Eine größere als die erste.«
Manchmal rede ich mir etwas sehr Ähnliches ein. Laut ausgesprochen klingt es befremdlich, aber es bringt mich auf eine Idee. »Tja, deine Nachbarn aus dem Kleinen Volk möchten nicht gern gefressen werden, während du deinen nächsten Karriereschritt planst. Als Mensch wäre es mir natürlich lieber, wenn du auch keine Sterblichen zu dir nehmen würdest – ich bezweifele ohnehin, dass sie dir den gewünschten Genuss verschaffen.«
Sie wartet.
»Ich rede von einer Herausforderung«, sage ich, weil ich Rotkappen kenne. »Darauf stehst du doch, oder? Auf einen guten Kampf. Wetten, dass deine Opfer alle nichts Besonderes waren? Was für eine Verschwendung deiner Fähigkeiten.«
»Wer schickt dich?«, fragt sie schließlich, während sie die Lage neu bewertet und versucht, sich ein Bild von mir zu machen.
»Was hast du ihr getan, dass sie so sauer ist?«, frage ich. »Ich meine deine Königin vom Hof der Zähne. Es muss schon etwas Wichtiges gewesen sein, wenn sie dich rausgeschmissen hat.«
»Wer schickt dich?«, brüllt Grima Mog. Da habe ich wohl einen Nerv getroffen. Meine Spezialität.
Ich unterdrücke das Lächeln, doch ich habe den Rausch der Macht vermisst, der sich bei solchen Spielchen einstellt, wenn man berechnend und listig ist. Ich gebe es ungern zu, aber es fehlt mir, meinen Kopf zu riskieren. Man hat keine Zeit, etwas zu bereuen, wenn man alles dransetzt zu gewinnen. Oder zumindest nicht zu sterben. »Hab ich doch schon gesagt. Die Leute hier, die nicht gefressen werden wollen.«
»Aber wieso dich?«, fragt sie. »Warum schicken sie mir so einen Hungerhaken?«
Als ich den Blick schweifen lasse, fällt mir ein runder Behälter auf dem Kühlschrank auf. Eine altmodische Hutschachtel, an der mein Blick hängen bleibt. »Vermutlich, weil es niemandem etwas ausmacht, falls ich scheitere.«
Das bringt Grima Mog zum Lachen und sie trinkt noch einen Schluck Sauerbier. »Eine Fatalistin. Wie willst du mich denn nun bekehren?«
Auf der Suche nach einem Vorwand, näher an die Hutschachtel heranzukommen, gehe ich zum Tisch und nehme das mitgebrachte Essen in die Hand. »Zunächst, indem ich deine Lebensmittel einräume.«
Grima Mog wirkt amüsiert. »Eine alte Dame wie ich könnte für gewisse Hausarbeiten ein junges Ding gut gebrauchen. Aber Vorsicht. In meiner Speisekammer könntest du mehr finden, als du verkraften kannst, Zicklein.«
Ich mache den Kühlschrank auf. Die Überreste der Opfer aus dem Kleinen Volk schauen mich an. Sie hat Arme und Köpfe gesammelt, irgendwie konserviert, gebacken und gegrillt und einfach weggeräumt wie Überreste nach einem großen Festessen. Es dreht mir den Magen um.
Ein boshaftes Lächeln schleicht sich auf Grima Mogs Gesicht. »Du wolltest mich wohl zu einem Duell herausfordern, was? Wolltest du damit angeben, welch guten Kampf du liefern könntest? Jetzt siehst du, was dabei herauskommt, wenn man gegen Grima Mog verliert.«
Ich hole tief Luft. Dann springe ich hoch und boxe die Hutschachtel vom Kühlschrank in meine Arme.
»Finger weg!«, schreit sie und kommt auf die Beine, als ich den Deckel abreiße.
Und da ist sie: die Kappe, lackiert mit Blut, eine Schicht über der anderen.
Mit gebleckten Zähnen steht sie mir gegenüber. Ich hole ein Feuerzeug aus der Tasche und zünde es mit dem Daumen an. Als sie die Flamme sieht, bleibt Grima Mog ruckartig stehen.
»Ich weiß, dass du viele lange Jahre an der Patina dieser Kappe gearbeitet hast«, sage ich und reiße mich so weit zusammen, dass meine Hand nicht zittert und die Flamme nicht erlischt. »Wahrscheinlich ist sogar Blut von deinem ersten Mord dabei, genau wie von deinem letzten. Ohne die Kappe erinnert nichts an deine vergangenen Erfolge, keine Trophäe, gar nichts. Und jetzt kommen wir zu unserem Handel. Du musst schwören, dass es keine weiteren Morde geben wird. Weder im Kleinen Volk noch unter den Sterblichen, solange du in der Menschenwelt weilst.«
»Sonst verbrennst du meinen Schatz?«, spricht Grima Mog für mich weiter. »Darin liegt keine Ehre.«
»Ich könnte dir anbieten, gegen dich zu kämpfen«, sage ich. »Aber ich würde vermutlich verlieren. Auf diese Weise gewinne ich.«
Grima Mog zeigt mit der Spitze ihres schwarzen Stocks auf mich. »Du bist Madocs Menschenkind, nicht wahr? Und die verbannte Seneschallin unseres neuen Hochkönigs. Abgeschossen, genau wie ich.«
Ich nicke verunsichert, weil sie mich erkannt hat.
»Was hast du getan?«, fragt sie mit einem zufriedenen kleinen Lächeln im Gesicht. »Muss ja etwas Wichtiges gewesen sein.«
»Ich war zu dumm«, antworte ich, weil ich es genauso gut zugeben kann. »Ich habe wegen der Taube auf dem Dach auf den Spatz in der Hand verzichtet.«
Sie lacht laut und dröhnend. »Sind wir nicht ein schönes Paar, Rotkappentochter? Aber Mord liegt mir in den Knochen und im Blut. Ich denke nicht daran, mit dem Töten aufzuhören. Wenn ich schon in der Menschenwelt feststecke, will ich mich wenigstens amüsieren.«
Ich bringe die Flamme näher an den Hut. Unten wird der Stoff schon schwarz und ein grässlicher Gestank erfüllt die Luft.
»Stopp!«, schreit sie und sieht mich mit zügellosem Hass an. »Das reicht. Jetzt mache ich dir ein Angebot, Zicklein. Wir kämpfen. Wenn du verlierst, bekomme ich meinen Hut unverbrannt zurück. Ich gehe wie gewohnt auf die Jagd. Und du gibst mir deinen kleinsten Finger.«
»Zum Fressen?«, frage ich und nehme die Flamme vom Hut.
»Wenn mir danach ist«, erwidert sie. »Oder ich trage ihn als Brosche. Wieso interessiert es dich, was ich damit mache? Es geht darum, dass er dann mir gehört.«
»Und warum sollte ich darauf eingehen?«
»Weil du dein Versprechen bekommst, wenn du gewinnst. Und ich erzähle dir etwas Wichtiges über deinen Hochkönig.«
»Ich will nichts von ihm hören«, fauche ich viel zu schnell und viel zu böse. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie Cardan erwähnt.
Sie lacht tief und dröhnend. »Kleine Lügnerin.«
Wir fixieren uns lange. Grima Mogs Blick ist unmissverständlich. Sie weiß, dass sie mich hat. Gleich werde ich ihren Bedingungen zustimmen. Auch ich weiß es, obwohl es lächerlich ist. Sie ist eine Legende. Ich rechne mir nicht die geringste Chance aus.
Doch Cardans Name rauscht in meinen Ohren.
Hat er einen neuen Seneschall ernannt? Hat er eine neue Geliebte? Macht er sich mit Locke über mich lustig? Lacht Taryn mich aus?
»Wir kämpfen bis zum ersten Treffer«, sage ich und verdränge alle anderen Gedanken aus meinem Kopf. Es ist ein Vergnügen, jemanden zu haben, bei dem ich meine gesamte Wut abladen kann. »Ich gebe dir keinen Finger«, fahre ich fort. »Wenn du gewinnst, bekommst du deine Kappe. Punkt. Und ich kann gehen. Mein Entgegenkommen besteht darin, dass ich überhaupt mit dir kämpfe.«
»Bis zum ersten Treffer ist öde.« Grima Mog beugt sich vor, alle Muskeln angespannt. »Sagen wir, bis einer von uns aufschreit. Lassen wir es irgendwo im Zwischenbereich von Blutvergießen und Zum-Sterben-nach-Hause-Kriechen enden.« Sie seufzt, als wäre ihr etwas Schönes eingefallen. »Gib mir die Chance, dir jeden Knochen in deinem dürren Körper zu brechen.«
»Du verlässt dich auf meinen Stolz.« Ich stecke ihre Kappe in eine Jackentasche und das Feuerzeug in die andere.
Sie leugnet es nicht. »Und habe ich recht?«
Bis zum ersten Treffer ist wirklich öde. Man tanzt umeinander herum und wartet auf eine Schwachstelle. Ein echter Kampf ist das nicht. Als ich antworte, platze ich mit dem Wort heraus: »Ja.«
»Gut.« Sie zeigt mit der Stockspitze zur Decke. »Lass uns aufs Dach gehen.«
»Nun, das ist alles sehr zivilisiert«, sage ich.
»Ich kann nur hoffen, dass du eine Waffe mitgebracht hast. Ich denke nicht daran, dir eine zu leihen.« Mit einem schweren Seufzer geht sie zur Tür, als wäre sie wirklich die alte Frau, in die sie sich verzaubert hat.
Ich folge ihr aus der Wohnung durch den schlecht beleuchteten Gang und auf eine noch dunklere Treppe. Meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Ich hoffe, ich weiß, was ich tue. Grima Mog nimmt zwei Stufen auf einmal, mittlerweile kampfbegierig, und reißt oben eine Metalltür auf. Ich höre Stahl klirren, als sie ein schmales Schwert aus ihrem Stock zieht. Ein gieriges Lächeln zieht ihre Lippen weit auseinander und offenbart ihre spitzen Zähne.
Ich zücke den langen Dolch, den ich in meinem Stiefel versteckt habe. Er hat nicht die optimale Reichweite, aber mir fehlt die Fähigkeit, Dinge zu verzaubern, und ich kann schlecht mit Nachtfäller auf dem Rücken Fahrrad fahren.
Im Augenblick wünschte ich dennoch, ich hätte es irgendwie möglich gemacht.
Ich betrete das Asphaltdach der Lagerhalle. Langsam geht die Sonne auf und taucht den Himmel in Pink und Gold. Eine kalte Brise pfeift durch die Luft und weht die Gerüche von Beton und Müll herbei, versüßt von Goldrute aus dem nahe gelegenen Park.
Mein Herz rast in einer Mischung aus Angst und Eifer. Als Grima Mog angreift, bin ich bereit. Ich pariere den Schlag und weiche aus. Das mache ich zu ihrem Ärger wieder und wieder.
»Du hast mir Gefahr versprochen«, knurrt sie, doch immerhin habe ich ein Gefühl dafür bekommen, wie sie sich bewegt. Ich weiß, dass sie nach Blut giert, nach Gewalt. Ich weiß, dass sie es gewohnt ist, auf die Jagd zu gehen, und kann nur hoffen, dass sie sich zu viel darauf einbildet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie Fehler macht, wenn jemand den Kampf aufnimmt.
Unwahrscheinlich, aber im Bereich des Möglichen.
Bei ihrem nächsten Angriff drehe ich mich blitzschnell um und verpasse ihr einen Tritt in die Kniekehle, so hart, dass sie zu Boden stürzt. Sie brüllt, rappelt sich auf und stürzt sich mit voller Wucht auf mich. Einen lähmenden Augenblick lang flackert entsetzliche Angst in mir auf, als ich ihr wütendes Gesicht und diese grässlichen Zähne sehe.
Ungeheuer!, kreischt mein Verstand.
Ich beiße die Zähne zusammen und widerstehe der Versuchung, mich zu ducken. Unsere Klingen glänzen hell wie Fischschuppen im neuen Licht des Tages. Das Metall schlägt klirrend aneinander, dröhnend wie eine Glocke. Wir tänzeln kämpfend über das Dach, meine Füße geben alles, während es hin und her geht. Mir bricht der Schweiß auf der Stirn und unter den Achseln aus. Mein heißer Atem dampft in der kalten Luft.
Es ist ein gutes Gefühl, nicht mehr nur gegen mich selbst zu kämpfen.
Grima Mog beobachtet mich mit zusammengekniffenen Augen und sucht eine Schwachstelle. Ich besinne mich auf jede Korrektur von Madoc und auf jede schlechte Angewohnheit, die Geist mir austreiben wollte. In dem Versuch, mich über die Dachkante zu treiben, setzt Grima Mog zu einer brutalen Serie harter Schläge an. Ich weiche zurück und versuche, mich des Hagels ihrer Schläge zu erwehren, der größeren Reichweite ihres Schwerts. Anfangs hat sie sich zurückgehalten, doch das ist vorbei.
Unaufhörlich treibt sie mich zu einem freien Fall und ich wehre mich mit Ingrimm. Meine Haut ist schweißnass, zwischen den Schulterblättern bilden sich Tropfen.
Dann stößt mein Fuß an ein Metallrohr, das aus dem Bodenbelag ragt. Als ich ins Taumeln gerate, schlägt Grima Mog zu. Ich kann es gerade noch abwenden, durchbohrt zu werden, doch es kostet mich meinen Dolch, der vom Dach fliegt und mit einem dumpfen Geräusch auf der Straße landet.
Ich hätte diesen Auftrag nicht annehmen dürfen. Niemals hätte ich diesem Kampf zustimmen dürfen. Auch Cardans Heiratsantrag hätte ich nicht annehmen sollen und auf keinen Fall durfte ich mich in die Welt der Sterblichen verbannen lassen.
Die Wut verleiht mir frische Energie, die ich dazu nutze, aus Grima Mogs Reichweite zu flüchten, sodass ihr Schwert durch ihren schwungvollen Schlag hinter mir hinabsaust. Dann stoße ich ihr meinen Ellbogen fest in den Arm und packe das Heft ihres Schwerts.
Das ist kein besonders ehrenwerter Zug, doch ehrenwert bin ich schon lange nicht mehr. Trotz all ihrer Kraft habe ich Grima Mog jetzt überrumpelt. Sie zögert kurz, doch dann rammt sie ihre Stirn gegen meine. Ich gerate ins Taumeln, aber ich hätte ihre Waffe beinahe bekommen.
Beinahe hätte ich sie gehabt.
In meinem Kopf dreht sich alles und mir ist ein wenig schwindelig.
»Du hast geschummelt, Mädchen«, sagt sie. Wir sind beide außer Atem und meine Lunge fühlt sich bleiern an.
»Ich bin keine Ritterin.« Als wollte ich diese Aussage noch betonen, greife ich zu der einzigen Waffe, die ich sehe: einer Metallstange. Sie ist schwer und hat keinen Griff, aber immerhin. Wenigstens ist sie länger als mein Dolch.
Sie lacht. »Du hättest dich geschlagen geben sollen, aber ich freue mich, dass du es nicht getan hast.«
»Ich bin Optimistin«, erwidere ich. Und als sie jetzt losstürmt, hat sie das Tempo auf ihrer Seite, aber ich verfüge über die größere Reichweite. Wir kreisen umeinander, während sie zuschlägt und ich mit der Stange pariere, die sich höchstens wie ein Baseballschläger schwingen lässt. Ich wünsche mir so einiges, aber vor allem, dass ich lebend von diesem Dach herunterkomme.
Meine Energie schwindet. Die Stange ist zu schwer für mich, und ich habe Schwierigkeiten, damit zu hantieren.
Gib auf, mahnt mein durchdrehender Verstand.