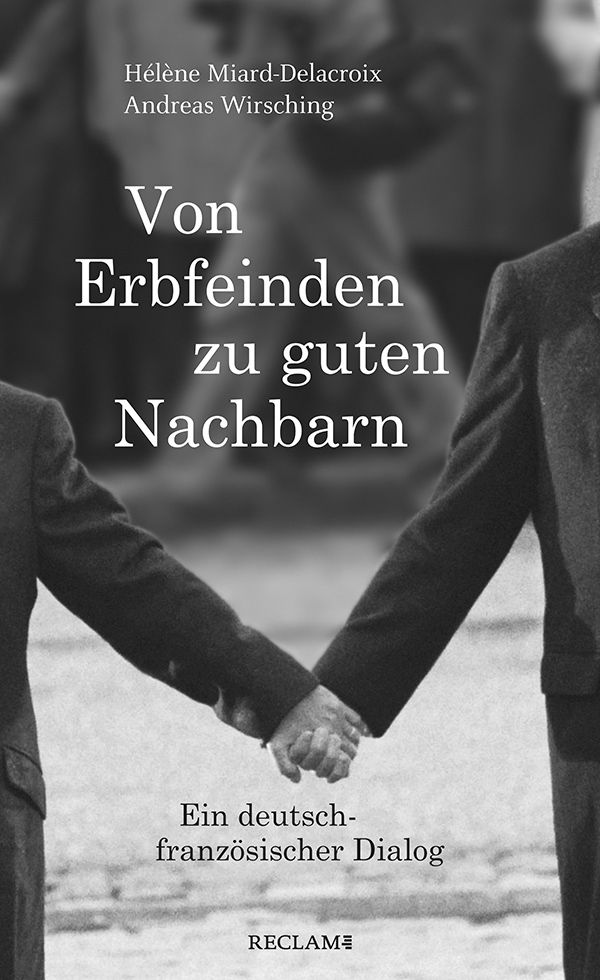
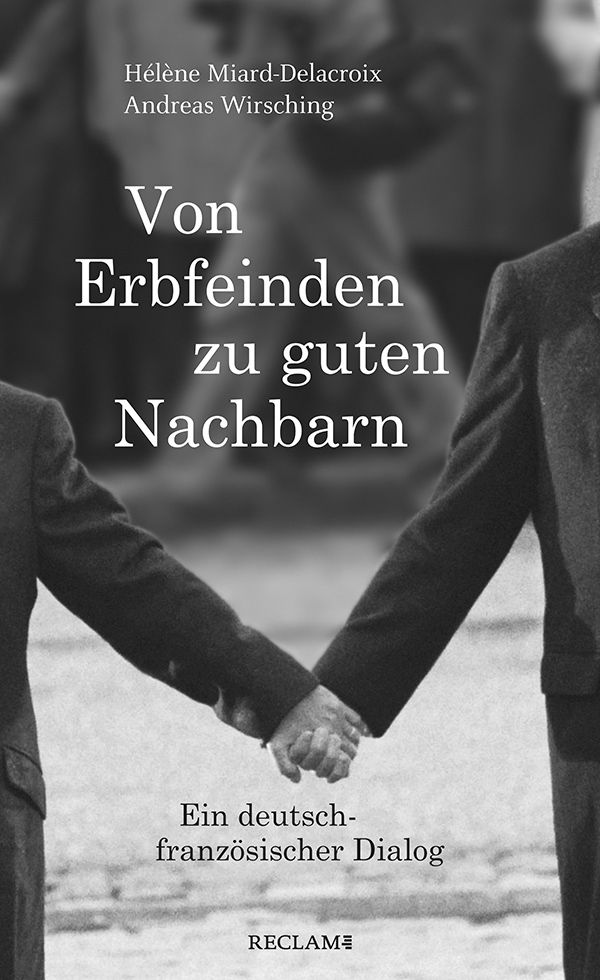

© Alain Mandel
HÉLÈNE MIARD-DELACROIX, geb. 1959, ist Professorin an der Sorbonne Université in Paris. Ihre Schwerpunkte liegen auf der deutschen Geschichte und der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen.

© Institut für Zeitgeschichte
ANDREAS WIRSCHING, geb. 1959, ist Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München – Berlin und Professor für Neueste Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Beide sind Autoren des 2018 bei Reclam erschienenen Bandes Weimarer Verhältnisse?
Aus heutiger Sicht erscheint es kaum noch vorstellbar, dass die beiden großen Länder im Herzen Europas einander jahrhundertelang so argwöhnisch wie eifersüchtig beäugten – und immer wieder in blutigen Konflikten aufeinandertrafen, etwa im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg.
Dass die zwei Nationen nach 1945 überaus zügig zu einem freundschaftlichen Verhältnis gefunden haben, ist auch dem Umstand zu verdanken, dass sich zahlreiche Menschen auf beiden Seiten immer wieder um Verständigung bemüht haben. Nicht zuletzt ist die Geschichte des deutsch-französischen Verhältnisses eine Geschichte der politischen Paare – von Helmut Kohl und François Mitterrand bis hin zu Angela Merkel und Emmanuel Macron.
In einem lebhaften Gespräch entfalten Hélène Miard-Delacroix und Andreas Wirsching die wechselvolle Geschichte einer einzigartigen Nachbarschaft und erklären, wie wichtig die Kenntnis der gemeinsamen Vergangenheit für die deutsch-französische Zusammenarbeit in der EU des 21. Jahrhunderts ist.
Die E-Books des Reclam Verlags verwenden entsprechend der jeweiligen Buchausgabe Sperrungen zur Hervorhebung von Textpassagen. Diese Textauszeichnung wird nicht von allen Readern unterstützt.
Enthält das E-Book in eckigen Klammern beigefügte Seitenzählungen, so verweisen diese auf die Printausgabe des Werkes.
Ernest Renan, »Was ist eine Nation? Vortrag an der Sorbonne, gehalten am 11. März 1882«, in: Ders.: Was ist eine Nation? und andere politische Schriften (=TRANSFER Kulturgeschichte, Bd. II), Wien u. a. 1995, S. 41–58.
Ernst Moritz Arndt, Über Volkshaß, Leipzig 1813, S. 14.
Friedrich Rühs, Historische Entwickelung des Einflusses Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen, Berlin 1815, S. IX.
Ernst Moritz Arndt, »Des Deutschen Vaterland (1813)«, in: Ders., Gedichte. Vollständige Sammlung, Berlin 1860, hier S. 233–235.
Johann Peter Eckermann, »Sonntag, den 14. Mai 1830«, in: Ders., Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, hrsg. von Regine Otto, 2. Aufl., München 1984, S. 624–632, hier S. 631 f.
Max Schneckenburger, »Die Wacht am Rhein«, in: Deutsche Lieder von Max Schneckenburger, dem Sänger der ›Wacht am Rhein‹. Auswahl aus seinem Nachlaß, Stuttgart 1870, S. 19 f.
Nicolaus Becker, »Der deutsche Rhein«, in: Ders., Gedichte, Köln 1841, S. 216–218, hier S. 218.
Zit. nach Birgit Aschmann, »Ehre – das verletzte Gefühl als Grund für den Krieg. Der Kriegsausbruch 1870«, in: Dies., Gefühl und Kalkül. Der Einfluss von Emotionen auf die Politik des 19. und 20. Jahrhunderts, München 2005, S. 151–174, hier S. 151.
Vincent Comte Benedetti, Ma mission en prusse, 3. Aufl., Paris 1871, S. 307.
Thomas Grimm, »La guerre. La guerre des rues«, in: Le Petit Journal, 30. August 1870.
Zit. nach Maurice Dommanget, Blanqui, la Guerre de 1870–71 et la Commune, Paris 1947, S. 49.
Victor Hugo, Actes et Paroles III, Depuis L’Exil. 1870–1876, Paris 1876, S. 14.
Leopold von Ranke, »Tagebuchblätter, Zweites und drittes Gespräch mit Thiers und Genossen; 11. November«, in: Ders., Weltgeschichte, Vierter Band. Mit einem Anhang: Aufsätze zur eigenen Lebensbeschreibung. Tagebuchblätter, Leipzig 1896, S. 737–739, hier S. 739.
Alexander II. an Wilhelm I., 21. August 1870, zit. nach Eberhard Kolb, Der Weg aus dem Krieg: Bismarcks Politik im Krieg und die Friedensanbahnung 1870/71, München 1990, S. 182.
Gustave Courbet, Lettres de Gustave Courbet à l’armée allemande et aux artistes allemands lues à l’Athénée, dans la séance du 29 octobre 1870, Paris 1870, S. 15.
Elme-Marie Caro, »Les deux Allemagnes. — Madame de Staël et Henri Heine«, in: Revue des Deux Mondes 96 (1871), 2, S. 5–20, hier S. 13.
Ebd., S. 16.
Paul de Saint-Victor, Barbares et Bandits. La Prusse et la Commune, Paris 1871, hier S. 136.
Zit. nach Wolfgang Leiner, Das Deutschlandbild in der französischen Literatur, Darmstadt 1989, S. 170.
Heinrich von Sybel, Was wir von Frankreich lernen können. Vortrag gehalten im Bonner Bildungs-Verein am 18. Februar 1872, hier S. 3 und 15 f.
»Diktat zur Orientkrise: Die orientalische Frage als Problem der Sicherheit Deutschlands, Kissingen, den 15. Juni 1877«, in: Otto von Bismarck, Werke in Auswahl, hrsg. von Gustav Adolf Rein u. a., Bd. 6, Darmstadt 1976, Nr. 11, S. 52. Dort findet sich auch der cauchemar des coalitions.
Z. B. Andreas Rödder, Wer hat Angst vor Deutschland? Geschichte eines europäischen Problems, Frankfurt a. M. 2018, S. 12.
Zit. nach Egmont Zechlin, »Motive und Taktik der Reichsleitung 1914. Ein Nachtrag«, in: Der Monat 209 (1966), S. 91–95, hier S. 92.
»Aufruf an die Kulturwelt«, 4. Januar 1914, in: Aufrufe und Reden deutscher Professoren im Ersten Weltkrieg, hrsg. von Klaus Böhme, 2. Aufl., Stuttgart 2014, S. 47 f.
Ebd., S. 48.
Walter Flex, Der Wanderer zwischen beiden Welten. Ein Kriegserlebnis, München 1917, S. 53.
Sophie Lorrain, Des pacifistes français et allemands pionniers de l'entente franco-allemande (1870–1925), Paris 1999, S. 203.
Zit. nach August Müller, »Deutschland und Frankreich«, in: Germania 204 (2. Mai 1925).
Friedrich Sieburg, Gott in Frankreich? Ein Versuch, Frankfurt a. M. 1929, S. 15.
Paul Distelbarth, Franzosen und Deutsche. Bauern und Krieger, Stuttgart/Hamburg 1946, hier S. 179.
Z. B. Andreas Rödder, Wer hat Angst vor Deutschland? Geschichte eines europäischen Problems, Frankfurt a. M. 2018, S. 102.
»Rede Dr. Heiner Geißler, Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit vor dem Deutschen Bundestag«, in: Deutscher Bundestag, Plenarsitzung vom 15. Juni 1983, S. 752–764, hier S. 755.
Joseph Rovan, »L’Allemagne de nos mérites«, in: Esprit 13 (1. Oktober 1945), H. 115, S. 529–540.
Stefan Seidendorf (Hrsg.), Deutsch-Französische Beziehungen als Modellbaukasten? Zur Übertragbarkeit von Aussöhnung und strukturierter Zusammenarbeit, Baden-Baden 2012, S. 48–50.
Andreas Wirsching, Abschied vom Provisorium. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 1982–1990, München 2006, S. 515.
Le Figaro, 2. November 1989.
»Staatspräsident de Gaulle, Pressekonferenz im Élyséepalast, 25. 3. 1959 (Auszug)« (= Dokument 234), in: Die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich: Dokumente 1949–1963, hrsg. von Horst Möller und Klaus Hildebrand, Band 1: Außenpolitik und Diplomatie, München 1997, S. 725–728, hier S. 727.
Hans-Dietrich Genscher, »Keine Gebietsansprüche an Polen«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. Februar 1990.
Hélène Miard-Delacroix, Deutsch-Französische Geschichte im Zeichen der europäischen Einigung. 1963 bis in die Gegenwart, Darmstadt 2011, S. 307 f.
»Die Deutschen [sind] unfassbarer, umfänglicher, widerspruchsvoller, unbekannter, unberechenbarer, überraschender, selbst erschrecklicher, als es andere Völker sich selber sind: – sie entschlüpfen der Definition und sind damit schon die Verzweiflung der Franzosen.« Diese von Friedrich Nietzsche 1886 gestellte Diagnose trifft recht gut den Geist der damaligen Zeit. 15 Jahre nach dem Deutsch-französischen Krieg war das Verständnis zwischen Frankreich und Deutschland erschwert und belastet. Und auch darüber, was überhaupt ›die‹ Deutschen und ›die‹ Franzosen damals waren und was sie heute sind, lässt sich trefflich diskutieren.
Dass sich der Deutsch-französische Krieg von 1870/71 nun zum 150. Male jährt, gibt einmal mehr Anlass, sich mit den Beziehungen beider Länder näher auseinanderzusetzen. Der Krieg und in seiner Folge die Gründung des Deutschen Kaiserreichs waren ein extrem einschneidendes Ereignis. »Dieser Krieg bedeutet die deutsche Revolution«, kommentierte der britische Premierminister Benjamin Disraeli, »ein größeres politisches Ereignis als die Französische Revolution des vergangenen Jahrhunderts.« Tatsächlich war nach 1870/71 zwischen Frankreich und Deutschland nichts mehr so wie zuvor. Die Rahmenbedingungen ihrer Beziehungen hatten sich fundamental gewandelt. Zwar bestanden das Interesse füreinander und die kulturellen Beziehungen fort. Aber sie wurden von militärischem Argwohn und politischer Feindschaft überlagert. Schon zuvor bestehende Missgunst verstärkte sich und neuer Hass entstand.
Entsprechend kompliziert gestalteten sich die deutsch-französischen Beziehungen im 20. Jahrhundert, und der Weg zur dauerhaften Kooperation, guten Nachbarschaft, ja Freundschaft war gesäumt von der bitteren Erfahrung erneuter Kriege und millionenfachen Todes. Stets war die Frage eines Einvernehmens zwischen beiden Ländern für die europäische Geschichte essenziell. Heute, inmitten eines Friedens in unsicheren Zeiten, gilt dies ganz besonders.
Auf den folgenden Seiten verfolgen wir in Form eines Dialogs die wichtigsten historischen Entwicklungen und prägenden Ereignisse in der Geschichte der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Das Format eines eintägigen lebendigen Gesprächs war ein lohnendes Experiment. Dabei ging es nicht darum, den Gegenstand einfach aus der ›französischen‹ und aus der ›deutschen‹ Sicht zu betrachten. Sich mit der Geschichte, Kultur und Mentalität des Nachbarn zu beschäftigen, ja sich in sie hineinzuversetzen, ermöglicht reziprokes Verständnis. Es war uns daher ein Vergnügen, gemeinsam Bekanntes neu zu beleuchten und Neues zu entdecken, auch wenn sich in diesem Rahmen eine volle wissenschaftliche Akribie natürlich nicht erreichen lässt. Für die thematische Auswahl und verbleibende Ungenauigkeiten übernehmen wir daher selbstverständlich die Verantwortung.
Dem Reclam Verlag danken wir für die Initiative zu diesem Buch sowie insbesondere dafür, dass er aus dem lockeren Gespräch einen lesbaren Text machte und die Drucklegung mit Umsicht begleitete.
Christina Holzmann und Isabella Radmann danken wir für das Mitlesen der Korrekturen.
Paris und München, im Juli 2019
Hélène Miard-Delacroix und Andreas Wirsching
Andreas Wirsching (AW): Kennst du den Witz von Monsieur Lagarde, der 1870 im Elsass lebte?
Hélène Miard-Delacroix (HMD): Hm, ich weiß nicht so genau …
AW: Lagarde ist ja ein relativ häufiger Name in Frankreich. Er lebte aber im Elsass, und 1871 wurde sein Name in »Herr Wache« übersetzt. Dann kam der Erste Weltkrieg, 1918 fiel das Elsass wieder an Frankreich zurück, und man nannte ihn nun »Monsieur Vache«. 1940, als das Elsass wieder von Deutschland beansprucht wurde, wurde aus ihm »Herr Kuh«. Was machte man also wohl 1945 aus ihm, als Frankreich das Elsass erneut zurückbekam? – »Monsieur Q«.
HMD: Oh, das ist ja traurig. Da hat er seine Identität völlig verloren. Außerdem ist Monsieur Q im Französischen auch noch ziemlich doppeldeutig.
AW: Schon ein armer Kerl, nicht wahr?
HMD: Insofern ist es nicht gerade eine lustige Geschichte für den Betroffenen, den armen Elsässer, der nicht mehr so genau weiß, wer er ist. Ist er Deutscher, ist er Franzose?
AW: Das ist genau die Frage: Was sind die Elsässer eigentlich? Das ist ja für die französische Geschichte ein wichtiger Punkt, genau wie für die deutsche. Darin steckt natürlich die Frage: Wovon reden wir eigentlich genau, wenn wir »Deutsche« und »Franzosen« sagen? Die Elsässer scheinen weder das eine noch das andere zu sein …
HMD: Der Historiker Heinrich von Treitschke hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts dargelegt – und meinte, aus der Forschung heraus beweisen zu können –, dass die Elsässer Deutsche seien. Er hat sogar behauptet, die Elsässer seien auch dann Deutsche, wenn sie es nicht wüssten oder nicht sein wollten. Für ihn gab es gewissermaßen eine unbewusste Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit. Das war damals das deutsche Verständnis dessen, was das Elsass ist.
AW: Das ist ein essenzialistisches Verständnis, ein Volksbegriff, der geradezu biologisch argumentiert und am Ende nicht mehr hinterfragt werden kann. Die Franzosen haben üblicherweise einen etwas anderen Nationsbegriff, wenn man zum Beispiel an den Philosophen und Historiker Ernest Renan denkt. Dessen berühmter Vortrag »Qu'est-ce qu’une nation?« (›Was ist eine Nation?‹)1 von 1882 ist bis heute eigentlich ein Klassiker und wurde vielfach nachgedruckt …
HMD: Das war seine Antwort auf den Nationalliberalen Treitschke, der die Bildung eines kleindeutschen Nationalstaats durch Preußen und die Annexion des Elsasses rechtfertigen wollte!
AW: Eine Antwort auf Treitschke, in der ein ganz anderer Nationsbegriff steckt. Renan stellt die Frage, ob die Nation eine Rasse sei. Doch das hält er für Unsinn, vielmehr seien die Nationen Mischvölker. Diese Mischungen speisten sich aus den verschiedensten Winkeln Europas, von einer Rasse im Sinne einer biologischen Abstammung könne keine Rede sein. Renan vertritt also genau die Antithese zu Treitschke. Ist es vielleicht die Religion, die eine Nation definiert?, so fragt er weiter. Auch diese Frage verneint er mit dem Verweis auf z. B. die Schweiz, in der es unterschiedliche Konfessionen gibt. Die Sprache ist für Renan ebenfalls nicht das Entscheidende, das finde ich interessant.
Also was ist es? Für Renan ist die Nation ein tägliches Plebiszit, also eine gewissermaßen zivilgesellschaftliche Entscheidung, wozu man gehören will. Wenn man das so sieht, waren die Elsässer natürlich in der Zwickmühle. Nicht immer wussten sie in der Geschichte, ob sie sich nach Frankreich oder nach Deutschland orientieren sollten, wenngleich die deutsche Herrschaft von 1871 bis 1918 sowie von 1940 bis 1944 eher unpopulär war.
Jedenfalls ist die Vorstellung, man heiße ursprünglich »Monsieur Lagarde« und ende als »Monsieur Q«, schon bitter. Kann man sagen, dass das elsässische Drama für die deutsch-französische Geschichte symptomatisch ist?
HMD: Ja, und im Grunde ist das Elsass ein typisches Kontaktgebiet. Wenn wir uns nämlich fragen: Wer sind die Deutschen? Wer sind die Franzosen?, wird klar, dass man dem Schicksal der Geografie nicht entkommen kann. Da sind zwei Nachbarn, die durch die Geografie zum Zusammenleben verurteilt sind und die eine gemeinsame Geschichte haben in dieser Kontaktzone. Dazwischen ist das Elsass tatsächlich diese Kontaktzone im Herzen Europas.
Vielleicht macht die Sprache, wie Renan sagte, nicht die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv aus, gleichwohl gibt es Unterschiede in diesem Herzen Europas. Unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen mit Bräuchen und Traditionen, die dort in solchen Kontakt- und Austauschgebieten nebeneinander bestehen, und genau das ist die Geschichte, die uns heute in diesem Gespräch interessiert. Dabei sollten wir uns bewusst machen, dass diese Zugehörigkeiten, die dann in Staaten organisiert worden sind, auch Konstruktionen und vor allem Geschichtserzählungen sind. Es hat sich dort nicht nur eine Realität entwickelt, sondern die Menschen haben sich auch diese Geschichte erzählt und damit ihre eigene Entwicklung geformt.
AW: Aber ich möchte noch einmal insistieren: Als Nicht-Franzose würde ich durchaus sagen, dass Frankreich ein Problem mit dem Elsass hat. Die Elsässer haben ihre Identität mit ihrer dem Deutschen sehr nahe verwandten Muttersprache nicht richtig entwickeln dürfen. Sind nicht die Elsässer in ihrer kulturellen Identität von Frankreich und seinem Zentralismus überwiegend unterdrückt worden? Schon seit sie über die Reunionspolitik Ludwigs XIV. im 17. Jahrhundert ins französische Territorium aufgenommen wurden, dann aber vor allem im Zeitalter der Nation, also im 19. und 20. Jahrhundert?
HMD: Nein, so würde ich das nicht sagen. Die Identität vorwiegend auf die Sprache, also ein kulturelles Element, stützen zu wollen, ist ein sehr deutscher Reflex. So haben sich viele Elsässer auch in der deutschen Zeit (1871–1918), jedenfalls nach dem Modell von Renan, nicht unbedingt als Deutsche verstanden. Vielmehr wurde das Elsass »Reichsland«, also Teil des Deutschen Reichs. Aber zugleich wurde es diskriminiert, indem es keinen Teilstaat wie die anderen im Reich bildete, sondern unmittelbar dem Kaiser unterstellt war. Die große Mehrheit der elsass-lothringischen Bevölkerung fühlte sich von Deutschland gegen ihren Willen annektiert und lehnte das ab …
AW: … und hat sich dann definitiv auf die Seite Frankreichs gestellt.
HMD: Einige Elsässer optierten 1871 für Frankreich. Bei den verbliebenen war es kompliziert. Preußische Verwaltungsbeamte, die ins Reichsland kamen, waren von der Tatsache beeindruckt, dass viele Elsässer, die gar kein Französisch sprechen konnten, sich trotzdem gefühlsmäßig Frankreich zugehörig fühlten. Es gibt etliche Zeugnisse dieser Art. Die 15 elsässisch-lothringischen Reichstagsabgeordneten wurden als »Protestler-Abgeordnete« bezeichnet und verlangten vergebens ein Referendum über die staatliche Zugehörigkeit des Reichslandes. Vor allem fand die Identitätsfrage ihren Ausdruck im elsässischen Regionalismus. Dieser Regionalismus war eine Form des Widerstands gegen die Politik der Germanisierung und eine Methode, sich von jedem politischen oder kulturellen Monopol zu befreien.
Dahinter steckt das Problem, dass wir die Frage, was die Deutschen oder die Franzosen seien, gar nicht stellen können. Der Plural suggeriert vor allem, es gebe eine unwandelbare Natur der als Kollektiv gedachten Völker. Ich glaube aber, dass diese deutsch-französische Geschichte, die zum Teil auf Erzählungen wie dem Mythos der Erbfeindschaft beruht, in Wahrheit viel mehr Schattierungen hat. Es hat in der Geschichte nicht nur eine Gegnerschaft gegeben, auch wenn die Gegnerschaft ein integraler Bestandteil der eigenen Identitätskonstruktion gewesen ist.
AW: Ja, das war für die deutsche Geschichte genauso prägend. An der deutschen Nationalbewegung können wir das deutlich sehen. Bevor wir darauf kommen, möchte ich noch eine letzte Bemerkung zum Elsass machen. Ein schmerzhaftes, ja geradezu tragisches Beispiel aus der französischen Debatte ist Oradour. In diesem Ort im Limousin fand 1944 das schlimmste Kriegsverbrechen der SS im besetzten Frankreich statt. Das kleine Dorf Oradour-sur-Glane wurde von einer Waffen-SS-Einheit förmlich als Geisel genommen, die gesamte Bevölkerung in überwiegender Abwesenheit der jungen Männer in der Dorfkirche eingesperrt und ermordet. Es gab weit über 200 Tote in der in Brand gesetzten Kirche. In dieser Einheit der Waffen-SS haben sich auch einige Elsässer auf deutscher Seite an dem Massaker beteiligt. Für den Umgang der französischen Erinnerungspolitik mit Oradour war das höchstproblematisch. Was sind die Elsässer? Eigentlich sollten sie ja Franzosen sein, aber offensichtlich verhielten sie sich in jenem Augenblick wie Feinde der Franzosen.
HMD: Ja, das hat die Erinnerung und das Gedenken in Frankreich erschwert. Was Oradour betrifft, war es jahrzehntelang unmöglich, sich vor Ort mit den Elsässern zu versöhnen. Es wurde im Limousin insbesondere bezweifelt, dass elsässische Mitglieder dieser Waffen-SS-Panzerdivision »Das Reich« zwangsinkorporiert waren, was sie zu sogenannten Malgré-nous (Mitwirkenden ›gegen unseren Willen‹) gemacht hätte. Es war unmöglich, sich mit anderen Franzosen zu versöhnen, die doch Mittäter in den Diensten des grausamen Feindes gewesen waren.
Aber kehren wir ins Jahr 1870/1871 zurück. Ich glaube, wir können mit Recht von einer gemeinsamen deutsch-französischen Geschichte sprechen, von einem deutsch-französischen Krieg. Deutsch-französisch bedeutet sowohl deutsch gegen französisch also auch eine gemeinsam erlebte und dann gedeutete Geschichte. Es ist in der Tat schwierig, diese zwei Bevölkerungen in Europa künstlich voneinander zu isolieren. Zugleich aber müssen wir bedenken, dass diese ganz besondere Geschichte von zwei Nachbarn ihre eigene Dynamik hatte. Insofern erzählt sie auch vieles über Europa und dessen schwierige Nachbarschaften. Wir sollten also nicht der Versuchung nachgeben, das Verhältnis Deutschland – Frankreich als Modell und als eine einzigartige Beziehung in Europa zu überhöhen. Es hat durchaus seine Besonderheiten, die uns interessieren. Zugleich aber sollten wir nicht so tun, als ob es ein solches Modell nirgendwo anders geben könnte.
AW: Dennoch sind Deutschland und Frankreich paradigmatisch für ein größeres Ganzes. Ihre Nachbarschaft verdeutlicht, dass sich ganz Europa in einer ständigen Austauschbeziehung über die Grenzen von Sprache und Kultur hinweg entwickelt hat. Und vielleicht haben Deutschland und Frankreich am Ende doch eine besondere Rolle gespielt, immerhin ist ihr Verhältnis zueinander ja bis heute von besonderer Bedeutung. Schließlich sind die beiden Nationalstaaten auf dem Kontinent – vor 1870/71 war das natürlich in Deutschland anders – die bedeutendsten, zumindest waren sie das in dieser kritischen Phase zwischen 1850 bzw. 1870/71 einerseits und 1945 andererseits. Insofern kann man schon fragen, ob da nicht etwas Besonderes geschehen ist. Auch finde ich die Frage interessant, inwiefern das Beispiel der deutsch-französischen Beziehungen zwischen Gegnerschaft und Versöhnung und zwischen Kooperation und Kollaboration im Zweiten Weltkrieg als Modell dienen kann. Könnte man die Erfahrungen, die aus diesem Drama folgten, vielleicht sogar auf andere Weltregionen übertragen? In andere Weltteile exportieren, in denen es langfristige geschichtliche Spannungen gibt, in Nordostasien etwa mit seinen historisch belasteten Beziehungen zwischen Japan, China und Korea?
HMD: Wenn man sich aber wieder auf den historischen Gegenstand konzentriert, fällt auf, dass sich die Konstruktion der deutschen Nation vor der Nationalstaatsgründung 1871 durchgehend sehr stark aus der Feindschaft gegenüber Frankreich speiste. Aus der Forschung ist bekannt, dass die eigene Identitätsbildung (etwa in einer Nation) ein Gegenüber erfordert, also ein Anderes bzw. eine Alterität. Ohne die Gegnerschaft bzw. den Hass auf die Franzosen ist diese deutsche Nationsbildung eigentlich nicht vorstellbar.
AW: Ein berühmtes Beispiel dafür ist Ernst Moritz Arndts 1813 erschienene Schrift Über Volkshaß, in der er den Hass als notwendigen Teil des deutschen Zu-sich-selbst-Kommens beschreibt. Der Hass wird darin zu einer Art Schutzwehr gegen das Eindringen des Fremden oder des »Anderen«:
Es ist eine unumstößliche Wahrheit, daß alles, was Leben und Bestand haben soll, eine bestimmte Abneigung, einen Gegensatz, einen Haß haben muß, daß, wie jedes Volk sein eigenes innigstes Lebenselement hat, es ebenso eine feste Liebe und einen festen Haß haben muß, wenn es nicht in gleichgültiger Nichtigkeit und Erbärmlichkeit vergehen und zuletzt mit Unterjochung endigen will. Ich könnte traurig hinweisen, wodurch die letzten Jahre über Teutschland gekommen sind. Wir liebten und erkannten das Eigene nicht mehr, sondern buhlten mit dem Fremden.2
Nun gehörte es aber zu der historischen Entwicklung in Europa, dass Frankreich schon früher ein Nationalstaat gewesen war, schon im Ancien Régime war es das in gewisser Weise: Zudem erhob die Französische Revolution einen neuen Nationsbegriff zum Träger staatlicher Souveränität, den die Deutschen so nicht haben konnten. Bei ihrer Revolution 1848 fehlte ihnen noch der Staat dazu. Diese Ungleichheit änderte sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
HMD: Um die Vorgeschichte des Krieges von 1870/71 zu verstehen, muss man allerdings auch wissen, dass in Deutschland in sehr vielen Milieus der Eindruck vorherrschte, Frankreich sei, vor allem seit Ludwig XIV. (1638–1715), immer ein kriegerischer Staat gewesen, ein Staat, der es auf das deutsche Territorium abgesehen habe und dem endlich Grenzen gesetzt werden müssten.
AW: Ja. Das ist für die deutsche Nationsbildung prägend gewesen. Die Reunionspolitik Ludwigs XIV. war in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein großes Thema in der deutschen Öffentlichkeit, gerade in den gebildeten Schichten. Mit Reunionspolitik ist gemeint, dass Ludwig XIV. nach historischen Rechtstiteln suchte, die in seinen Augen Frankreichs territoriale Ansprüche auf das Elsass oder die drei Bistümer Metz, Toul und Verdun legitimierten. Diese Ansprüche versuchte er mit mehreren Kriegen bis hin zum Pfälzischen Erbfolgekrieg durchzusetzen. 1697 wurde mit dem Frieden von Rijswijk beschlossen, dass Elsass und Lothringen künftig zu Frankreich gehörten, allerdings vorläufig nur für 20 Jahre. Danach sollte der Status noch einmal geprüft werden, doch das ist dann in Vergessenheit geraten. So wurde auch Straßburg zu einer französischen Stadt, obwohl es zumindest als Universitätsstadt eine deutschsprachige Stadt gewesen war. Diese Vorgeschichte ist ziemlich wichtig für das Verständnis der deutschen Wahrnehmung Frankreichs.
HMD: Aus der französischen Sicht von damals sollte der Rhein die Grenze werden. Und das, was in Deutschland als Annexion von Straßburg und dem Elsass empfunden wurde, war in der französischen Sprache die »Reunionspolitik«. Was heißt Reunion? Gemeint war das Wiedervereintsein, also die Wiederherstellung eines früheren Zustandes. Nur was ist der Bezugspunkt, wenn man etwas wiederherstellen will, das es früher gegeben hat? Man könnte bis zum Vertrag von Verdun im Jahre 843 zurückgehen, als das Reich Karls des Großen zwischen seinen Enkeln geteilt wurde. Danach nahmen Ostfranken wie Westfranken das Gebiet dazwischen (Lothringen) für sich in Anspruch. Dabei war im 17. Jahrhundert auch den Franzosen völlig klar, dass Straßburg im Mittelalter eine freie Reichsstadt gewesen war, und niemand konnte leugnen, dass im Elsass eine eher deutsche Kultur gepflegt wurde usw.
Du hast völlig recht damit, diese Vorgeschichte zu erwähnen, denn wenn wir als angeblichen Anfangspunkt einer deutsch-französischen Erbfeindschaft den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 nennen, vergessen wir, dass es diese lange Vorgeschichte gibt. Sowohl in den Kriegshandlungen als auch in der Symbolik einiger Akte wird auf frühere Traumata und erlittene Annexionen verwiesen.
AW: Wobei natürlich diese deutsche Darstellung Ludwigs XIV. und des absolutistischen Frankreichs als »Raubstaat« auch etwas Heuchlerisches hat. (HMD: Ja!) Im Grunde handelt es sich um eine charakteristische, nachträglich vorgenommene Konstruktion im Zeitalter des Nationalismus, die mit den tatsächlichen Verhältnissen in der Frühen Neuzeit nicht so viel zu tun hatte. In der Frühen Neuzeit gab es zahlreiche Tausch- oder auch Eroberungspläne, an denen sich auch die deutschen Staaten – Preußen vorneweg – rege beteiligten. Damals war die Frage, welcher Sprache oder welcher Kultur eine bestimmte Bevölkerung angehörte, sekundär. Sie war nicht bedeutungslos, aber es gab davon unabhängig viele Ideen, wie man Territorien für sich reklamieren konnte. Fast immer ging es um die Inanspruchnahme älterer Rechtstitel. Die regelmäßig erhobenen dynastischen Ansprüche etwa führten fast ebenso regelmäßig zu Erbfolgekriegen. Und das geschah zunächst einmal unabhängig davon, welcher Nation die jeweilige Bevölkerung angehörte. Aber auch die unverblümte Annexionspolitik gehörte zum Repertoire der frühneuzeitlichen Mächte, wenn man etwa an die polnischen Teilungen zwischen 1772 und 1795 denkt. Preußen erhielt auf diese Weise seine Ostprovinzen, in denen nicht nur polnische Minderheiten lebten, sondern sogar die Mehrheit der Bevölkerung polnisch war.
Insofern ist es höchst problematisch, die Kategorie der Nation einfach auf die Frühe Neuzeit zurückzuprojizieren, und das gilt erst recht für das 17. Jahrhundert und die Reunionspolitik Ludwigs XIV. Eine nationale Vorstellung von Deutschland gab es damals gar nicht, jedenfalls nicht von Deutschland als geschlossenem Staat. Stellt man sich Deutschland einfach als Opfer dieser französischen »Raubüberfälle« im 17. Jahrhundert vor, dann führt das in die Irre.
HMD: Aber diese Vorstellung spielt eine Rolle, wenn wir vom Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 erzählen wollen. Im französischen Sprachgebrauch ist beispielsweise nie die Rede von einem »Deutsch-Französischen Krieg«, sondern man sagt in Frankreich la Guerre de 70, ›der Krieg von 1870‹. Es wird also diese deutsch-französische Komponente, diese Gegnerschaft, nicht betont. Oder sie ist als Demütigung so eingebrannt, dass sie nicht genannt zu werden braucht. Viel stärker in der Erinnerung geblieben ist das Trauma von Versailles, nämlich der Umstand, dass nach der französischen Niederlage der deutsche Feind am 18. Januar 1871 ausgerechnet den Spiegelsaal im Schloss des Sonnenkönigs Ludwigs XIV., das Herzstück der französischen Monarchie, entweihte. Nicht nur hatte der Feind so schnell den Krieg gewonnen, er wagte es auch, genau dort das Deutsche Kaiserreich zu proklamieren.
Es ist kein Zufall, dass jene Inszenierung gerade in diesem Raum stattfand. Die deutsche Reichsgründung, die Erhebung Wilhelms I. von Preußen zum deutschen Kaiser Wilhelm I. sollte genau im schönsten Saal des Schlosses von Versailles stattfinden. Das war eindeutig die Absicht der deutschen Seite, und die Botschaft wurde sehr gut verstanden in Paris wie auch in ganz Frankreich. Nicht nur in Deutschland wurde das Gemälde von Anton von Werner berühmt, das man in allen Schulbüchern sieht. Im Grunde handelt es sich dabei interessanterweise um die dritte Fassung, auf der Bismarck mit weißer Uniform in der Mitte steht.
AW: Ein Fake …
HMDex negativo