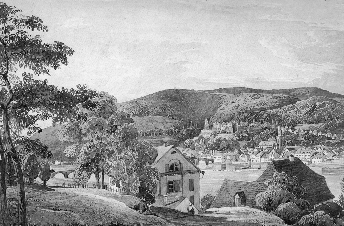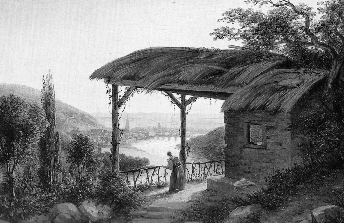ROSE GRANDISSON
GEFANGEN IN HEIDELBERG
Michail Krausnick
ISBN: 978-3-95428-708-6
1. Auflage 2019
© 2011 Wellhöfer Verlag, Mannheim
Titelgestaltung: Uwe Schnieders, Fa. Pixelhall, Mühlhausen
Das Umschlagbild verwendet das Porträt von Jacques-Louis David: Portrait de Madame Récamier ou Portrait de Juliette Récamier (1800)
Das vorliegende Buch einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig.
info@wellhoefer-verlag.de
www.wellhoefer-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt
- Vorbemerkung
- Stadtdirektor und Untersuchungsrichter Dr. Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts Heidelberg 1814
- Heidelberg, im April 1814. Johannes Berger, Sekretär des Stadtdirektors Dr. Pfister, schreibt an seinen Bruder Berthold in Leipzig
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im April 1814. Johannes Berger, Sekretär des Stadtdirektors Dr. Pfister, an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Mai 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, Pfingsten 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Mai 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Mai 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Erste Ankunft der Grandissons in Heidelberg
- Heidelberg, im Mai 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Glanzvolle Wiederkehr der Familie Grandisson im Jahre 1810
- Heidelberg, im Mai 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Mai 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Juni 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts 1814
- Heidelberg, im Juni 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Juni 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts 1814
- Heidelberg, im Juni 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Juni 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Juli 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Heidelberg, im Juli 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im August 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Juli 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Juli 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Juli 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im Juli 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im August 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im August 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im August 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im September 1814. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Heidelberg, im März 1815. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Heidelberg, im Mai 1815. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Heidelberg, im Juni 1815. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Heidelberg, 16. Juni 1815. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Heidelberg, Ende Juni 1815. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- Heidelberg, im September 1815. Johannes Berger an seinen Bruder Berthold
- Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
- ZEITTAFEL
- RÄUBERFÄNGER UND METTERNICHS »BLUTHUND«
- NACHWORT
- QUELLEN
- Dokumente der Zeit
- Weitere Literatur
rekonstruiert nach dem Aktenmäßigen Bericht »Carl Grandisson« der Merkwürdigen Criminalfälle des Dr. Ludwig Aloys Pfister, Untersuchungsrichter und Stadt-Director zu Heidelberg 1816
Die Ros’ ist ohn’ warum.
sie blühet, weil sie blühet.
sie acht’ nicht ihrer selbst,
fragt nicht, ob man sie siehet ...
Angelus Silesius
Vorbemerkung
Der historische Roman Rose Grandisson bewegt sich zwischen Dichtung und Wahrheit, zwischen Gefundenem und Erfundenem. Erzählt wird der authentische Kriminalfall des Hochstaplers und Meisterdiebs Grandisson und seiner Frau und Komplizin nach dem Aktenmäßigen Bericht des Untersuchungsrichters Dr. Ludwig Pfister. Das gnadenlose Verhörduell mit der engelhaft schönen Gefangenen wechselt ab mit empfindsamen Briefen seines Sekretärs Johannes Berger. So erleben wir die Geschichte einer außergewöhnlichen Liebe aus zwei Perspektiven: romanhaft-romantisch und realistisch-dokumentarisch.
Ort des Geschehens ist Heidelberg um 1815, das Hauptquartier der alliierten Kaiser, Könige und Fürsten im Entscheidungskampf gegen Napoleon.
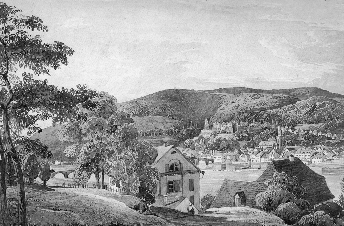
J. Ruf, Heidelberg im 19. Jhdt.
Stadtdirektor und Untersuchungsrichter Dr. Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts Heidelberg 1814
Madame Grandisson, nicht ahnend, dass sie unter schärfster Beobachtung stand, machte sich bald schon in hohem Maße selbst verdächtig. Wir waren dahintergekommen, dass sie sich von ihrem Hauswirte, dem Handelsmann M., dessen Siegel zum Verschluss ihrer Briefe ausgeliehen hatte, um deren ungehemmten Abgang zu sichern. Daher ließen wir auf dem Postamt sofort sämtliche Briefe mit dem M.’schen Siegel abgreifen und nach verdächtigen Adressaten durchsuchen. Nur diese konfiszierten und erbrachen wir.
Endlich wurde einer ihrer nach Berlin gesandten Briefe abgefangen. Er gewährte einen hellen Blick in die äußerst seltsamen Verhältnisse dieser bis dato hochangesehenen Heidelberger Familie und dazu einen Wink, der zur vollsten Entdeckung und der Katastrophe führte.
Heidelberg, den 1. May 1814
Mein liebster Carl,
es sind heute 13 Tage, dass du mich verließest, und noch habe ich keine Nachricht von dir.
Ich hoffe aber, dass du glücklich bei den Deinigen angekommen bist.
Schreibe mir die Nummer vom Hause, wo ich meine Briefe hin adressieren soll; das Übrige weiß ich recht gut.
Höre: ich habe überlegt, wie wäre es, wenn ich meine Sachen fest einpackte, und sie zu verwahren gäbe, und nur das Notwendigste mit mir nähme, bis ich bestimmt wüsste, wo ich bliebe; denn ich glaube nicht, dass ich zu den Deinigen passe:
Ihre Rohheit, Unersättlichkeit habe ich noch in frischem Andenken.
Bei den Deinigen will und werde ich keineswegs, nicht mal eine Nacht, wohnen. Dann wünsche ich mir auch, dass Du mir eine Reise-Route aufsetztest, von Station zu Station, Du weißt, dass ich des alles ganz unkundig bin.
Was ich den Postillons an Trinkgeld gebe, weiß ich wohl; just so viel, als was ein Pferd scheißt. War es nicht so?
Sobald ich Nachricht von Dir habe, werde ich meinem Wirte die Wohnung aufsagen und mir einen Pass holen. Ich werde wohl kaum noch drei Monate hier ohne Dich bleiben.
Ich missfalle mir von Tag zu Tag mehr hier; ich werde nach und nach meine Sachen in Ordnung bringen und alles nett einpacken.
In den großen Koffer packe ich unten Wäsche und oben darauf das Silberzeug ...
Höre! Noch eins: Miete mir doch lieber gleich eine Wohnung bei braven, honetten Leuten, damit, wenn ich ankomme, ich bei Dir und an Deinem Herzen sein kann. Alles ist hier ruhig. Lebe wohl!
Die Kinder grüßen und küssen Dich von ganzem Herzen. Meine Sehnsucht nach Dir ist unendlich.
Rose
Madame konnte nicht ahnen, dass sie uns mit diesem Brief die Spur wies, den Aufenthaltsort und das Versteck ihres Mannes verriet und damit die Festnahme ermöglichte.
Die äußere Adresse lautete nämlich:
An Herrn Prinz in der Königsstraße zu Berlin.
Das war aber nur der Umschlag. Auf dem eigentlichen Briefe stand als Adresse:
Mademoiselle Caroline wird ersucht, diesen Brief an ihren Herrn Bruder Carl abzugeben.
Carl Grandisson war also in Berlin, er hatte dort eine Schwester. In Berlin würde man ihn finden. Ein Haftbefehlsersuchen ging allsogleich an das Königlich-Preußische Polizeipräsidium zu Berlin ab.
Wir baten darin, durch vorsichtige Maßnahmen sofort die Festnahme des verdächtigen Grandisson zu bewirken, uns nach Erfolg sogleich davon in Kenntnis zu setzen, seine Papiere, Wertgegenstände und Effecten in Verwahrung zu nehmen, das aktenmäßige Resultat des Verhörs mitzuteilen und am Ende die Auslieferung des Verhafteten nach Heidelberg, an sein forum domicilii, erfolgen zu lassen. Denn hier, nur hier!, kann und muss dem feinen Monsieur und seiner gefeierten Gattin der Prozess gemacht werden.
An die Hochfürstliche Ober-Postamts-Direktion schrieben wir am selbigen Tage:
Gelingt es, wie ich hoffe, den Verbrecher in Berlin, oder einem anderen seiner Schlupfwinkel zu erhaschen, so wünsche ich, dass mir unmittelbar nach Arretierung Nachricht gegeben werde, damit ich unverzüglich zur Festnahme seiner Ehefrau schreiten kann.
Doch muss ich um höchste Diskretion und Verschwiegenheit bitten.
Hier mag selbst ich mich aus Gründen der Geheimhaltung noch keiner Kanzley-Person, keinem Schreiber oder Sekretär anvertrauen.
Nur gänzliche Stille kann uns zum Erfolg führen.
Ich werde indessen fortfahren, Madame Grandisson auf Schritt und Tritt zu beobachten, um im entscheidenden Momente zuschlagen zu können.
Die Aufmerksamkeit auf die hochstaplerische Gattin wurde nach Abgang dieses Schreibens verdoppelt. Wir ordneten eine lückenlose Überwachung durch unsere Agenten an.
An ihrem Wesen bemerkten wir zunächst keine Veränderung. Sie hatte ja keine Ahnung, dass ihr Brief von uns abgefangen war.
Die glanzvolle Rolle, die Madame und Monsieur so viele Jahre in unserer Stadt gespielt hatten, war durch schwerste Anschuldigungen zernichtet. Der Zauber einer edlen Bildung, welcher die engelhaft schöne Frau bislang umschwebt hatte, war nun (leider?) endgültig versunken. Sie erschien uns als eine ordinäre Person und mutmaßliche Komplizin, wenigstens zum Teil in die Geheimnisse ihres Mannes eingeweiht. Schließlich war sie ja schon dabei, in aller Stille ihre Schätze einzupacken, um heimlich aus Heidelberg zu entweichen. Sie hatte also Grund zu fliehen.
Gefahr war im Verzug.
Heidelberg, im April 1814. Johannes Berger, Sekretär des Stadtdirektors Dr. Pfister, schreibt an seinen Bruder Berthold in Leipzig
Lieber Berthold,
stelle Dir eine Luft vor, so mild und schwer, dass sie das Herz schnürt, denke Dir einen Fluss, der das bewaldete Gebirge kraftvoll durchdringt, um sich in die Ebene zu ergießen. An dem Ufer hoch droben am Hang die Ruine der uralten Schlossburg, darunter eine Stadt mit Häusern aus Sandstein gebacken. Und während Euer grauer Norden noch mit dem Winter im Streite liegt, ist hier bereits Lenz, blüht es allerorten, erquickt mich die zauberhafteste Kulisse – Heidelberg! – Mein Herz ist weit geöffnet. Wird es hier wieder lieben lernen? Genug.
Ich bin trotz deutscher Schneckenpost gut angekommen und werde morgen vom Stadtdirektor Dr. Pfister zu einem ersten Gespräch erwartet. Ein wenig bangt mir, ob ich dem Amt gewachsen sein werde. Hauptsekretär? Sein letzter ist ihm davongelaufen. Doch davon später.
Eine recht angenehme Reisebekanntschaft war mir ab Hersfeld vergönnt: Felix von Rödern, ein vornehmes siebzehnjähriges Bürschlein. Der junge Herr stammt aus einem alten

Friedrich Rottmann, Heidelberg vom Osten 1810
Adelsgeschlecht im Königreich Hannover und will an der Ruperto Carolina italienische Literatur, aber auch Musik und, wie die meisten, Jurisprudenz studieren. Nicht um einen Brotberuf zu ergreifen, sondern lediglich um – wie er sagt – seine Kenntnisse zu erweitern. Kavalierstour nennt man das. Der junge Herr reist in Begleitung seines Lehrers, eines Rittmeisters von der Linden. Die beiden hatten einen Radbruch mit ihrer Kutsche und mussten auf die Extrapost umsteigen.
Auf den Poststationen in Hünfeld, Gelnhausen und besonders im Kutschengewimmel der großen Frankfurter Poststation kamen wir in nähere Bekanntschaft. Ganz im Gegensatz zum Rittmeister ist der artige Jüngling entflammt für unsere deutsche Sache und träumt von einem starken und mächtigen Reich, in dem der Bürger nicht mehr der Willkür der Mächtigen ausgesetzt ist. Er redet mit mir wie mit seinesgleichen, hört geduldig zu, schneidet das Wort nicht ab. Und lacht freimütig über die modernen Hofschranzen, die sich nach der großen Revolution zwar allesamt die Zöpfe abgeschnitten hatten, das Speichellecken aber fleißig fortführten. Er kennt sie von oben. Wie ich von unten. Und denkt trotz des Standesunterschieds fast wie ich.
In Darmstadt haben wir gemeinsam von dem allhier beliebten Apfelwein bestellt, aber beide die saure Brühe halbvoll stehen gelassen.
Der Rittmeister, ein würdiger Herr mit angegrauten Schläfen, zeigte sich mir gewogen, besonders, als er hörte, dass ich im Büro des Stadtdirektors Dr. Ludwig Aloys Pfister eine Stelle in Aussicht habe. Mein Schicksal stehe unter einem guten Stern, bemerkte er. Er schätze Pfister als einen gewitzten Juristen und tatkräftigen Beamten. Wenn wir mehr Männer seiner Art in den deutschen Staaten hätten, wäre es rasch vorbei mit dem Räuberunwesen.
Offenbar hatte der Rittmeister Pfisters Werk über die Räuberbanden im Spessart und Odenwald gelesen. Denn umständlich erzählte er, was ich schon wusste, mir aber geduldig mit anhörte: die Geschichte des Überfalls.
Wir passierten gerade die Stelle zwischen Laudenbach und Hemsbach, an der vor drei Jahren die grässliche Attacke auf zwei Schweizer Kaufleute stattfand: an der Bergstraße zwischen Obstbäumen und Weinbergen.
»In such a night!«, sagte der Rittmeister mehr zu Felix als zu mir und wies aus dem Wagenfenster.
Im fahlen Mondlicht huschten die Schatten der Bäume wie Gespenster an uns vorbei.
»In ebensolcher Nacht und bei einem Vollmond wie diesem schlummerten nicht weit von hier nichtsahnend die beiden Seidenwarenhändler in ihrer Kutsche. Sie kamen von der Frankfurter Messe und hatten gute Geschäfte gemacht. Plötzlich ein Rumpeln, Rütteln und Schwanken wie auf hoher See. Die Kaufleute stieß es von den Sitzen. Koffer und Kisten und edle Stoffe – alles wirbelte durcheinander.
Was war geschehen?
Die ruchlosen Mörder waren den schnaubenden Pferden in die Zügel gefallen. Hölzerlips, der Stärkste von allen, hatte die Kutsche zum Stehen gebracht. Mit übermenschlicher Kraft! Hier, an der Straßenbeuge etwa, könnte es gewesen sein. Schauderhaft!«
Der Rittmeister schob den Vorhang beiseite und schaute in die Nacht hinaus. »In such a night!«
»Und dann?«, fragte Felix. Seine Augen hatten sich geweitet. Der Rittmeister fuhr mit schmerzlicher Miene fort: »Dann haben die Mordgesellen die Kutsche geplündert und mit ihren Knüppeln die ehrbaren Handelsherren blutig und blau geprügelt. Mit der Folge, dass einer von ihnen fünf Tage darauf im Heidelberger Hospital verstorben ist. Am Peterskirchhof wollen wir dem Opfer einen Strauß Blumen auf den Grabstein legen.«
In Weinheim mussten die Pferde gewechselt werden.
Felix war erleichtert, dass wir das Räuberrevier hinter uns hatten. Der Wirt empfing uns mit einer Handlaterne und bat zu Pfannkuchen und Bier in die Gaststube der Posthalterei. Der Rittmeister bedauerte zum wiederholten Male, seinen jungen Herrn in Heidelberg alleinlassen zu müssen. Doch werde er zu Karlsruhe in der Residenz Seiner königlichen Hoheit erwartet, um mit dem Abgesandten des Großherzogs die Zukunft der linksrheinischen Besitztümer zu erörtern. Nach dem Ende Napoleons gebe es für den Kongress in Wien jetzt mancherlei in die Wege zu leiten.
Er wünsche sich, sagte er vertraulich, als sich Felix bereits in die Kutsche zum Schlafen gelegt hatte, dass ich seinem jungen Herrn in der fremden Stadt zur Seite stehen möge. Er sei als ein zu früh Geborener von schwächlicher Konstitution, und – fast noch im Knabenalter – wenig erfahren in ungewohnter Umgebung. Die üblichen Gefahren des Branntweins und des Tabakrauchens brauche man bei ihm noch nicht zu befürchten. Auch werde er den Lockungen der allzu freundlichen Mädchen gewiss nicht erliegen. Sorge machten dagegen die rohen Scherze der studierenden Burschen und die Brutalität der altdeutschen Turner. Daher wäre es ihm eine große Beruhigung, in dieser Zeit einen lebensgewandten Ratgeber in der Nähe seines Schützlings zu wissen. »Und eine geöffnete Rathaustür!«, lachte er und hob die angegrauten Augenbrauen. »Versprechen Sie mir das und Sie gewinnen einen Freund und Förderer Ihrer Karriere.«
Vierspännig ging es im Morgengrauen über den Neckar und durch das Brückentor hindurch. In der Posthalterei verabschiedeten wir uns und ich machte mich auf den Weg in mein Quartier.
Mein Chef, der Stadtdirektor Dr. Pfister, dem ich heute meine Aufwartung machte, ist eine eindrucksvolle Erscheinung. Der hochgerühmte Räuberfänger residiert in seinem schmucken Büro wie ein Napoleon und sagt immerzu »meine Stadt«. Er hat eine erstaunliche Machtfülle, leitet die Verwaltung, ist Herr der Polizei und der Gerichtsbarkeit. Seit Napoleon vor zehn Jahren den Südwesten neu ordnete, wurde auch hier vieles reformiert. Manches allerdings geht wohl noch kreuz und quer zwischen dem alten und dem neuen Recht. Denn alle Macht geht nunmehr ja von Karlsruhe aus.
Aber wie lange noch?
Der Thron des Großherzogs wackelt. Seine Herrlichkeit stand zu lange auf der falschen, auf der französischen Seite. Während Pfister mit mir sprach, stand er an seinem Amtstisch, über das Modell einer neuartigen Mausefalle gebeugt. Ein Kunsttischler hatte sie getreu nach seinem Entwurf angefertigt. Der Mäuseplage in Heidelberg wolle er damit ein für allemal den Garaus machen. Und er diktierte mir zur Probe meiner Schreibkunst gleich einen Artikel für das Wochenblatt in die Feder. Wenn jeder Haushalt mit einer solchen Falle ausgestattet sei, wäre viel gewonnen im Kampf gegen die diebischen Nager. Er denke auch, Napoleon zu Ehren, an eine scharf geschliffene, automatische Guillotine für die Neckar-Ratten.
Der Direktor geriert sich überhaupt als ein Wohltäter der Menschheit. Von der Jurisprudenz ist er geradezu besessen. Sein kriminalistischer Spürsinn wird allüberall gerühmt. Sogar von Hebel, dem »Rheinischen Hausfreund«, und in den Göttinger Gelehrten Anzeigen. Er habe nicht nur die Spessart- und Odenwaldräuber unter das Schwert, sondern auch manchen anderen armen Teufel an den Galgen gebracht, heißt es. Kein Wunder, dass ihn die armen Leute in der Vorstadt mit angstvollem Respekt den Kopf-ab-Pfister nennen.
Diesmal, deutete er mir an, diesmal sei er einem ganz außerordentlichen Verbrechen auf der Spur, einem Criminalfall, der in mehreren deutschen Staaten spiele und weithin für Furore sorgen werde. Näheres freilich verriet er nicht, sondern machte ein Mysterium daraus. Bevor er mir die Akten der Frankfurter Oberpostdirektion zur Einsicht überließ, musste ich ihm hoch und heilig versichern, kein Sterbenswörtchen weiterzugeben, um den Erfolg der Ermittlungen nicht zu gefährden.
Ludwig Aloys Pfister. Merkwürdiger Criminalfall nach den Akten des Gerichts
7. April 1814 – Großherzogliches Stadtamt Heidelberg
Beginn der geheimen Criminal-Untersuchung gegen Carl Grandisson und Complicen.
Wie ein Blitzschlag erschütterte uns an diesem Tage eine Nachricht, die ein völlig neues Licht auf die seit Jahren glanz- und ehrenvoll in Heidelberg domicilierende Familie Grandisson warf und uns zu polizeilichen Ermittlungen zwang. Unser allseits geschätzter Mitbürger war wieder einmal verreist, mit unbekanntem Ziel, als ein Schreiben aus Frankfurt eintraf. Beigefügt waren diverse Berichte, Amtshilfeersuchen an Polizeibehörden etc., aus denen wir den Inhalt in Kürze angeben.
Die Fürstlich Thurn und Taxis’sche Ober-Post-Amts-Direction Frankfurt
an den Großherzoglich-Badischen Herrn Stadt-Director Pfister zu Heidelberg
Zwey sehr bedeutende Postwagen-Diebstähle haben einen sehr gegründeten Verdacht auf einen unter verschiedenen Namen mitreisenden Passagier geworfen, und uns veranlasst, auf diesen äußerst verdächtigen Menschen aufmerksam zu machen.
Indem wir Euer Wohlgeboren ersuchen ... etc.
In Kürze:
Der Thurn und Taxis’sche Postwagen war innerhalb zweier Jahre auf der großen Tour zwischen Frankfurt und Eisenach mindestens zwei Mal bestohlen worden. Wohlverwahrte und verschlossene Geldpakete waren aus den Kisten verschwunden, welche im Inneren des Wagens befestigt waren. Das erste Mal, am 13. Oktober 1812, waren sämtliche nach Frankfurt bestimmte Geldpakete, das zweite Mal, am 14. Februar 1814, aus dem Wagen von Frankfurt nach Eisenach ein Paket mit 4947 Gulden und 20 Kreuzern entwendet worden.
Der Verdacht fiel auf einen bestimmten Passagier, dessen der Kutscher und Andere sich wohl entsannen, der aber jedes Mal unter einem andern Namen gereist und eingeschrieben war. Bei dem ersten Diebstahl war er unter dem Namen Griesbach in der Postwagencharte eingezeichnet. Griesbach war auf der Tour plötzlich verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Erst nach der Ankunft der Kutsche in Frankfurt war der Diebstahl entdeckt worden. Als man im Februar 1814 bei der Ankunft in Eisenach den zweiten Diebstahl entdeckte, entsann man sich, dass ein Reisender mit Namen Walter mit jenem Griesbach eine außerordentliche Ähnlichkeit gehabt habe, die auf eine Identität schließen lasse.
Auch habe der Polizey-Inspector Lorenz aus Eisenach diesen Menschen mit den vielen Pässen des Öfteren kontrolliert und schon länger im Verdacht gehabt, dass er ein französischer Spion sei. Doch hätten die politischen Verhältnisse damals eine Verhaftung verhindert.
Bei weiteren Nachforschungen ergab sich, dass derselbe Walter am 7. Februar 1814 auf einer Reise von Frankfurt nach Kassel gefahren und dann am 12. wieder unter einem andern Namen, und zwar als Schloßbrück, von Kassel nach Frankfurt zurückgereist sei. Am 24. kam der nämliche Passagier unter dem Namen Rose von Fulda in Frankfurt an, schrieb sich im Pariser Hofe als Kaufmann Groß aus Karlsruhe in das Fremdenbuch ein und fuhr am folgenden Tage in Gesellschaft zweier angeblich französischer Employés mit einem Lohnkutscher nach Heidelberg.
Wäre dieser beständige Namenswechsel nicht allein schon verdächtig genug gewesen, so war es das Betragen dieses Griesbach und Walter während der Reise um so mehr. Die Fahrposten halten gewöhnlich recht lange auf den Stationen an; die Reisenden steigen gern zur Erholung aus und werden auch dazu genötigt. Die verdächtige Person zögerte aber des Öfteren und musste durch die Conducteurs nachdrücklich zum Verlassen der Kutsche aufgefordert werden. Während der Conducteur mit Abgabe und Übernahme der Posteffecten beschäftigt war, sah man diese Person fast nie in den Gaststuben bei den anderen Passagieren. Mehr als einmal fand man ihn ganz allein am Wagen stehend, wo er ohne Erlaubnis die Tür zu öffnen versuchte.
Den geheimen Nachforschungen der verschiedenen Polizeibehörden war es gelungen, den Faden noch weiterzuspinnen. Es fand sich, dass dieselbe vielnamige Person am 18. Februar zu Eisenach im Gasthof zum Anker unter dem Namen Grandisson gewohnt und ein Paket mit 50 Gulden unter eigener Adresse nach Heidelberg auf die Post gegeben hatte. Dieses Paket war in Heidelberg richtig an eine Madame Grandisson abgeliefert worden.
Der Passagier Griesbach, Walter, Rose, Groß, Schloßbrück und Grandisson ist auf jeden Fall ein für die öffentliche, wie für die Privat-Sicherheit sehr gefährlicher Mensch.
Ob und inwiefern der in Heidelberg domicilierende Grandisson eine und die nämlich Person mit dem gefährlichen und verdächtigen Subjekte sey?
Dieß ist nun der Gegenstand der näheren Untersuchung Euer Wohlgeboren.
Wir haben die Ehre, die Versicherung der vollkommenen Hochachtung zu bezeugen ...
Frankfurt, den 7. April 1814
Das uns zugesandte steckbriefliche Signalement des verdächtigen Passagiers stimmte aufs Genaueste mit der Persönlichkeit des in Heidelberg wohlbekannten Handelsherrn Carl Grandisson überein. Außerdem wollte auch der Kutscher, von dessen Wagen das letzte Paket entwendet worden, den Menschen, auf den er Verdacht hatte, in Heidelberg schon einmal gesehen haben.
Von diesen Verdachtsgründen waren wir so vollkommen überzeugt, dass wir, ungeachtet des Ansehens und Reichtums der Familie, sofort zur Festnahme geschritten wären, wenn Carl Grandisson sich zu dieser Zeit in Heidelberg befunden hätte.
Es galt also länder- und städteübergreifend durch Korrespondenzen und reitende Boten ein polizeiliches Netz aufzubauen, um den gesuchten Verdächtigen zu finden und einzufangen. Dies erfordert heute weit mehr Geschick und Diplomatie, da uns seit dem Sturz Napoleons – zum Glück der Menschheit und der Moralität – keine kaiserlich-französische Geheime Polizei mehr zur Verfügung steht. Ein desto schwierigeres Unterfangen für den untersuchenden Richter. Unsere Briefe gingen nicht nur an die benachbarten Regierungsbehörden, sondern auch an die Polizei-Obrigkeiten in Eisenach, Kassel, Karlsruhe, Würzburg, Nürnberg und Berlin.
Am besten wäre es, wenn wir uns möglichst schnell in den Besitz eines Porträts von Carl Grandisson bringen könnten, um es in Kupfer zu stechen und vervielfältigt den Signalements beizufügen. Denn ein mit dem Konterfei des Verdächtigen bebilderter Steckbrief würde unsere Nachforschungen auf den Poststationen und in allen deutschen Ländern wesentlich beschleunigen. Wir wussten von einem früheren Besuch bei den Grandissons, dass in der Halle seiner Wohnung ein pompöses Ölporträt an der Wand hing. Aber wie an dieses Bild gelangen, ohne einen Eklat zu erregen oder die Verdächtigen zu warnen?
Eine andere Frage war: ob wir schon vor der Habhaftwerdung des Hauptverbrechers seine Gattin Rose gefangen nehmen durften? Denn was hatten wir in der Hand gegen sie, eine Dame der besten Gesellschaft?
Eine alte aktenmäßige Geschichte, die ihren Ruf antastete, war längst vergessen. – Wir werden später noch auf die zwielichtige Affäre zurückkommen. Ihr jetziger Leumund aber war tadellos: Rose Grandisson galt als eine bescheidene, liebenswürdige Ehefrau, die, nur für ihre Kinder und den Gatten lebend, jedes Aufsehen vermied.
Nun ergab sich aber durch einen abgefangenen Brief eines gewissen Herrn H. aus D. an Grandisson ein neuer Verdacht, dass wir es nicht nur mit einem einzelnen Spitzbuben, sondern womöglich sogar mit einem abgefeimten Gaunerpaar zu tun haben könnten.
Der Brief enthielt eine Warenbestellung von 50 Pfund Tabak, die uns vermuten ließ, dass die Grandissons (die ja kein Geschäft besaßen) sich aus dem Spezereyladen ihres Hauswirthes oder seinem Warenlager im Gewölbekeller heimlich bedienten. Und auf Befragen räumte der gutmütige Hauswirt ein, dass er durchaus gelegentlich Fehlbestände an Tabak, Wein, Kaffee, Gewürzen und anderen Waren zu beklagen habe, wollte sich aber auf keinen Verdacht festlegen. Die Grandissons zahlten immer pünktlich und direkt, und gerade erst habe Madame ihm ihre Kutsche für eine Reise nach Straßburg ausgeliehen.
Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Milde und Schonung einer in den höchsten Kreisen angesehenen Hausfrau und Mutter und der polizeilichen Pflicht, mit aller Strenge ihre Beteiligung an der ruchlosen Beraubung des eigenen Hauswirts aufzuklären, entschieden wir uns, diese Frage vorerst einmal offen zu lassen, um die wichtigeren Ermittlungen wegen der Postdiebstähle nicht zu gefährden. Andererseits: Wenn ihr Mann erwiesenermaßen ein Verbrecher war, musste sie es denn auch sein? Konnte er nicht auch sie wie so viele Andere getäuscht haben? Zwar schien sie bei einer Anfrage über die lange Abwesenheit ihres Mannes etwas verlegen, aber sie machte zunächst ja noch keine verdächtigen Anstalten zur Flucht. Würde sie plötzlich arretiert, so musste es ihr Mann erfahren. Oder ein vorschneller Schritt konnte sie veranlassen, ihn zu warnen, und alsdann war die Hoffnung, einen so gewitzten Verbrecher einzufangen, vereitelt.
Wir beschlossen daher, einstweilen nicht mehr zu tun, als Madame mit aller Vorsicht beobachten zu lassen, und baten den Hauswirt um Verschwiegenheit.
Heidelberg, im April 1814. Johannes Berger, Sekretär des Stadtdirektors Dr. Pfister, an seinen Bruder Berthold
Lieber Bert,
inzwischen habe ich mich am Neckar eingelebt. Ich bin ständig auf dem Amt unter dem strengen Diktat meines Herrn und Meisters, habe für Privates kaum noch Muße. Nur hin und wieder treffe ich Felix von Rödern, meinen Reisegefährten, um mit ihm gemeinsam die Stadt zu erkunden.
Heidelberg ist leicht zu merken für den Fremden: zwanzig Minuten lang und vier Minuten breit. Behenden Schrittes, versteht sich. Mit Felix habe ich das ganz genau ermessen. Die einzige durchgehende Straße heißt von alters her Hauptstraße, sinnigerweise, und führt vom Karlstor im Osten zum Mannheimer Tor im Westen. Zum Süden kannst Du nicht entfleuchen, da hindert Dich der Schlossberg, zum Norden plumpst Du in den Neckar. Ein idealer Laufstall für Studenten, sagt mein Chef, da gehe selbst ein Trunkener nicht verloren.
Die Hauptstraße hat jetzt sogar Laternen, damit die Akademiker auch des Nachts ihre Wirtshäuser finden. Die feinen Herren kommen aus allen Ländern, denn Heidelberg ist Mode neuerdings. Die meisten sind Adelspack und recken ihre Nasen, wenn die nicht im Glase stecken, sehr hoch. Sogar auf der Gasse paffen sie lange Pfeifen und führen ihre Hunde zum Geschäfte. Manche tragen angeberisch Gala-Uniform und einen Degen an der Hüfte. Oder die Burschenschafter ihre altdeutsche Tracht, sehr schick, mit Barett, ganz in schwarz und mit weißem Hemdkragen – das hat man in unserer Zeit noch nicht gewagt. Hin und wieder singen sie ihre vaterländischen Gesänge, aber meistens ist es nur Gebrüll und Gejohle. Trotzdem sehr nett und munter. Kurz: Du musst unbedingt zu Besuch kommen!
Felix und ich waren auch schon im Weinberg auf der Visavis-Seite des Neckars, von wo man einen trefflichen Blick auf Fluss, Brücke, Stadt und Schlossruine zugleich hat.
Diesen Philosophenpfad, wie ihn die Studenten nennen, lässt Dr. Pfister gerade zu einem befestigten Weg für die Fremden ausbauen. »Auch für Fürsten und höhere Standespersonen!« Er ist sehr stolz auf dieses Projekt. Von hier oben habe einst der geniale Matthäus Merian seine Stadtansicht gezeichnet. Du erreichst die Höhe nur mühsam über einen geschlängelten Weg durch den Weinberg, der uns gehörig in die Waden ging.
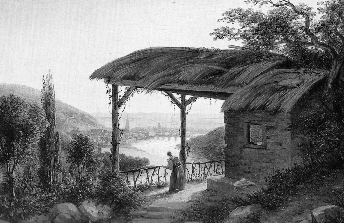
C.Ph. Koester, Blick auf Heidelberg
Bei solchen Spaziergängen erzähle ich meinem jungen Begleiter gern von meinem Chef und seinen Kriminalfällen, von den Räuberbanden und den Betrügern, den Kindsmörderinnen und den widerborstigen Studenten. Pfister schreibt alle merkwürdigen Verbrechen fein säuberlich auf, das heißt, er diktiert und lässt schreiben – manchmal wie ein Pedant, mal wie ein Poet. Er wolle das Publikum unterhalten, aber auch jungen Kriminalisten auf die Sprünge helfen. Und verdient ein gutes zusätzliches Geld damit. Ganz Deutschland liest seine Aktenmäßigen Berichte.
Der Herr Direktor genießt es, dass er mich als Lehrbuben im Sold hat und ich zu ihm aufschauen muss. Auch meint er, mich mit Vornamen anreden zu dürfen, da ich sein Sohn sein könne, und tut dies einfach, ohne mir Gelegenheit zum Widerspruch zu lassen. Ständig soll ich »seinen lieben Johannes« spielen. Aber wie mich zur Wehr setzen gegen solch einen Chef? Und schon heißt es: »Johannes hier, Johannes da.«
Felix ist ein eigenartiges Kerlchen und sicher nicht typisch für seine Standesgenossen. Schon gar nicht als Student. Er raucht nie, trinkt nie. Macht sich auch nichts aus amourösen Tändeleien, will nichts wissen von den Röcken der schönen Heidelberger Mädchen.
F. Rottmann, Bierhellen bei Heidelberg, Tanz auf der Kerwe 1805
Kerwe
Aber ich fürchte doch sehr, dass mir bis dahin irgend so ein hochwohlgeborener Student die schöne Anna vor der Nase wegschnappt. Die Studenten jagen ja alleweil den Wirtstöchtern nach und versuchen, zwischen ihre Schenkel zu gelangen, fahren sogar in die Dörfer Bergheim und Rohrbach zum Walzen hinaus. Dieser sinnenbetörende Tanz ist sicher auch bei Euch jetzt modern. Man kommt leicht außer Atem. Aber die hiesigen Mädchen sind gewarnt und wissen um ihren Wert. Die oberen Lippen öffnen sie recht gern, hört ich sagen, wenn der Studiosus sie nach dem Tanze brav nach Hause führt.