

DAS BUCH
Als er sich dem Eingang näherte, hielt Napoleon inne und drehte sich um, dann hob er die Hände und winkte zur Menge, ein strahlendes Lächeln auf dem von dunklem Haar gerahmten Gesicht. Die Leute stießen Freudenschreie aus und wogten auf die Kette der Grenadiere zu, die sich unter dem Druck ausbuchtete. Die Stiefel der Männer scharrten über die Pflastersteine, als sie sich dem Ansturm entgegenstemmten und die Leute mit den Läufen ihrer Musketen zurückstießen.
Napoleon wandte sich ab und schritt weiter auf das hohe Kirchenportal zu. Als er an Talleyrand vorbeikam, neigte er den Kopf in Richtung des Außenministers.
»Die Leute scheinen einverstanden zu sein.«
»Ja, Sire.«
»Und bereitet Ihnen meine Entscheidung, die Ehre anzunehmen, noch immer Kopfzerbrechen?«
Talleyrand zuckte leicht mit den Achseln. »Nein, Sire. Sie genießen das Vertrauen der Leute, und ich bin sicher, sie werden dafür sorgen, dass Sie es nicht enttäuschen.«
Napoleons Lächeln erstarb, und er nickte bedächtig. »Heute sind Frankreich und ich eins. Wie kann es da Widerspruch geben?«
»Wie Sie meinen, Sire.« Talleyrand neigte den Kopf und deutete unauffällig zum Eingang. »Ihre Krone wartet auf Sie.«
DER AUTOR
Simon Scarrow wurde in Nigeria geboren und wuchs in England auf. Nach seinem Studium arbeitete er viele Jahre als Dozent für Geschichte an der Universität von Norfolk, bevor er mit dem Schreiben begann. Mittlerweile zählt er zu den wichtigsten Autoren historischer Romane. Mit seiner großen Rom-Serie und der vierbändigen Napoleon-Saga feiert Scarrow internationale Bestsellererfolge.
Besuchen Sie Simon Scarrow im Internet unter
www.simonscarrow.co.uk
Simon Scarrow
FEUER UND SCHWERT
DIE NAPOLEON-SAGA 1804–1809
Aus dem Englischen von
Fred Kinzel
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die englische Originalausgabe
Fire and Sword
erschien 2009 bei Headline Review, London.
er Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 10/2020
Copyright © 2009 by Simon Scarrow
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München, unter Verwendung von Motiven von © Arcangel Images / Jordi Bru
Umsetzung Ebook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-23648-9
V002
www.heyne.de
Für Murray, Gareth und Mark
in der Hoffnung, dass wir mit Glynne mithalten können!
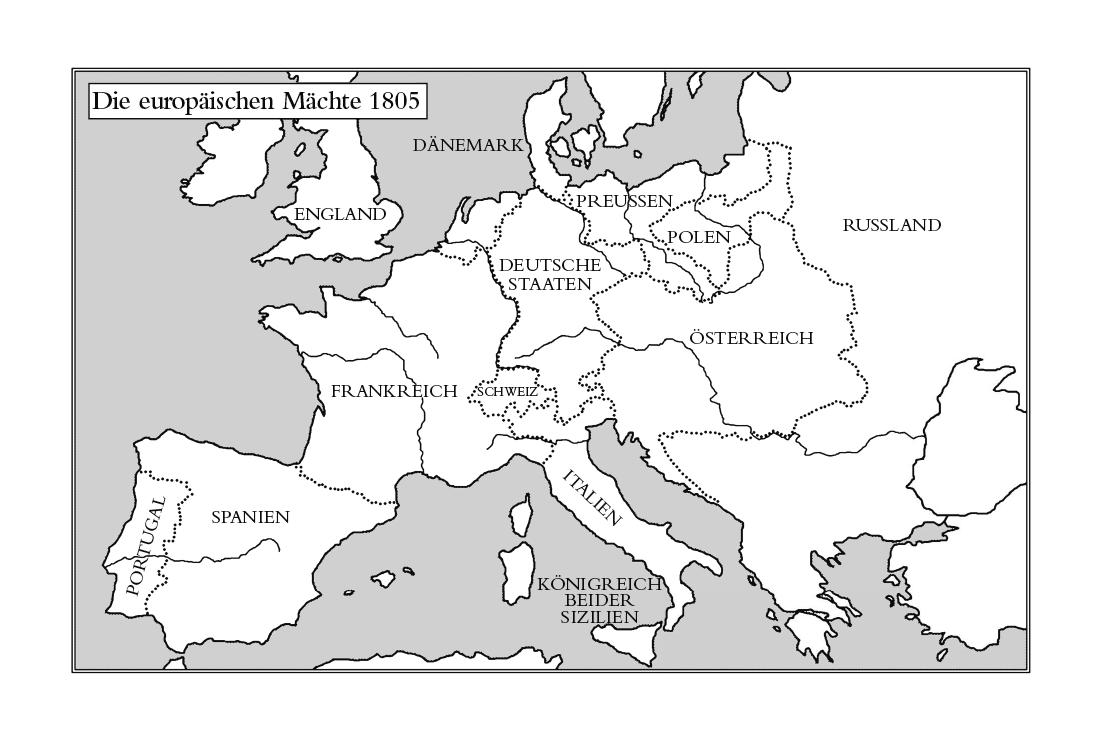
Paris, Dezember 1804
Als Napoleons Kutsche vor Notre-Dame hielt, brach die riesige Menschenmenge, die in der Kälte gewartet hatte, in Jubel aus, der von der mächtigen grauen Fassade widerhallte. Die Gebäude, welche früher die große Kathedrale umgeben hatten, waren abgerissen worden, um Platz für die Krönungsprozession zu schaffen, und die Bürger von Paris drängten sich in dem von den kaiserlichen Grenadieren abgeriegelten Bereich. Die Soldaten standen zwei Reihen tief entlang der gesamten Route, und ihre hohen Bärenfellmützen raubten den Leuten größtenteils die Sicht, sodass sie nur gelegentlich einen Blick auf die reich verzierten Kutschen und die Passagiere in ihren Festgewändern erhaschten. Zwischen den Kutschen trabten Schwadronen von Kürassieren, deren lederne Brustpanzer so sorgfältig poliert waren, dass sie ihre Umgebung verzerrt widerspiegelten. Der Kaiser, seine Gemahlin und die kaiserliche Familie, die Minister und Marschälle fuhren in mehr als vierzig eigens für die Krönung angefertigten Kutschen. Noch nie hatte Paris dergleichen gesehen, und Napoleon war es mit einem Streich gelungen, allen Pomp und alle Pracht der Bourbonen in den Schatten zu stellen.
Er lächelte zufrieden bei diesem Gedanken. Während die französischen Könige ihre Krone einer zufälligen Abstammung verdankten, hatte Napoleon die seine durch Können, Mut und die Liebe des französischen Volkes erlangt. Es war das Volk, das ihm die Kaiserkrone geschenkt hatte, in einer Abstimmung, bei der ihm nur einige Tausend Seelen in ganz Frankreich ihre Unterstützung versagten. Im Gegenzug hatte ihnen Napoleon Siege und Ruhm geschenkt, und sein Kopf war bereits voller Pläne, diesen Ruhm weiter zu mehren.
Es gab eine kurze Verzögerung, als zwei aufwendig gekleidete Diener mit einer kleinen Treppe geschwind zur Kutsche liefen und die Tür aufzogen. Napoleon, der in erhabener Einsamkeit auf der mit Seide bezogenen Bank saß, holte tief Luft, stand auf und erschien in der Tür der Kutsche. Seine grauen Augen schweiften über das Meer der hingebungsvollen Gesichter, und seine Lippen öffneten sich zu einem Grinsen. Wieder brandete gewaltiger Jubel auf, und hinter den Reihen der Grenadiere wurden Arme und farbenfrohe Federhüte geschwenkt.
Napoleon sah sich um und entdeckte Talleyrand, seinen Außenminister, der mit den übrigen Ministern am Eingang der Kathedrale stand und missbilligend die Stirn runzelte. Napoleon konnte sich ein leises Kichern angesichts des Unbehagens nicht verkneifen, das den Aristokraten wegen des kaiserlichen Mangels an Schicklichkeit befiel. Nun, dann missbilligte er es eben, dachte Napoleon. Das alte Regime existierte nicht mehr, die Revolution hatte es hinweggefegt, und an seine Stelle war eine neue Ordnung getreten. Eine Ordnung, die auf dem Willen des Volkes gründete. Napoleon war dankbar und hellsichtig genug, den Gruß der Menschen zu erwidern, und er drehte sich nach allen Seiten und winkte der darüber begeisterten Menge zu, ehe er aus der Kutsche stieg. Die Diener ergriffen unverzüglich die Schleppe seines goldbestickten roten Gewands und folgten ihm gemessenen Schritts über den Teppich zum Eingang der Kathedrale.
Wie die meisten Gäste war auch seine Familie bereits ins Innere der Kirche und zu ihren festgelegten Plätzen geführt worden. Die Minister und hohen Staatsdiener würden dem Kaiser folgen und die prestigeträchtigsten Plätze im Zentrum der Zeremonie einnehmen. Ursprünglich hatte Napoleon beabsichtigt, seine Generäle in die Kirche zu führen, aber sein Bruder Joseph und Talleyrand hatten ihn bedrängt, die Krönung als eine vorwiegend zivile Feier zu begehen. Auch wenn Napoleon mithilfe der Armee zum Machthaber Frankreichs aufgestiegen war, musste er sich der Welt als politischer und nicht als militärischer Führer präsentieren. Talleyrand hegte immer noch die Hoffnung, einen dauerhaften Frieden in Europa erreichen zu können, wenn sich die anderen Mächte überzeugen ließen, dass der neue Kaiser in erster Linie Staatsmann und erst in zweiter Feldherr war.
Nach so vielen Jahren des Krieges hatte der kurzlebige Vertrag von Amiens beim Volk Appetit auf Frieden und Stabilität geweckt. Vor allem Stabilität, was die Einsetzung einer neuen, dauerhaften Regierungsform bedeutete. Napoleon hatte den Boden dafür geschickt bereitet, indem er sich vom Konsul zum Ersten Konsul und dann zum Ersten Konsul auf Lebenszeit ernennen ließ, bevor er dem Volk die Gelegenheit gab, seinem Verlangen nach der Besteigung eines neuen Throns zuzustimmen. Natürlich hatten es die Senatoren als notwendiges Mittel verkleidet, die Republik vor ihren äußeren und inneren Feinden zu schützen, doch die Republik gab es nicht mehr. Sie war in den Geburtswehen des Kaiserreichs gestorben. Schon hatte sich Napoleon mit einem schrillen Panoptikum von Adligen umgeben und den Einfluss von Senatoren, Tribunen und Volksvertretern beschnitten. Und es gab Pläne, eine Vielzahl neuer Adelstitel und Auszeichnungen zu vergeben, um das neue Regime zu stützen. Napoleon hoffte, dass das Kaiserreich mit der Zeit von den übrigen europäischen Mächten akzeptiert werden und diese aufhören würden, Franzosen für Mordanschläge auf ihn zu bezahlen.
Als er sich dem Eingang näherte, hielt Napoleon inne und drehte sich um, dann hob er die Hände und winkte zur Menge, ein strahlendes Lächeln auf dem von dunklem Haar gerahmten Gesicht. Die Leute stießen Freudenschreie aus und wogten auf die Kette der Grenadiere zu, die sich unter dem Druck ausbuchtete. Die Stiefel der Männer scharrten über die Pflastersteine, als sie sich dem Ansturm entgegenstemmten und die Leute mit den Läufen ihrer Musketen zurückstießen.
Napoleon wandte sich ab und schritt weiter auf das hohe Kirchenportal zu. Als er an Talleyrand vorbeikam, neigte er den Kopf in Richtung des Außenministers.
»Die Leute scheinen einverstanden zu sein.«
»Ja, Sire.«
»Und bereitet Ihnen meine Entscheidung, die Ehre anzunehmen, noch immer Kopfzerbrechen?«
Talleyrand zuckte leicht mit den Achseln. »Nein, Sire. Sie genießen das Vertrauen der Leute, und ich bin sicher, sie werden dafür sorgen, dass Sie es nicht enttäuschen.«
Napoleons Lächeln erstarb, und er nickte bedächtig. »Heute sind Frankreich und ich eins. Wie kann es da Widerspruch geben?«
»Wie Sie meinen, Sire.« Talleyrand neigte den Kopf und deutete unauffällig zum Eingang. »Ihre Krone wartet auf Sie.«
Napoleon richtete sich zu voller Größe auf, fest entschlossen, so königlich auszusehen, wie es seine schmächtige Statur gestattete. Er war seit über vier Jahren auf keinem Feldzug mehr gewesen, und das gute Leben, das er genoss, hatte ihn ein wenig rundlicher werden lassen. Josephine war so taktlos gewesen, bei mehr als einer Gelegenheit darauf hinzuweisen und ihn sanft in die Seite zu stupsen, wenn sie einander in den Armen lagen. Bei dem Gedanken wurde ihm leicht ums Herz, und er warf einen Blick durch das Portal der Kirche den Mittelgang hinunter, wo sie sitzen musste. Neun Jahre waren seit ihrem Kennenlernen vergangen, zu einer Zeit, da er zum ersten Mal ins Licht der Öffentlichkeit getreten war. Sie hatte unmöglich ahnen können, dass der schlanke Brigadegeneral mit dem glatten Haar eines Tages der Herrscher über Frankreich sein würde, geschweige denn, dass sie als Kaiserin an seiner Seite thronen würde. Napoleons Herzschlag beschleunigte sich vor Stolz auf seine Leistungen. Am Anfang hatte er befürchtet, sie könnte zu gut für ihn sein und es nur allzu schnell erkennen. Doch sein Aufstieg zu Ruhm und Wohlstand hatte ihre Furcht zum Verstummen gebracht, und obwohl er Josephine liebte, wie er nie eine andere Frau geliebt hatte, begann er sich inzwischen zu fragen, ob sie seiner würdig war.
Napoleon atmete ein letztes Mal tief die kühle Luft ein, dann betrat er Notre-Dame. In dem Moment, in dem er die Schwelle überschritt, fing am anderen Ende der Kathedrale ein Chor zu singen an, und die Teilnehmer der Zeremonie erhoben sich unter dem Rascheln von Gewändern und dem Scharren von Stuhlbeinen. Ein dunkelgrüner Teppich erstreckte sich vom Eingang bis zu dem Podest vor dem Altar, auf dem der Papst stand und wartete. Das Lächeln des Kaisers erstarb beim Anblick des Heiligen Vaters. Trotz seiner Bemühungen, die Rolle der katholischen Kirche in Frankreich zu verringern, hing das gemeine Volk hartnäckig an seiner Religion, und Napoleon hatte den Segen des Papstes benötigt, um seiner Krönung den Anschein göttlicher Zustimmung zu verleihen.
Sowohl das Podium als auch der Altar waren neu. Zwei alte Altäre sowie eine kunstvoll geschnitzte Chorschranke waren abgerissen worden, um einen eindrucksvolleren Raum im Herzen von Notre-Dame zu schaffen. Links und rechts neigten Staatsmänner, Botschafter, Offiziere und Sprösslinge der Pariser Gesellschaft das Haupt, als der Kaiser vorbeischritt. Seine Hand glitt zum Knauf des Schwerts von Karl dem Großen, das man aus einem Kloster in Aix-la-Chapelle herbeigeschafft hatte, um Napoleons Regalien zusätzlichen Glanz zu verleihen. Auch das gehörte zu den Anstrengungen, um der Krönung das Gewicht jahrhundertealter royaler Traditionen zu verleihen. Ein neuer Karl der Große für eine neue Zeit, überlegte Napoleon, als er aus der Allee aus Seide und Hermelin trat, in der die Juwelen der Damen funkelten und die goldenen Tressen und Orden der Generäle und Marschälle Frankreichs leuchteten. An ihrer Spitze stand Murat, der schmucke Kavallerieoffizier, der mit Napoleon bei Marengo gekämpft und später Caroline, die Schwester seines Generals, geheiratet hatte. Sie lächelten sich kurz zu, als der Kaiser an ihm vorbeiging.
Papst Pius VII. saß auf einem Thron vor dem Altar. Hinter und neben ihm war sein Gefolge aus Kardinälen und Bischöfen, hell erleuchtet von den Lichtstrahlen, die durch die hohen Fenster fielen. Napoleon trat vor die drei Stufen, die auf das Podest führten. Bei einem Blick nach links sah er seine Brüder und Schwestern. Der noch junge Louis konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, aber Joseph nickte ernst, als sein Bruder vorüberschritt. Es war eine Schande, dass nicht seine ganze Familie anwesend sein konnte, dachte Napoleon. Jérôme und Lucien waren in Ungnade gefallen, nachdem sie sich geweigert hatten, ihre Ehefrauen zugunsten von Frauen aufzugeben, die Napoleon für geeigneter hielt, um in den kaiserlichen Haushalt aufgenommen zu werden. Napoleons Mutter Letizia fehlte ebenfalls. Sie beteuerte, zu krank zu sein, um Italien verlassen und an der Krönung teilnehmen zu können. Napoleon hatte sich von ihren Ausreden nicht täuschen lassen. Sie hatte ihre Abneigung gegen Josephine von Beginn an sehr deutlich gezeigt, und ihr Sohn zweifelte nicht daran, dass Letizia eher verdammt sein wollte, als mit anzusehen, wie Josephine zusammen mit Napoleon gekrönt wurde. Hätte nur sein Vater diesen Tag noch erlebt. Carlo Buonaparte hätte seine widerborstige Frau zur Vernunft gebracht.
Napoleon nahm aus dem Augenwinkel Bewegung wahr, und er sah den Maler Jean-Louis David auf der anderen Seite der Kathedrale ein frisches Blatt dickes Papier auf sein Zeichenbrett legen, damit er eine weitere Skizze des Ereignisses anfertigen konnte. Napoleon hatte ein Monumentalgemälde in Auftrag gegeben, das die Krönung darstellen sollte, und David hatte ihm mitgeteilt, dass es drei Jahre dauern könne, bis das Werk fertiggestellt sei. Das heutige Schauspiel, dachte Napoleon, würde seinen Glanz wahrhaftig durch die Jahrhunderte verbreiten.
Der Papst erhob sich von seinem Thron und streckte eine Hand in Richtung Napoleon aus. Der Kaiser beugte ein Knie und ließ es auf einem reich bestickten Kissen ruhen, das vor dem Pontifex lag. Der Chorgesang erstarb, Stille senkte sich auf den Kirchenraum, und der Papst begann, mit hoher, dünner Stimme seinen Segen zu sprechen; die Worte schallten durch die Kathedrale und hallten dumpf von den Wänden wider.
Während der Heilige Vater mit seinem Sprechgesang fortfuhr, starrte Napoleon unverwandt auf den Teppich vor sich, da ihn plötzlich der Drang zu lachen überfiel. Trotz allen Prunks, trotz der prächtigen Kostüme und der kunstvoll ausgeschmückten Kulisse, trotz der monatelangen Vorbereitungen und der wochenlangen Proben erschien ihm dieser Augenblick der religiösen Zeremonie als in hohem Maße lächerlich. Der Gedanke, dass ausgerechnet er göttlichen Segen nötig hatte, war nicht nur lachhaft, sondern beleidigend. Fast alles, was er erreicht hatte, war das Ergebnis eigener Anstrengung. Den Rest verdankte er blindem Glück. Die Vorstellung, Gott lenke die Flugbahn jeder Musketen- oder Kanonenkugel auf dem Schlachtfeld, war absurd. Religion war für Napoleon das Gebrechen der Geistesschwachen, Leichtgläubigen und Verzweifelten. Es war eine Schande, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen an solchem Aberglauben festhielt. Aber es war auch zu seinem Vorteil. Solange er ein Lippenbekenntnis zu den religiösen Empfindungen seiner Untertanen ablegte, konnte er die Kirche als weiteres Mittel nutzen, um sie zu beherrschen. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, seine Bedürfnisse mit denen des Papsttums zu versöhnen.
Für den Moment gab sich Napoleon damit zufrieden, in den Augen der Leute ein Einvernehmen mit der Kirche erreicht zu haben, und er kniete mit gesenktem Haupt, während die Worte einer ausgestorbenen Sprache über ihn hinweggingen. Er blendete sie aus und konzentrierte sich auf die Rolle, die er zu erfüllen haben würde, wenn der Papst mit seinem Segen fertig war. Es würde keine Messe geben, in diesem Punkt war Napoleon unnachgiebig gewesen. Alles, was noch kam, würde seiner persönlichen Machtbefugnis entspringen. Keinem anderen als Napoleon selbst stand es zu, Napoleon zu krönen. Und Josephine, wenn er schon dabei war. Auch sie würde die Krone aus seiner Hand empfangen.
Einen Moment lang wandte er seine Gedanken den anderen gekrönten Häuptern Europas zu. Er verachtete sie, weil sie solche Macht lediglich aufgrund ihrer Geburt innehatten. Genau wie all diese Aristokraten, die Napoleons Schulzeit zu einer solchen Qual gemacht hatten. Es gab jedoch ein Paradox, dachte er und biss sich leicht auf die Unterlippe. Nur durch das Prinzip der vererbten Regierungsgewalt genossen die Staaten Stabilität. Das wilde Blutvergießen der Französischen Revolution hatte bewiesen, wie nötig stabile Verhältnisse waren, und erst als Napoleon die Macht ergriffen und begonnen hatte, mit eiserner Faust zu regieren, war wieder Ordnung in Frankreich eingekehrt. Ohne Napoleon würde abermals Chaos ausbrechen, und deshalb hatte das Volk seiner Ernennung zum Kaiser nur zu gern zugestimmt. Es würde rechtzeitig einen Erben geben müssen. Er wandte den Kopf kurz zu Josephine. Sie fing seinen Blick auf und blinzelte.
Napoleon lächelte, obwohl er eine große Traurigkeit in seinem Herzen fühlte. Er hatte bisher keine Kinder gezeugt, und die Zeit lief Josephine davon. Bald würde sie zu alt sein, um ein Kind auszutragen. Plötzlich befiel ihn die Furcht, er könne zeugungsunfähig sein. In diesem Fall würde die Dynastie, die mit dem heutigen Tag begründet wurde, mit ihm sterben. Es war ein Gedanke, der ihn frösteln machte, und Napoleon verscheuchte ihn rasch wieder und richtete seine Überlegungen stattdessen auf die unmittelbareren Schwierigkeiten, die seine Stellung gefährdeten. Auch wenn auf dem Kontinent ein fragiler Frieden herrschte, lag Frankreich immer noch im Krieg mit seinem unversöhnlichsten Feind.
Auf der anderen Seite des Ärmelkanals widersetzten sich ihm die Briten weiterhin, vor seinem Zorn geschützt durch ihre Kriegsschiffe, die ohne Unterlass die Seewege kontrollierten und Napoleon den Triumph verwehrten, der seine Herrschaft über Europa vervollständigen würde. Schon dachte er über eine Invasion nach, und es gab Pläne für den Bau einer enormen Zahl von Landungsbooten in den Häfen und Marinestützpunkten an der französischen Küste, die England gegenüberlagen. Wenn die Zeit gekommen war, würde Napoleon eine große Schlachtflotte zusammenstellen und die britische Flotte aus dem Weg der Invasionsboote fegen.
War England erst einmal unterworfen und gedemütigt, würde es keine andere Nation mehr wagen, sich ihm zu widersetzen, überlegte Napoleon. Bis dahin würde er Österreich und Russland sorgsam im Auge behalten müssen, da seine Spione berichteten, sie würden selbst in diesem Augenblick bereits aufs Neue zum Krieg rüsten.
Plötzlich kam ihm zu Bewusstsein, dass der Papst zu sprechen aufgehört hatte und Stille herrschte. Napoleon murmelte rasch ein Amen und bekreuzigte sich, bevor er mit fragendem Blick den Kopf hob. Der Papst ließ sich soeben würdevoll in seinem reich verzierten Sessel nieder, die rechte Hand noch zur Segensgeste erhoben. Er fing den Blick des Kaisers auf und nickte leicht. Napoleon richtete sich auf und wäre fast gestolpert, da sich ein Teil seiner Schleppe unter seinem Fuß verfangen hatte. Er wahrte gerade noch das Gleichgewicht und tat mit einem unterdrückten Fluch den letzten Schritt auf das Podium. Neben dem Papst lagen auf einem kleinen vergoldeten Gestell die beiden Samtkissen mit den für den Kaiser und die Kaiserin angefertigten Kronen.
Napoleon näherte sich dem Gestell und hielt einen Moment lang inne, um die Ehrfurcht zum Ausdruck zu bringen, die dem Augenblick angemessen war. Dann streckte er beide Hände aus und ergriff den goldenen Lorbeerkranz der Kaiserkrone, die an die Cäsaren erinnern sollte. Er drehte sich langsam um und hielt sie in die Höhe, damit alle sie sehen konnten. Er holte tief Luft, und auch wenn er genau wusste, was er zu sagen hatte, schlug sein Herz laut vor nervöser Aufregung.
»Durch die mir vom Volk verliehene Macht nehme ich diese Krone und den Kaiserthron Frankreichs an. Ich gelobe allen Anwesenden bei meiner Ehre, dass ich die Nation gegen alle Feinde verteidigen und nach Gottes Willen im Einklang mit den Wünschen des Volkes und in seinem Interesse regieren werde. Möge dieser Augenblick die Größe Frankreichs versinnbildlichen. Möge diese Größe anderen Nationen als Leuchtfeuer dienen, und mögen sie sich uns in der Herrlichkeit des kommenden Zeitalters anschließen.«
Er hielt inne, dann hob er die Krone direkt über seinen Kopf und ließ sie langsam herabsinken. Der goldene Lorbeerkranz war schwerer, als er erwartet hatte, und er vergewisserte sich sorgfältig, dass er sicher saß, ehe er seine Hände wegzog. Sofort setzte der Chor auf dem Balkon hinter dem Altar ein und sang ein Stück, das zur Feier dieses Moments komponiert worden war. Napoleon hob leicht den Kopf und blickte über die Reihen der Gäste vor ihm. Ihre Mienen waren gemischt. Manche lächelten. Andere blickten ernst drein, wieder andere wischten sich Tränen aus den Augenwinkeln, überwältigt von der Erhabenheit des Augenblicks. Er blickte erneut zu Joseph und sah, dass die Lippen seines älteren Bruders verlegen zitterten, da er den Stolz und die Liebe zu unterdrücken versuchte, die er für Napoleon empfand. Es waren der Stolz und die Liebe, die er immer empfunden hatte, seit sie sich vor vielen Jahren ein Kinderzimmer in dem bescheidenen Zuhause in Ajaccio geteilt hatten, bevor die stolze korsische Familie mit Mühe das Geld aufgebracht hatte, um den Jungen eine anständige Erziehung in Frankreich zu sichern.
Napoleon gestattete sich ein kurzes Lächeln in Richtung seines Bruders, ehe sein Blick weiterwanderte, über die Reihen seiner Marschälle und Generäle, darunter viele, mit denen er seit Beginn seiner militärischen Laufbahn alle Gefahren und Abenteuer geteilt hatte. Tapfere Soldaten wie Junot, Marmont, Lannes und Victor. Männer, die er in den kommenden Jahren zu weiteren Siegen zu führen plante, falls die übrigen Mächte Europas es wagten, sich der neuen Ordnung in Frankreich zu widersetzen.
Als der Chor ans Ende des Liedes kam und verstummte, wandte sich der Kaiser an Josephine, und sie trat vor. Ihre Schleppe wurde von zwei für diese Ehre ausgewählten Freundinnen gehalten, nachdem sich Napoleons Schwestern der Aufgabe verweigert hatten. Wie ihr Gemahl trug sie eine schwere scharlachrote Robe, reich mit goldenen Motiven verziert, und auch wenn ihre Miene gefasst blieb, funkelten ihre Augen wie unbezahlbare Edelsteine, als sie anmutig zu den Stufen schritt und sich zu Napoleons Füßen auf das Kissen kniete. Sie neigte den Kopf und verharrte reglos.
Nach einer kurzen Pause räusperte sich Napoleon und sprach zum Publikum. »Es ist uns eine große Freude, die Krone der Kaiserin von Frankreich an Josephine zu vergeben, die uns lieb und teuer ist wie das Leben selbst.« Er nahm die verbliebene Krone und näherte sich seiner Frau, hielt den goldenen Reif über ihren Kopf und senkte ihn langsam auf die sorgfältig geflochtenen Zöpfe ihres braunen Haares. In dem Augenblick, in dem er einen Schritt von ihr zurücktrat, setzte der Chor mit dem Lied ein, das zu ihren Ehren komponiert worden war, und die melodiösen Stimmen trugen durch das gesamte Kirchenschiff. Napoleon beugte sich vor, ergriff Josephines Hände und zog sie zu ihrer vollen Größe empor, dann stieg sie auf das Podium, drehte sich um und stand an seiner Seite vor ihren Untertanen.
Die Zeremonie endete mit einem Gebet des Papstes, dann führte Napoleon seine Kaiserin die Stufen hinab und zurück zum Eingang von Notre-Dame. Als er an seinem Bruder vorbeikam, beugte er sich zu ihm und murmelte: »Ach, Joseph, wenn Vater uns jetzt nur sehen könnte!«
Manche Historiker betrachten die Kaiserkrönung Napoleons und seinen triumphalen Sieg bei Austerlitz als die Höhepunkte seiner erstaunlichen Karriere. Kaum zehn Jahre zuvor war er ein vergleichsweise unbeachteter Artillerieoffizier gewesen. Zu der Zeit, als er Kaiser wurde, war er der Herr über Europa und Befehlshaber einer Furcht einflößenden Kriegsmaschine. Und damit nicht genug – Napoleon war durch eine Kombination aus purer Begabung und sehr viel Glück auf den neuen Thron gelangt. Es ist außerdem wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass es eine überwältigende öffentliche Unterstützung für seinen Aufstieg vom Ersten Konsul zum Kaiser gab. Mit diesem Mandat ausgestattet, reformierte Napoleon die Verwaltung Frankreichs (und unbeabsichtigt eines großen Teils Europas) von Grund auf. Wenig entging der Aufmerksamkeit des arbeitssüchtigen Kaisers, der eine so große Spannbreite von Informationen abrufbar hatte, dass er seine Minister und Experten häufig mit seinen gründlichen Kenntnissen über deren jeweiliges Spezialgebiet verblüffte. Es steht außer Frage, dass viele der Veränderungen, die Napoleon am Regierungssystem Frankreichs vorgenommen hat, effektiv und notwendig waren. Immer stellte er sicher, dass eine Meritokratie in der Zivilgesellschaft ebenso gedeihen konnte wie beim Militär. Ich wünschte, es wäre mehr Raum in diesem Buch gewesen, um einige dieser Veränderungen detaillierter behandeln zu können, aber wie immer galt es, Entscheidungen zu treffen, wie viel davon aufgenommen werden konnte, und ohnehin lernte man einen großen Teil des positiven Vermächtnisses Napoleons erst in den Jahren nach seinem Sturz in vollem Umfang zu schätzen, womit die Sache außerhalb des Rahmens für dieses Werk liegt.
Natürlich gab es bei vielem, was er schuf, Hintergedanken. Napoleons Ruhmsucht bedeutete, dass er eine effiziente und hoch motivierte Gesellschaft zur Unterstützung der französischen Kriegsmaschinerie benötigte. In Verfolgung dieses Ziels duldete er keinen Widerstand, und es gab harte Sanktionen für alle, die das System korrumpierten oder sich weigerten, ihre Rolle zu spielen. Es besteht außerdem wenig Zweifel, dass die Macht, mit dem der neue Kaiserthron ausgestattet war, einen tief sitzenden Größenwahn verschlimmerte – ein Charakterzug Napoleons, den Talleyrand ganz richtig als die ernsteste Gefahr ansah, die Frankreich drohte. Napoleon glaubte immer, das Schicksal habe ihn zu Größe auserkoren. Infolgedessen schenkte er anderen Menschen und den Härten, denen er sie aussetzte, oft wenig Beachtung. Solche Menschen waren dazu da, seinen Interessen zu dienen. Dies schloss nicht nur seine Frau, sondern auch seine Brüder und Schwestern ein, die er als Werkzeuge benutzte, um seine Dynastie über Europa auszudehnen.
Der Liebling des Schicksals zu sein zeitigte einige unglückliche Konsequenzen für Napoleon. Zunächst einmal fiel es ihm zunehmend schwer zu akzeptieren, dass er nicht vor Fehlern gefeit war. Demgemäß lud er die Schuld an seinen Irrtümern bei Untergebenen ab; als Beispiel ist der Jagdunfall geschildert, für den er Berthier die Schuld gab. Zweitens war Napoleon so vollständig von seinem Genie überzeugt, dass er nicht ohne Weiteres delegieren konnte und häufig von einer Krise zur nächsten eilen musste, um sein Reich zusammenzuhalten. Die Folgen dieser Mängel traten beim Russlandfeldzug von 1812 dann deutlich zutage.
Anders als sein Rivale schien Arthur vom Schicksal fast so oft im Stich gelassen wie begünstigt worden zu sein. Nach einer grandios erfolgreichen Serie von Feldzügen, die ihm eigentlich einen Ruf hätten einbringen müssen, der den von Robert Clive (»Clive of India«) noch überstrahlte, wurde Arthurs Rückkehr aus Indien dank der politischen Feinde seines älteren Bruders Richard von einer dunklen Wolke überschattet. Gepaart mit dem rigiden Hierarchiesystem der Armee verwehrte ihm dies die Chance, seine herausragenden Fähigkeiten als Befehlshaber zu demonstrieren. Wer Arthur kannte, zweifelte nicht an seinem Talent, aber es gab wenig Gelegenheiten, es im Feld gegen die Armeen Frankreichs auf die Probe zu stellen. Natürlich nur bis die Entscheidung fiel, in Portugal und Spanien zu intervenieren.
Während viele andere britische Generäle übervorsichtig waren, erkannte Arthur die Notwendigkeit, den Kampf zum Feind zu tragen. Dieses Streben wurde durch das Wissen darum gedämpft, dass England es sich nicht leisten konnte, dasselbe Maß an Verlusten hinzunehmen wie Frankreich. Die Schlacht bei Vimeiro gab einen Vorgeschmack auf die Taktik, die Arthur den unverdienten Ruf einbrachte, ein defensiver Befehlshaber zu sein. Er verfügte über begrenzte Ressourcen und musste sorgfältig mit ihnen haushalten. Doch wie der brillante Erfolg bei Porto zeigte, erfasste Arthur rasch jeden Vorteil und nutzte ihn aus. Die Einnahme Portos rechtfertigte seine Ernennung zum Befehlshaber der britischen Streitkräfte auf der Iberischen Halbinsel in vollem Umfang, und in den folgenden Jahren sollte er ein ums andere Mal beweisen, dass britische Soldaten, wenn sie gut geführt wurden, den Männern des französischen Kaisers mehr als gewachsen waren.
Wie bei Schlacht und Blut und Ketten und Macht hoffe ich, diesen dramatischen geschichtlichen Zeitabschnitt so genau wie möglich dargestellt zu haben. Für den Fluss der Erzählung war es unerlässlich, einige Einzelheiten zu verändern, wofür ich mich bei all jenen entschuldige, die in dieser Zeit wohlbewandert sind.
Auch wenn es sich bei diesem Buch um Fiktion handelt, sah ich mich bei meinen Recherchen erstaunlich oft mit Beispielen konfrontiert, bei denen die Realität schlicht sehr viel merkwürdiger ausfiel als alles, was ich hätte erfinden können. Ehe Sie also zu zweifeln beginnen, liebe Leserin, lieber Leser, lassen Sie mich Ihnen Folgendes versichern: Eines sonnigen Tages in Frankreich hat tatsächlich eine kleine Armee von Kaninchen einen der größten Generäle der Welt in die Flucht geschlagen!
Simon Scarrow
November 2008
Ich danke Marion und Sarah bei Headline dafür, dass sie an meiner Prosa gefeilt und das Tempo der Geschichte in der redaktionellen Phase beibehalten haben.
Und wie immer meinen tiefsten Dank an Carolyn für ihre Unterstützung während der Arbeit an Feuer und Schwert und dafür, dass sie dafür gesorgt hat, dass der erste Entwurf peinlich genau überprüft wurde.
London, September 1805
Für Sir Arthur Wellesley war London nach sechs Monaten Seereise von Indien ein willkommener und vertrauter Anblick. Fast neun Jahre waren vergangen, seit er seinen Fuß zuletzt in die Hauptstadt gesetzt hatte, und er konnte nicht anders, als aufzustehen und sich aus dem Fenster zu beugen, während die Kutsche einen flachen Hügel erklomm, von dem sich ein schöner Blick auf das Häusermeer Londons bot, auf die glitzernde Themse und einen Wald von Masten jener Schiffe, die Rohstoffe und Luxusgüter nach England brachten und die im Land gefertigten Waren in die ganze Welt transportierten.
Dank seiner eigenen Bemühungen und der seines Bruders Richard trugen nun die riesigen Gebiete in Indien, die sie erobert hatten, zu Britanniens Reichtum und Macht bei. Während Richard als Generalgouverneur gedient hatte, hatte sich Arthur seine Sporen in der Armee verdient und war vom Rang eines Obersts zu dem eines Generalmajors an der Spitze einer Armee aufgestiegen, die eine Reihe großartiger Siege errungen hatte. Schließlich waren seine Leistungen mit dem Ritterschlag belohnt worden, und er kehrte als ein Mann von Erfahrung, Wohlstand und Einfluss nach England zurück.
Mit sechsunddreißig fühlte er sich auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit und konnte seinem Land in dessen titanenhaftem Kampf gegen Frankreich gut dienen. Bei seiner Abreise war Frankreich eine revolutionäre Republik gewesen. Jetzt war es ein Reich, regiert von dem Tyrannen Bonaparte. Da er über viel Zeit verfügte, hatte Arthur im letzten halben Jahr jede Zeitung gelesen, die in einem der Häfen auf dem Weg an Bord gekommen war, und Napoleons Entwicklung zu immer mehr Macht und Stärke verfolgt. Es war eine verblüffende Erfolgsgeschichte, wie Arthur widerwillig einräumen musste. Der Mann war offenbar eine phänomenale Naturgewalt, da er so viele Dinge in so kurzer Zeit zuwege gebracht hatte. Es war ein Jammer, dass Bonapartes Qualitäten als General und Staatsmann von keinem Verlangen nach Frieden mit seinen Nachbarmächten gemäßigt wurden. Am Ende des gegenwärtigen Kriegs würde Bonaparte die ganze Welt beherrschen, oder Frankreich würde gedemütigt sein. Nach Arthurs Ansicht war es Englands Pflicht, diese Niederlage Frankreichs herbeizuführen, egal wie lange es dauerte, wie viele Millionen Pfund es kostete und wie viele Menschenleben es forderte.
Bis zu den ersten kühlen Herbsttagen blieben noch einige Wochen Zeit, deshalb war der Himmel über der Stadt nur von einem feinen gelblichen Rauchschleier bedeckt. Sobald der Winter einsetzte, würde an windstillen Tagen eine Rußschicht aus Zehntausenden von Feuerstellen reglos über der Stadt hängen. Er dachte mit Freude an die frischen Winde auf seiner letzten Seereise. Das Schiff hatte erst vor zwei Tagen in Portsmouth angelegt, und er hatte das Gefühl, auf See zu sein, noch nicht verloren. Jedes Mal, wenn er aus der Kutsche stieg, schien der Boden unter seinen Füßen zu schwanken, als stünde er noch auf einem Schiffsdeck, das endlos auf und ab schaukelte. Es hatte einige Tage mit ruppigem Wetter gegeben, als sich der Indienfahrer um das Kap herumkämpfte, aber für den größten Teil der Reise hatte er ruhen und sich von den Anstrengungen des jahrelangen harten Militärdienstes in Indien erholen können.
Der Anblick der Stadt heiterte ihn auf. Er lächelte bei der Aussicht, wieder mit seiner Familie vereint zu sein, und er freute sich darauf, viele alte Freunde zu treffen. Vor allem aber wollte Arthur unbedingt sehen, wie die Dinge zwischen ihm und Kitty standen, der jungen Liebe, die er in Irland zurückgelassen hatte. Die seltene Korrespondenz zwischen ihnen in den letzten zehn Jahren waren eine schlechte Basis, um die wahre Natur ihrer Gefühle für ihn beurteilen zu können. Und was würde er von ihr halten? Zehn Jahre konnten eine beträchtliche Veränderung in Kittys Charakter bewirkt haben, von ihrem Aussehen ganz zu schweigen. Es war jedoch nicht ihr Aussehen, mit dem sie sein Herz erobert hatte, rief er sich in Erinnerung. Es war ihre schrullige Lebhaftigkeit, die sie von all den großäugigen, gesitteten und durch und durch langweiligen Debütantinnen in den gesellschaftlichen Zirkeln von Dublin Castle unterschied. Wenn sie noch ungetrübt war, würde ihre Persönlichkeit bewundernswert zu ihm passen. Die entscheidende Frage lautete: Wie sollte Arthur vorgehen, um ihre Hand zu gewinnen?
Er hatte es schon einmal versucht; einige Monate vor seinem Aufbruch nach Indien hatte er ihren älteren Bruder Tom um die Erlaubnis gebeten, sie heiraten zu dürfen. Nichts weiter als ein Major mit wenig Hoffnung, ein Vermögen zu machen, sowie großzügiger Aussicht auf einen frühzeitigen Tod, hatte Arthur außer Liebe nicht viel zu bieten gehabt. Ein praktisch veranlagter Mann wie Tom fand ein solches Gefühl weder anziehend noch wünschenswert. Und so hatte er Arthurs Ersuchen abgelehnt, ungeachtet der Tatsache, dass Kitty ihr Herz dem jungen Offizier bereits geschenkt hatte. In einem letzten Versuch, sich ihre Zuneigung zu bewahren, hatte Arthur einen Brief geschrieben, dass sich seine Gefühle für sie nicht geändert hatten und sein Angebot immer noch bestehen würde, wenn er mit Rang und Reichtümern aus Indien zurückkehrte und sie noch unverheiratet war.
Die Straße führte sanft abwärts, und der Blick auf London ging hinter einer Baumreihe verloren, deshalb ließ sich Arthur wieder auf seinem Platz gegenüber der beträchtlichen Masse des anderen Passagiers nieder, der nach London reiste. Der Mann trug eine dunkle Jacke mit weißem Spitzenbesatz in einem verschlungenen Muster. Sie hatten sich bei Antritt der Reise rein formell begrüßt und seither nur wenige Worte gewechselt. Mr. Thomas Jardine hatte sich als Bankier vorgestellt und offenkundig noch nie von dem jungen Generalmajor gehört, als Arthur ihm seinen Namen genannt hatte. Mr. Jardine hatte beim letzten Halt eine Zeitung gekauft, die er nun zusammenfaltete und neben sich auf den ledernen Sitz legte.
Arthur zeigte auf die Zeitung. »Darf ich?«
»Natürlich. Bitte sehr.«
»Danke.«
Arthur griff nach der Zeitung und breitete sie auf seinem Schoß aus. Ein prominent platzierter Artikel handelte von den Kriegsvorbereitungen des britischen Seehelden Admiral Lord Nelson. Arthur wusste bereits von der bemerkenswertesten Großtat des Mannes – der vernichtenden Niederlage, die er den Franzosen in der Bucht von Abukir an der ägyptischen Küste zugefügt hatte. Aber Nelson versprach, selbst diesen Sieg mit einer der größten Flotten verblassen zu lassen, die je von der Royal Navy zusammengezogen worden war. Bereits in diesem Augenblick sammelten sich die Kriegsschiffe in Portsmouth und luden Kanonenkugeln, Pulver und Vorräte für einen großen Waffengang gegen die vereinten Seestreitkräfte von Frankreich und Spanien.
Mr. Jardine regte sich. »Genau der richtige Mann, hm?«
Arthur ließ die Zeitung sinken und blickte auf. »Sir?«
»Nelson. Britanniens aussichtsreichster Kandidat, es den Franzosen zu zeigen. Wenn er ihnen erst eine ordentliche Abreibung verpasst hat, wird das Gerede von einer Invasion aufhören.«
»Ja, vermutlich.«
»Ein verdammtes Glück, dass die Navy zwischen uns und Monsieur Bonaparte steht. Andernfalls müssten wir alle Französisch parlieren und gottverdammte Frösche essen, bevor das Jahr um ist.«
»Ja, wir können alle von Glück reden, dass wir Nelson und die Marine haben.« Arthur lächelte. »Aber man sollte nicht vergessen, welche Rolle das Heer bei der Verteidigung Britanniens spielt.«
»Natürlich.« Mr. Jardine nickte, dass seine Wangen wackelten. »Wenngleich ich zu behaupten wage, selbst Sie müssen zugeben, dass unsere, äh, tapferen Rotröcke wenig Gelegenheit hatten, sich in diesem Krieg auszuzeichnen.«
Arthurs Lächeln verflog. »Ich kann Ihnen versichern, Sir, dass die Armee ihren Beitrag genauso geleistet hat wie die Marine.«
»Nun hören Sie schon auf, ich wollte niemanden kränken. Ich weise lediglich darauf hin, dass die Hauptlast des Krieges auf die Schultern unserer Matrosen gefallen ist. Das können Sie doch nicht leugnen, Sir.«
»Kann ich nicht?« Arthur dachte an seinen ersten Feldzug in den Niederlanden. Die Hälfte seiner Männer war an Nahrungsmangel und der bitteren Kälte dieses schrecklichen Winters gestorben. Dann Indien, die langen Märsche in sengender Hitze, bevor sie gegen weitaus größere Armeen angetreten waren und sie besiegt hatten. Er fixierte sein Gegenüber und räusperte sich. »Ich bin überzeugt, dass Sie in voller Kenntnis der Tatsachen nicht zu einem solch harschen Urteil über den Beitrag der Armee kommen würden.«
Jardine schüttelte kurz den Kopf. »Es war nicht harsch gemeint. Verzeihen Sie, wenn es den Anschein hatte. Ich weise lediglich auf die Ergebnisse beider Dienste hin. Unsere Matrosen haben den Feind auf den Meeren vollkommen beherrscht, wohingegen unsere Soldaten den Franzosen nicht gewachsen sind und den letzten Stützpunkt auf dem Kontinent nicht halten konnten. Statt den Kampf direkt zum Feind zu tragen, piesacken sie ihn nur ein wenig in seinen Kolonien, weit entfernt vom Zentrum der Auseinandersetzung.«
»Es ist wohl kaum die Schuld der Soldaten, wenn unsere Regierung sie in dieser Weise einsetzt«, protestierte Arthur.
»Ganz genau, Sir. Nehmen Sie sich selbst.« Jardine zeigte auf Arthurs gebräuntes Gesicht. »Ihrer Farbe nach dürften Sie irgendwo in den Tropen oder dergleichen gedient haben?«
»Ich komme gerade aus Indien zurück.«
»Und was haben Sie dort Bedeutsames geleistet für dieses Land?«
Arthur holte tief Luft. Auf diese Frage hatte er nun wahrlich genug zu antworten, aber Jardine fuhr fort, bevor er damit beginnen konnte.
»Ich wette, Sie und Ihre Leute haben die meiste Zeit damit verbracht, die Eingeborenen von den Ländereien der Ostindien-Kompanie zu verjagen.«
»Wir haben mehr als das getan, Sir. Dank der Anstrengungen der Armee herrscht England jetzt über Gebiete, die ein Vielfaches der Größe und Einwohnerzahl der Britischen Inseln besitzen.«
»Indien ist lediglich ein Randaspekt unseres Kampfes gegen Frankreich«, tat Jardine Arthurs Aussage ab. »Davon abgesehen haben Sie gegen Wilde gekämpft, nicht gegen richtige, zivilisierte Armeen. Wie hätten Sie einen derart ungleichen Wettkampf verlieren können?«
Arthur lehnte sich mit überdrüssiger Miene zurück. Der Mann wusste erkennbar nichts über die Feldzüge, die im letzten Jahrzehnt quer über den Subkontinent geführt wurden. Er wusste nichts von dem blutigen Angriff auf Seringapatam, die befestigte Hauptstadt des Sultans von Mysore. Nichts von dem verzweifelten Marsch an der Front der riesigen Marathen-Armee vorbei, um ihre Flanke anzugreifen und sie zu besiegen. Nichts vom beherzten Vorrücken gegen die Kanonen und massierten Reihen des Feinds bei Argaum. Nichts von den monatelangen, aufreibenden Scharmützeln gegen die von dem blutrünstigen Dondia Wagh geführten Banditenkolonnen. Ganz offensichtlich waren die Heldentaten Arthurs und seiner Männer zu Hause in Britannien übersehen worden. Als wären sie eine vergessene Armee, die von einem vergessenen General geführt wurde. Er seufzte.
»Ich kann Ihnen versichern, die Truppen, die zu befehligen ich die Ehre hatte, haben sich Feinden gegenübergesehen, die keinen Deut weniger gefährlich als die Franzosen waren. Wenn die Zeit gekommen ist, dass unsere Soldaten Bonaparte in offener Feldschlacht entgegentreten, werden sie ihm und seinen Leuten mehr als gewachsen sein.«
»Natürlich, Sir, natürlich.« Jardine nickte beschwichtigend. »Ich bin überzeugt, dass Sie Ihr Geschäft verstehen. Aber aus der Sicht eines gut informierten Laien wie mir hat es den Anschein, als würde die Hoffnung auf einen Sieg gegen die Franzosen auf der Royal Navy ruhen.«
»Bei Gott, Sir, Sie irren sich. Sie irren sich absolut«, entfuhr es Arthur. »Wie kann die Marine Bonaparte besiegen? Selbstverständlich kann Admiral Nelson ihre Kriegsschiffe zerstören, aber er kann die Franzosen nur bis an ihre Küste verfolgen. Und von da an kann Napoleon seine Gegner zum Kampf fordern, wo immer er festen Boden unter den Füßen hat. Daraus folgt also, dass der Krieg zwischen England und Frankreich nur an Land entschieden werden kann. Zur rechten Zeit werden unsere Soldaten auf europäischem Boden kämpfen, und dort werden sie beweisen, dass sie den besten Männern Napoleons mehr als gewachsen sind. Merken Sie sich meine Worte, Sir. Sie werden den Tag erleben.«
»Das hoffe ich, Sir. Das hoffe ich aufrichtig. Aber es kommt darauf an, dass unsere Regierung bereit ist, eine Streitmacht auf den Kontinent übersetzen zu lassen, die groß genug ist, um etwas zu bewirken.«
Arthur nickte. »Und sie angemessen zu versorgen und zu verstärken, wenn nötig. Sie haben recht, Sir. Die Regierung hat einen solchen Einsatz unserer Militärmacht bislang abgelehnt. Aber das wird sich ändern. Es gibt Männer mit Weitblick in Westminster. Männer, die sich zu einem mutigen Kurs überreden lassen.«
»Wer wird sie überreden, Sir? Die meisten unserer Generäle scheinen geradezu ein Quell der Vorsicht und, wenn ich das so sagen darf, der Unentschlossenheit zu sein.«
»Dann werden Männer wie ich selbst für ein entschlossenes Handeln eintreten müssen.«
Jardine lächelte. »Verzeihen Sie, Sir, aber wie kommen Sie darauf, dass das Wort junger Offiziere in dieser Angelegenheit großes Gewicht haben wird?«
»Weil ich die Wahrheit sagen werde. Ich werde die Fakten klar und logisch präsentieren, sodass es keinen Zweifel hinsichtlich des richtigen Wegs geben kann.«
»Ah, aber Sie sprechen als Soldat. In Westminster neigt man dazu, wie ein Politiker zu sprechen und zuzuhören. Fakten und Logik sind wie Lehm für sie, weich und unbegrenzt formbar. Ich fürchte, Sie überschätzen den Einfluss, den Vernunft auf solche Leute hat.«
Arthur schwieg einen Moment, dann zuckte er mit den Achseln. »Wir werden sehen.« Er griff wieder nach der Zeitung. »Wenn Sie nun gestatten, Sir, würde ich das hier gern zu Ende lesen, ehe wir ankommen.«
Jardine nickte knapp und sah mit missbilligend geschürzten Lippen aus dem Fenster.
Die Kutsche ließ die Bäume bald hinter sich und gelangte in die ersten Dörfer, die allmählich von der sich immer weiter ausdehnenden Hauptstadt geschluckt wurden. Die Häuschen und kleinen Läden machten einer dichteren Wohnbebauung Platz, die links und rechts an das Kopfsteinpflaster heranrückte. Gelegentlich passierte die Kutsche Arbeitshäuser und kleine Fabriken, von deren Kaminen Rauch in den Himmel quoll und die braune Dunstglocke über London verdichtete. Schließlich erreichten sie den Kutschhof in Chelsea, und nach einer kurz gehaltenen Verabschiedung von Mr. Jardine ließ Arthur seinen Reisekoffer von einem Träger zu einer der Droschken schaffen, die auf der Straße warteten. Der Rest seines Gepäcks befand sich noch im Frachtraum des Indienfahrers und würde ihm nach London nachgeschickt werden, sobald das Schiff entladen war.
»Cavendish Square, bitte«, rief Arthur dem Kutscher zu, als er einstieg und die kleine Tür zuzog.
»Jawohl, Sir.« Der Droschkenkutscher nickte und trieb sein Pferd dann mit einem Schnippen der Zügel an. Das Gefährt ratterte hinaus in den dichten Verkehr der Durchgangsstraße. Sofort fiel Arthur der krasse Gegensatz zwischen den Straßen Londons und denen auf, an die er sich in Indien gewöhnt hatte. In seiner Kindheit hatte die Familie größtenteils auf dem Land in Irland gelebt, und er war entsetzt gewesen von dem Dreck und den rauchigen, verschwitzten Gerüchen erst Dublins und dann Londons. Doch er hatte sich schnell daran gewöhnt, so wie er sich an die furchtbare Armut und den Gestank in den primitiven Elendsvierteln indischer Städte gewöhnt hatte. Nun legte er einen neuen Maßstab an London an und staunte über den offenkundigen Reichtum der Hauptstadt und die schönen Fassaden, die sie den gepflasterten Straßen präsentierte.