

Buch
»Mathilde ist aus dem Fenster gestürzt!« Als Penelope vom Unfall ihrer Großmutter erfährt, lässt sie in Berlin alles stehen und liegen und reist in die Provence, um für sie da zu sein. Sich ganz um jemand anderen zu kümmern kommt ihr gerade recht, denn wenn es eines gibt, mit dem sie sich nicht beschäftigen will, ist es ihr eigenes Leben. Mit vollem Elan stürzt Penelope sich deshalb in die Arbeit in Mathildes kleiner Pension, wo sie sich bald nicht nur zwischen einer alten und einer neuen Liebe entscheiden muss, sondern auch an die Idylle ihrer sorglosen Kindertage erinnert wird. Zwischen weiten Lavendelfeldern und französischen Desserts fragt sie sich, wann sie verlernt hat, glücklich zu sein. Was Penelope nicht ahnt: Die Sterne der Provence stehen günstiger für sie, als sie denkt …
Autorin
Pauline Mai, 1987 geboren, wuchs am Tegeler See in Berlin auf. Als die Stadtbücherei ihren Buchhunger nicht mehr stillen konnte, zog es sie in die Welt – und hängen blieb sie in Frankreich. Dort lernte sie die Lebensart, die raue Meerküste und Macarons lieben. Und diese Liebe hält bis heute an. Auch wenn sie mittlerweile wieder in Berlin lebt, wo sie zuletzt als Lektorin und Literaturscout tätig war, verschlägt es sie, wann immer es geht, in das schöne Nachbarland. Und eben da, in der Provence, ist auch ihr erster Roman angesiedelt: »Das Glück ist lavendelblau«.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Pauline Mai
Das Glück
ist
lavendelblau
Roman
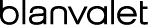
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Pauline Mai
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
dn · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24361-6
V002
www.blanvalet.de
Prolog
Das alte Steinhaus wurde von allen Die kleine Hexe, La Petite Sorcière, genannt. Dabei sah es gar nicht aus wie ein Hexenhäuschen. Weiß getüncht und von dunklen Holzbalken gestützt, lag es nur etwa zehn Fahrminuten von Puimoisson entfernt, dem nächsten Ort mit seinem Buchladen, dem Lebensmittelgeschäft und einigen wenigen Cafés. Und doch wirkte es abgeschieden inmitten des violetten Lavendelmeers, das sich im Wind wiegte und ein stetiges Rauschen von sich gab. Ein glänzendes Messingschild hing an der Fassade neben der Eingangstür. Darauf waren unter den Kratzern nur noch undeutlich der eingravierte Name des alten Hauses sowie die Umrisse einer Hexe zu erkennen, die vor einem großen Baum zu schweben schien. Wie es zu dieser Gravur und zu dem Namen gekommen war, den das Haus trug, war nicht bekannt, zu alt waren Haus und Schild, und diejenigen, die noch etwas darüber hätten erzählen können, waren längst nicht mehr am Leben.
Ein Kater mit buschigem weißem Fell huschte durch die Rosensträucher im Garten, die im goldenen Licht der tief stehenden Sonne leuchteten. Das Innere des Hauses war erfüllt vom Duft des Lavendels: Überall hingen getrocknete Bünde an den Zimmerdecken und vermischten sich mit dem intensiven Holzgeruch. Eine dunkle Treppe führte hinauf zu den Schlafzimmern, und von dort gingen steile, schmale Stufen hoch zum Dachboden.
Hier oben stand sie und sah aus dem offenen Fenster. Ihre knittrige Hand ruhte auf dem Fensterbrett. Daneben lag das bunt bestickte Kissen, das dazu einlud, die kleine Trittstufe heranzuziehen, auf das breite Fensterbrett zu steigen und sich dort niederzulassen, um den Blick über die weiten Lavendelfelder und sanften Hügel schweifen zu lassen, während die Gedanken in die Tiefen der Vergangenheit glitten. Wieder und wieder hatte sich die alte Frau von dem Sog früherer Jahre verführen lassen und sich in ihren Erinnerungen verloren.
Eine leichte Brise wehte durch das Fenster herein. Die langen weißen Haare der Frau bewegten sich sachte und kitzelten ihre Wange. Das helle baumwollene Kleid spielte um ihre Knöchel. Ihr Blick war fest auf einen Punkt in der Ferne gerichtet, abwesend und entschlossen zugleich. Irgendwo draußen bellte ein Hund, aber zu der alten Frau drang das Geräusch nicht durch. Sie bückte sich und zog das Treppchen heran. Vorsichtig erklomm sie die erste Stufe, dann die zweite und ließ sich seitlich auf das Fensterbrett sinken, das linke Bein noch auf dem Treppchen. Unter einiger Kraftanstrengung schob sie sich näher an die Fensteröffnung und blickte nach unten. Im Eingangshof lag sandfarbener Kies, durch den sich Grashalme geschoben hatten, um hoch über ihn hinauszuwachsen. Der Platz, der sich an einer Seite zu der ungeteerten Straße hin öffnete, der schlangenlinienartigen Verbindung zu den Dörfern der Umgebung, war umsäumt von Bäumen in kräftigem Grün und strohigen Grasstauden. Einige Lavendelblüten blitzten hindurch.
Ein Knarzen ertönte, so als meldeten sich die verzogenen Holzpaneele zu Wort. Die alte Frau sah sich nicht um, jedes Geräusch des Hauses, in dem sie Jahrzehnte ihres Lebens verbracht hatte, war ihr vertraut. Ein plötzlicher Windstoß fuhr durchs Fenster hinein. Da raschelte etwas, sie streckte sich, um es zu fassen, doch sie griff ins Leere, geriet ins Wanken und verlor das Gleichgewicht.
Die alte Frau fiel. Das Kleid bauschte sich auf, die langen weißen Haare flatterten wild um ihr Gesicht.
Und dann war da nur noch das gleichmäßige Rauschen des Lavendels, und in der Ferne bellte der Hund.
1
Ich zog den Koffer unterm Bett hervor, warf wild Kleidung hinein, ohne darauf zu achten, ob die Dinge zusammenpassten: Unterwäsche, Hosen, Shirts, einige Röcke, Kleider, Sandalen. Wie eine Furie lief ich in der Wohnung umher, sammelte Kosmetika, mein Notizheft und meine Bücher ein und steckte sie in die große Handtasche. Hektisch zog ich den Reißverschluss des Koffers zu, dann hielt ich inne. Und nun? Ich blickte auf das bereitstehende Gepäck und geriet mit einem Mal ins Schwanken. Was mir eben noch so klar vor Augen gestanden hatte, wirkte plötzlich flirrend und undeutlich.
Mit einem Seufzer ließ ich mich auf die Couch fallen und griff nach meinem Handy. Ich checkte es nach einer Nachricht von Oskar – nichts. Vor Wut ließ ich die Faust samt Handy auf das Polster niedersausen, und schon wieder schossen mir Tränen in die Augen. Wie weit ist es mit einem gekommen, wenn man sich selbst nur noch als nervige Heulsuse bezeichnen kann? Eindeutig zu weit. Immer wenn ich in den letzten Tagen gedacht hatte, endlich über den Berg zu sein, waren all die Gefühle wieder aus mir hervorgebrochen. Ich schob das Handy unter das Sofakissen, wischte mir die schwarze Mascarasuppe auf meinen Wangen mit den Handrücken weg und rieb sie so lange aneinander, bis das Schwarz wohin auch immer verschwunden war. Tief atmete ich durch. An welchem Punkt hatte sich die Beziehung zwischen Oskar und mir gewandelt, wann waren wir auseinandergedriftet, ohne es uns eingestehen zu können? Und wie hatten wir es trotzdem so lange miteinander ausgehalten, bis zu diesem letzten Paukenschlag?
Ich schüttelte die Gedanken ab, bevor die Wut der letzten Tage wieder von mir Besitz ergreifen und mich in ein heulendes Wrack verwandeln würde. Ein Plan musste her, ein gut strukturierter Plan, an den ich mich jetzt halten, klammern, festkrallen konnte. Ich würde mir den Koffer schnappen und losfahren, einfach abhauen. Und ich würde erst dann alle benachrichtigen, wenn ich bereits aus Berlin raus wäre. Wenn ich endlich genug Kilometer zwischen mich und Oskar gebracht hätte, sodass das Gummiseil, das uns so lange zusammengehalten hatte, endgültig gerissen wäre.
Ich stützte mich auf und wollte mich gerade entschlossen aus dem tiefen Sofa hieven, da summte ganz leise und verschämt mein Telefon unter den Polstern und versetzte mich in eine kurze Schockstarre, die sofort hektischem Gesuche zwischen den Kissen wich, bis ich es in der Hand hielt. Auf dem Display leuchtete mir ein Name entgegen: Clémence. Ich unterdrückte die Enttäuschung, räusperte mich und nahm das Gespräch mit einem krächzenden »Hallo?« an.
»Pepe, Kleine, gut, dass ich dich gleich erreicht habe. Bist du nicht auf der Arbeit?«
Meine vier Jahre ältere Schwester sprach mit einer sanften Stimme, die mir leicht brüchig erschien, ganz anders als ihr sonstiger Tonfall. Sie musste geweint haben. Dabei war sie eindeutig die Energetischere von uns beiden, ein kleiner Feuerball von mit Absatzschuhen erschummelten eins fünfundsechzig und einer kraftvollen Stimme, die meist einige Dezibel über der Normallautstärke lag. Weinen gehörte nun wirklich nicht zu ihrem Repertoire, sodass ich sofort hellhörig wurde. Ich räusperte mich noch einmal, bevor ich antworten konnte.
»Clem, hi. Ich bin gerade zu Hause, es gibt einige Veränderungen, von denen ich dir berichten muss.«
»Kleine, hör mal, du wirst mir ein anderes Mal davon erzählen müssen. Es ist etwas Schreckliches passiert. Mamie, sie hatte einen Unfall. Sie liegt hier im Krankenhaus, und es …«, sie stockte kurz, und ich meinte, im Hintergrund geschäftiges Treiben zu hören, eilige Schritte, Wortfetzen, »… es sieht nicht gut aus.«
»Was ist passiert?« Meine Stimme klang verzerrt und schrill, als hätte sich in meiner Kehle etwas festgesetzt, von wo aus es pikte und stach und mir die Luft nehmen wollte. Trotz meiner neunundzwanzig Jahre fühlte ich mich mit einem Mal vor Schreck und lauter Hilflosigkeit wieder ganz klein.
»Wir wissen es nicht genau. Es ist merkwürdig, sie scheint aus dem Dachbodenfenster gefallen zu sein. Glücklicherweise ist sie in der Fliederhecke gelandet, wodurch ihr Aufschlag abgefedert wurde.«
»Aus dem Dachbodenfenster? Mamie ist aus dem Dachbodenfenster gestürzt? Willst du mich auf den Arm nehmen? Niemand fällt aus Mamies Dachbodenfenster!« Die Unterkante des einzigen Fensters der geräumigen Dachkammer befand sich einen guten Meter über dem Boden und hatte eine breite hölzerne Fensterbank. Als Kind hatte ich es geliebt, heimlich in den Nächten hinauf auf den Dachboden zu schleichen, es mir auf den weichen Kissen gemütlich zu machen und mit einer Taschenlampe zu lesen, bis mir die Augen zufielen. Um aus dem Fenster zu stürzen, müsste man auf das breite Brett klettern, bis zur Öffnung robben und einiges an Schwung aufbringen – alles Dinge, die Mamie niemals tun würde. Ich war mir nicht mal sicher, ob sie das mit ihren vom Alter geschwächten Muskeln überhaupt noch tun könnte.
»Ich weiß«, fiel Clem ein. »Ich sagte ja, es ist merkwürdig. Wir wissen nichts Genaues, weil Mamie noch nicht ansprechbar ist. Fakt ist, dass sie gestürzt ist und es ihr sehr schlecht geht. Du solltest dich so schnell wie möglich auf den Weg machen. Papa ist auf einer Konferenz in Taiwan. Er versucht hierherzukommen, aber das wird erst in ein paar Tagen möglich sein.«
»Was genau fehlt ihr denn?«, fragte ich ängstlich.
»Das ganze Ausmaß ihrer Verletzungen ist noch nicht klar. Offenbar hat sie sich mehrere Brüche zugezogen. Im Augenblick wird ein MRT gemacht, um herauszufinden, ob sie eine Schädelverletzung hat.«
Ich schluckte. Das Wort »Schädelverletzung« surrte mir in den Ohren.
»Ich fahre sofort los. Ich hatte ohnehin vor, sie zu besuchen, der Koffer ist gepackt.« Während ich sprach, war ich aufgestanden und hatte nach meinem Portemonnaie gegriffen, um es in die Handtasche zu stecken. »Bitte gib mir sofort Bescheid, falls sich ihr Zustand verändert oder ihr mehr erfahrt.«
»Natürlich, und du ruf an, wenn du bei der Petite Sorcière bist. Ich komme dich dort abholen. Fahr vorsichtig, eine meiner Liebsten im Krankenhaus ist mehr als genug!«
La Petite Sorcière, so hieß das Landhaus meiner Großmutter, in dem Clem und ich all unsere Sommerferien verbracht hatten, inmitten von duftenden Lavendelfeldern. Sobald ich diesem Geruch irgendwo begegnete, ob in Cafés, wo auf den Tischen kleine Bouquets arrangiert waren, oder in der Bahn, wenn sich eine ältere Dame an mir vorbeidrängte und ihr Parfümduft noch für einen Augenblick in der Luft hing, war ich gedanklich sofort wieder in der Provence, und ich sah, wie ich mit meiner Schwester und den Kindern der Ferienbesucher Ball spielte oder wie wir mit den Hunden der Nachbarhöfe über die endlos scheinenden Feldwege rannten, während die hohen Gräser gegen meine Beine peitschten … Und natürlich sah ich mich auch all die köstlichen Gebäckstücke naschen, die Mamie zauberte. Soweit ich mich erinnerte, hatte ich dort wochenlang nichts anderes gegessen als Eclairs, Tartes und Madeleines. Meine Schwester hatte es nach ihrem Abitur dort hingezogen. Nicht nur die schöne Landschaft und die Nähe zu unserer Großmutter hatten sie gelockt, sondern vor allem die Liebe: Sie hatte ihren Jugendschwarm Gaspard geheiratet und lebte seither mit ihm zusammen in einem Häuschen keine zehn Autominuten von Mamie entfernt.
Ich griff nach meinem Koffer und der Handtasche. Mein gelber VW-Käfer wartete vor dem Berliner Mehrfamilienhaus auf mich. Natürlich fiel mir beim Einladen meiner Taschen ein, dass ich die Schlüssel für die Petite Sorcière, meine Kreditkarte und die Fahrzeugpapiere oben vergessen hatte. So musste ich wohl oder übel noch einmal die Stufen zu meiner kleinen Zweizimmerwohnung im obersten Stock hochsteigen.
Auf dem Weg hinauf kam mir Jonas mit seiner zweieinhalbjährigen Tochter Felicia auf dem Arm entgegen. Er lächelte und blieb stehen, wohl um einige Worte mit mir zu wechseln. Ich aber winkte entschuldigend ab, zu sehr mit meinen eigenen Gedanken und Gefühlen beschäftigt, und kniff Feli nur leicht in den Arm, der die unwiderstehliche Speckigkeit von Kleinkindern aufwies.
»Penelope, warte mal«, rief Jonas mir hinterher, während ich die Stufen hinaufeilte. Ich blickte mich um und sah noch, wie er sich durch die blonden Locken fuhr. Es war seltsam … Obwohl wir uns in den letzten Jahren nur noch selten gesehen hatten, kannte ich jede Geste meines einstigen besten Freundes in- und auswendig. Ich wusste, dass er angespannt war, wenn er sich auf diese Weise durch die Haare fuhr. Ihn musste dieselbe Beklemmung überfallen haben wie mich, ein Gefühl zwischen zwei Menschen, die sich fremd geworden waren, obwohl sie für eine Weile alles voneinander gewusst hatten. Ich konnte es einfach nicht mehr abschütteln, wenn ich ihm begegnete. Wie immer sprang ihm eine widerspenstige Locke zurück vors Auge.
»Ich habe heute Vormittag Oskar vor dem Haus getroffen. Er gab mir den hier für dich …« Umständlich durchsuchte er seine Taschen, ohne Feli abzusetzen. Die machte sich einen Spaß daraus, ihrem Vater die Augen zuzuhalten. Blind tastete er die Hosentasche ab, zog mit einem triumphierenden »Voilà« etwas Kleines, Metallenes hervor und streckte es mir entgegen.
Ein Schlüssel. Mein Schlüssel. Der, den ich Oskar gegeben hatte, als er einmal Freunde, die zu Besuch gewesen waren, in seiner Wohnung untergebracht und währenddessen bei mir übernachtet hatte. Der Schlüssel, den er anschließend behalten hatte, ohne dass wir je darüber gesprochen hätten. Es hatte sich damals richtig und natürlich angefühlt, dass er kommen und gehen konnte, wann immer er wollte. Ich starrte den Schlüssel in Jonas’ Hand an, ohne mich zu rühren.
»Alles in Ordnung? Ich dachte, ihr hättet das besprochen … Es klang jedenfalls so, als Oskar ihn mir gegeben hat«, sagte Jonas unsicher.
Mein Blick wanderte von seiner Hand zu seinen Augen, die mich beunruhigt anblickten, und ich nickte abwesend, streckte den Arm aus und stieg die Stufen zu den beiden hinunter. Feli ahmte mich nach und streckte mir ihren Arm lachend entgegen. Diesmal kniff ich jedoch nicht hinein, sondern nahm den Schlüssel und steckte ihn in meine Jeanstasche.
»Ja«, sagte ich und riss mich zusammen. »Es ist alles geklärt.« Mein Blick ging an Jonas’ Augen vorbei ins Leere des Treppenhauses. Dass es eigentlich nichts mehr zu klären gab, dass Oskars Aktion das Reden zwischen uns übernommen hatte, konnte ich ihm gerade nicht erklären. Im Moment gab es so viel Wichtigeres. »Ich bin auf dem Sprung nach Puimoisson«, sagte ich hölzern. »Meine Großmutter ist im Krankenhaus, sie ist, ähm, sie ist gestürzt.«
»Nein, das tut mir leid!«, meinte Jonas betroffen.
»Nein, dat tut mi la«, plapperte Feli sogleich nach und schlug die kleine Hand vor den Mund, wie sie es sich bei den alten Damen abgeguckt haben musste, die zu jeder Tageszeit in der Bäckerei um die Ecke klatschten und tratschten. Trotz meiner Sorgen musste ich lächeln und streichelte über ihren blonden Schopf. Im Gegenzug versuchte sie, nach meinen schwarzen Locken zu greifen, doch zum Glück waren sie nicht lang genug, um sich in Felis Reichweite zu befinden. Es hatte sich also doch ausgezahlt, dass ich mein Haar vor zwei Wochen auf Schulterlänge hatte abschneiden lassen.
»Danke, also danke euch«, gab ich stockend von mir und tastete mit dem Fuß nach der nächsten Treppenstufe. »Ich muss dann mal.«
»Ja, na klar. Alles Gute für deine Großmutter.«
»Danke«, sagte ich wieder, wandte mich ab und nahm die Stufen nach oben.
»Ach, Pepe«, hörte ich seine Stimme und blickte mich noch einmal zu ihm um. »Du kannst mich immer anrufen, wenn es dir nicht gut geht, das weißt du, oder? Wir sind schließlich Freunde.«
Ich lächelte ihn dankbar an. Wie er da stand, mit seiner Tochter auf dem Arm, dem gutmütigen Blick, dem Versprechen, für mich da zu sein, erinnerte er mich so stark an all die Abende, die wir damals als Freunde zusammen verbracht hatten, und die Sehnsucht nach dieser Vertrautheit zerrte an mir.
»Das mache ich«, versprach ich, bevor ich weiterhastete. In wenigen Sätzen war ich bei meiner Wohnung angekommen und suchte meine Sachen zusammen, um kurz darauf in den Wagen zu steigen und endlich Vollgas zu geben.
Die Sonne war schon untergegangen, als ich mich in meinem VW-Käfer am Schwarzwald vorbeigeschlängelt, Freiburg als letzte größere deutsche Stadt hinter mir gelassen hatte und mit einem Schlenker über Schweizer Lande die französische Grenze erreichte. Hier mietete ich mich in einem einfachen Autobahnhotel ein, als ich merkte, wie meine Augenlider schwerer wurden. Clem hatte mir mittlerweile mehrere Nachrichten geschrieben, in denen sie den Verlauf des Tages dokumentiert hatte: Mamie hatte neben diversen Knochenbrüchen eine Gehirnerschütterung und war wohl noch apathisch, schwerere Kopfverletzungen schienen aber keine erkennbar zu sein. Letzteres klang erst einmal gut, beruhigte mich aber nicht ganz in meiner Sorge um meine Großmutter. Was hatte es zu bedeuten, dass sie apathisch war? War das eine normale Reaktion auf einen solchen Sturz? Über dem Schreiben mit Clem und dem Googeln möglicher Auswirkungen eines schweren Sturzes fiel ich irgendwann in einen unruhigen Schlaf.
Am nächsten Morgen trat ich die zweite Etappe der Reise an. Ich liebte das Fahren durch Frankreich, den Wechsel der Landschaften und Dialekte an den Raststätten, und ich liebte mein Auto, das ich mit achtzehn von meiner Mutter geerbt hatte. Meine Mutter war Berlinerin gewesen, ganz ursprünglich, wie es sie heute nur noch selten gab, während mein Vater in der Provence geboren und aufgewachsen war. In seinen Studentenjahren war er als Tourist nach Berlin gekommen, und obwohl er eigentlich nur eine Woche in der Stadt hatte verbringen wollen, war er letztlich für immer geblieben, weil er sich in Flora, meine Mutter, verliebt hatte. Mittlerweile arbeitete er als Professor für Literaturwissenschaft an der Münchner Universität und pendelte zwischen den beiden Städten, während meine Mutter … Bei der Erinnerung wurde mein Griff um das Lenkrad fester. Seit fast zwanzig Jahren waren wir in diesem Auto unterwegs gewesen, damals schon, als wir noch zu viert gewesen waren, und es steckten unzählige Erinnerungen in ihm von all den Reisen und Ausflügen, die wir unternommen hatten.
Ich drehte das Radio lauter, lauschte den Nachrichten, doch nach nur wenigen Augenblicken bahnten sich wieder die Gedanken an Mamie einen Weg. Die unbesiegbare Mathilde, willensstark und feinfühlig zugleich, angetrieben von einer Kraft, die nie zu schwächeln schien. Selbst als mein Großvater gestorben war, hatte sie weitergemacht. Sie hatte sich über Wasser gehalten, hatte La Petite Sorcière weitergeführt – die Pension, die sie einige Jahre zuvor mit ihm in dem leer stehenden Haus inmitten des Lavendels gegründet hatte – und sich dafür Hilfe bei den Nachbarn und aus den umliegenden Dörfern geholt.
Auch wir mussten von da an mit anpacken. Unsere Ferien verbrachten wir nicht mehr nur auf den Feldern und mit den Tieren wie zuvor, sondern auch mit Bettenausschütteln und ich vor allem in der Küche, wo ich Mamie, wie wir sie liebevoll nannten, beim Kochen und Backen über die Schulter sah. Hier entzündete sich meine Leidenschaft für das Teigkneten, das Cremerühren und Tortenverzieren. Stundenlang lernte ich von ihr, wie man einen perfekten Brandteig zubereitete, wie ein Croissant die richtige Form bekam und wie man mit echter Vanille den einzigartigen Geschmack einer Eclaircreme zauberte.
»Eine richtige Patisseurin bist du schon«, lobte mich meine Großmutter immer, wenn wir unsere frisch gebackenen Köstlichkeiten bewunderten, bevor sie den Gästen angeboten wurden. Und ich strahlte dann über das ganze von der Hitze in der Küche glühende Gesicht. Mamie nahm mich stolz in die Arme und drehte mich einmal im Kreis, wobei das Mehl von unseren Schürzen wie eine Wolke um uns stob …
Die Erinnerung an damals ließ mein Herz schwer werden. Ich dachte an Mamie, versuchte mir vorzustellen, wie sie in ihrem Krankenhausbett lag, die Augen geschlossen. Doch dieses Bild unterschied sich so sehr von dem meiner lachenden Großmutter, dass es undeutlich blieb.
In meinem quietschgelben Auto rauschte ich über die französische Autobahn. Wie oft ich diese Strecke schon genommen hatte … Jede Raststätte, jeder Ortsname war mir bekannt, so wie die Reichweiten der Radiosender. Sobald das erste Rauschen einsetzte, schaltete ich um und lauschte mal sanften Klavierklängen, mal Diskussionen über Kultur, Politik und das letzte Fußballspiel oder summte Popsongs mit. Nur brachten die meisten Lieder mich gedanklich zurück zu Oskar. Immer wieder hatte ich in den Pausen an der Raststätte meine Nachrichten überprüft, nach Anrufen geschielt, doch er hatte sich nicht gemeldet. Nicht einmal ein paar Worte hatte er mir schicken können, ein Es tut mir leid, dass alles so gelaufen ist oder ein Ich hoffe, es geht dir gut, irgendetwas, das ein wenig Mitgefühl erkennen ließ. Anscheinend glaubte er, dass die Rückgabe des Schlüssels ausreichte, um mir seine letzte Sicht der Dinge zu übermitteln. Und wirklich, ich hatte die Botschaft verstanden, hatte sie schon verstanden, als er mir am Telefon von dem Seitensprung mit dieser Isa erzählt hatte: Er wollte mich nicht mehr, wollte unsere Beziehung nicht mehr. Er wollte die andere Frau. Aber war das schon ausreichend, um eine dreijährige Beziehung wie die unsere zu beenden? Ein Anruf, ein kurzes Gespräch, ein zurückgegebener Schlüssel, und zack-bumm war alles vorbei? Müsste man sich nicht zusammensetzen, alles durchsprechen, genau analysieren, was da schiefgelaufen war? Aber dieses Bedürfnis war anscheinend ein einseitiges. Ich spürte, wie sich wieder Tränen der Wut einen Weg bahnen wollten, doch ich blinzelte sie entschlossen weg und konzentrierte mich auf den Weg. Da realisierte ich, dass ich über all meinen Gedanken gar nicht bemerkt hatte, wie nah ich der Petite Sorcière schon war.
Das strahlende Violett der Lavendelfelder erstreckte sich über die Hügel, ein lauer Wind bewegte die Blüten wellenartig auf und ab. Es war ein einziges duftendes lilafarbenes Meer. Nur weit im Hintergrund waren die felsigen Kanten zu erkennen, die die Verdonschlucht umgaben. Als mein Käfer einen weiteren Hügel erklommen und über den Scheitelpunkt gefahren war, eröffnete sich der Blick auf ein Landhaus, das einsam und umsäumt von den Lavendelfeldern da stand – die Petite Sorcière. In diesem Moment erschien mir der Anblick wie die Erlösung von all den Lasten, die ich während der Fahrt ohne Unterlass in Gedanken durchgewälzt hatte. Es schien, als müsste ich nur das Haus erreichen und könnte wieder frei sein, leicht, all das Gewicht abwerfen und durchatmen. Schon verstärkte sich der Druck meines Fußes auf das Gaspedal, und der Käfer gab noch einmal alles, um mich schnell zu meinem Schutzort zu bringen. Lautstark brummte der Wagen auf, schien einen kleinen Freudenhüpfer zu machen und schoss den Hügel hinab. Links und rechts von mir wurden die Lavendelblüten zu lila Blitzen, die meinen Endspurt beflügelten. Ich näherte mich dem Haus, nun waren seine hölzernen Balken, die weißen Wände und das dreieckig aufragende braune Dach zu erkennen, die ersten türkisfarbenen Fensterläden, die drei Stufen, die zur Eingangstür führten. Ich verlangsamte das Tempo, als ich die Abbiegung zum Grundstück erreichte, folgte ihr und fuhr über den sandigen Weg dem Ort entgegen, an dem ich all die Sommer meiner Kindheit verbracht hatte. Er war so vertraut, und doch wurde mir zugleich bewusst, wie viel Zeit seitdem vergangen war und dass ich nun schon so lange nicht mehr das kleine Mädchen war, das hier in den Feldern Verstecken gespielt und sich nachts vor dem Knarzen des alten Holzgebälks gegruselt hatte.
Kurz vor dem Haus bog ich auf einen Sandplatz ab, der zum Parken genutzt wurde. Kein anderes Auto stand hier, obwohl ich von Clem wusste, dass gestern zwei Gäste aus Großbritannien angekommen waren, die sie empfangen und eingewiesen hatte. Offenbar waren sie auf Entdeckungstour in der Umgebung. Ich blickte zur Eingangstür und erwartete fast, meine Großmutter zu sehen, wie sie dort stand, die Hände in die Hüften gestemmt, und rief: »Pepe, mach, dass du ins Haus kommst, hier wartet schon frische Limonade auf dich«, und dann, leiser: »Und Mandelplätzchen.« Doch da wartete niemand. Es dauerte jedoch keine fünf Sekunden, nachdem ich ausgestiegen war, da ertönte lautes Miauen, und schon tippelte mir Fuchur entgegen, der flauschige schneeweiße Kater, dessen Namen meine Schwester und ich hatten aussuchen dürfen, auch wenn meine Großmutter bis heute mit den klobigen deutschen Konsonanten haderte und ihn schlicht »Füsch« rief. Ich hob ihn auf den Arm und begrüßte ihn mit ausgiebigen Streicheleinheiten, die er mit seinem melodiösen Schnurren untermalte.
»Immerhin du bist noch hier, mein Lieber«, flüsterte ich ihm ins weiche Fell. »Ob du wohl verstehst, wo unsere Mamie gerade steckt?«
Mit Fuchur im Arm näherte ich mich dem Haus, ging aber rechts darum herum, angelockt von den rot-gelben Früchten am großen Pfirsichbaum an der Ecke. Es mussten die ersten des Jahres sein, nur wenige Pfirsichsorten brachten bereits im Juni reife Früchte hervor, so wie diese. Und wirklich stand Mamies Garten, den sie hier an der Hausseite angelegt hatte, bereits in voller Pracht. Überall leuchteten mir satte Farben entgegen, von den grünen Salatblättern, den roten Tomaten, den gelben Zitronen des Baums bis hin zu den vielen Kräutern in verschiedensten Grüntönen, die die Beete säumten.
Ich streichelte Fuchur und flüsterte: »Darum werden wir beide uns nun erst mal kümmern müssen, nicht?« Doch der Kater schien sich mit seinen zwölf Jahren nicht mehr bemüßigt zu sehen, irgendwo Hand beziehungsweise Pfote anlegen zu müssen. Er zappelte in meinem Arm, bis ich ihn absetzte, und stolzierte über die Beete hinweg in die Fliederhecke, die sich am Haus entlangzog. Es war die Hecke, in die Mamie gestürzt sein musste. Ich ließ den Blick hinauf zum Dachbodenfenster wandern. Ein Schauder überlief mich. Schnell ging ich zurück zum Auto, nahm den Koffer und die Handtasche heraus und stieg schließlich die drei Stufen zur Eingangstür hinauf. Mein Blick schweifte über das Messingschild an der Hauswand neben der Tür, über die kaum noch erkennbare Hexengestalt darauf, den Schriftzug mit dem Namen des Hauses. Als meine Großeltern es damals kauften, mussten sie nicht lange überlegen, wie sie ihre Pension nennen würden. Das Haus hatte ja bereits einen Namen, den es wohl schon getragen hatte, als die hölzernen Böden noch nicht so geknarzt hatten und die Wände frisch verputzt gewesen waren. Als das Schild noch geglänzt hatte und der Schriftzug deutlich zu lesen gewesen war.
Der Duft von altem Holz umfing mich, als ich über die Schwelle trat und mein Gepäck abstellte. Im Vorübergehen strich ich über das dunkle, grob gezimmerte Holzgeländer, welches die Treppe in das obere Stockwerk flankierte, wo sich die vier Gästezimmer und Mamies eigenes kleines Reich befanden. Überall im Haus lagen helle Flickenteppiche auf den Holzdielen. Die Möbel in den Zimmern hatte mein Großvater nach und nach zusammen mit einem befreundeten Tischler gebaut, und meine Großmutter hatte im Lauf der Jahre von Flohmärkten Kerzenständer, Bücher, alte Wecker, Bilderrahmen und Globen zusammengetragen, die sie liebevoll in den Räumen verteilt hatte. Auf der Flurkommode befand sich ein schwarzes Bakelittelefon mit Drehscheibe und Kabel, das mich, wann immer ich es benutzte, in andere Zeiten versetzte. Mein Blick streifte die Treppe. Entschlossen ließ ich Tasche und Koffer im Flur zurück und nahm die Stufen hinauf. Das obere Stockwerk ließ ich links liegen und wandte mich stattdessen der engen Treppe zu, die zum Dachboden führte. Ich musste einfach sehen, ob dort nicht irgendetwas zu finden war, das Mamies Unfall erklärte. Über die dunklen Stufen stieg ich nach oben, und als ich die Tür öffnete, war ich einen Augenblick lang so geblendet vom Sonnenlicht, dass ich kaum etwas erkennen konnte. Nur langsam gewöhnten sich meine Augen an die Helligkeit. Ich blieb auf dem Treppenabsatz stehen und sah mich um. Sonnenstrahlen fielen durch das offene Fenster und ließen den Staub in der Luft tanzen. In den Regalen links und rechts und überall im Raum standen Kartons und Kisten, Taschen und allerlei Krempel. Geradeaus war die Fensterbank, von der meine Großmutter gestürzt war. Ich bahnte mir einen Weg durch die Kisten, strich über das weiche Holz des Fensterbretts, das von der Sonne erwärmt war. Wie war Mamie wohl gefallen? Was hatte sie überhaupt nach oben geführt? Ich ließ den Blick über die gesamte Länge der Fensterbank fahren, doch sah ich erst mal nichts außer Kissen und Decken. Seitlich ließ ich mich darauf nieder und blickte hinab auf die Hecke, in die Mamie gefallen war. Der Gedanke an den Schmerz, den sie bei ihrem Aufprall empfunden haben musste, ja noch empfand, jagte mir Tränen in die Augen. Mir wurde schwindelig. Ich schloss das Fenster, lehnte mich zurück und ließ mich im Sitzen gegen eine der Seitenwände sinken. Tief atmete ich durch.
Ich musste Clem Bescheid geben, dass ich angekommen war. Langsam glitt ich von der Fensterbank, verließ den Dachboden und stieg ins Erdgeschoss hinab. Ich nahm mein Telefon aus der Handtasche und schlug den Weg zum Salon ein, der neben der Küche lag. Normalerweise umschmeichelten die warmen Farben der Läufer und Teppiche mein Gemüt, ebenso wie die gemütliche Essecke, wo an Regentagen und in der kühleren Jahreszeit das Frühstück aufgetragen wurde. Doch heute erinnerte mich alles hier an meine Großmutter und nährte die Sorge um sie. Ich ging durch den Raum, strich dabei über das dunkelbraune Klavier, das keine von uns, dafür aber so mancher Gast spielen konnte, und ließ mich auf einen der Sessel vor dem Kamin fallen. Es schien mir, als stimmten die Möbelstücke in meine Traurigkeit ein, als teilten sie meine Sorge und vermissten Mamies Lebendigkeit.
Ich atmete tief durch. Schwere schlich sich in meine Hände und Füße. Als ich hier saß und die Gegenwart meiner Großmutter so stark spürte, drang zu mir durch, was das Geschehene bedeuten könnte. Dass ich vielleicht nie wieder ein Wort mit Mamie würde wechseln können. Nie wieder sie anrufen, wenn ich an einem Tiefpunkt stand, um mir ihren Rat zu holen. Nie wieder ihr Lachen hören. Alles kam mit einem Mal zusammen, die Sorge, die Wut, die Traurigkeit, die Erschöpfung durch die lange Fahrt. Tränen stiegen mir in die Augen, und dieses Mal ließ ich ihnen freien Lauf.
2
Eine Stunde später saß ich im Auto meiner Schwester, einem alten BMW-Cabrio, auf dem Weg zum Riezer Krankenhaus. Clémence wirkte gefasster als am Telefon. Ihre Locken wirbelten im Fahrtwind um ihr Gesicht, und immer wieder wandte sie sich mir zu und beobachtete meine Reaktionen auf ihren Redestrom, der in dem Moment begonnen hatte, als ich sie angerufen hatte, um ihr mitzuteilen, dass ich im Haus angekommen war, und beinahe lückenlos wieder einsetzte, als ich auf ihr Hupen hin auf den Vorplatz der Petite Sorcière eilte.
»Es ist ein Rätsel, Pepe. Niemand weiß, was passiert ist, oder kann es sich zusammenreimen, es ergibt einfach keinen Sinn. Wir hatten Glück, dass ein Bauer auf dem Lavendelfeld sie fallen gesehen und sofort den Notarzt gerufen hat. Sie liegt auch nicht länger auf der Intensivstation. Aber sie ist so benommen und kommt irgendwie nicht richtig zu sich. Pepe, es ist schrecklich, sie so daliegen zu sehen.« Clem warf mir von der Seite her einen kurzen Blick zu. Ihre Augen waren mit schwarzem Kajal umrandet und vom Weinen gerötet. Ich ahnte, was sie gestern durchlitten haben musste, als sie von dem Unfall erfahren hatte.
»Was hat sie denn nur dort oben gemacht?«
Früher war Mamie nur hin und wieder auf dem Dachboden gewesen, um etwas dorthin zu verbannen, was nie wieder seinen Weg in die unteren Stockwerke finden sollte. Aber das war vielleicht einmal in drei Jahren vorgekommen.
»Ich bin wirklich froh, dass du da bist«, unterbrach Clem meine Gedanken. »Ich weiß nicht, wie wir das sonst alles hinbekommen sollten. Heute früh war ich in der Pension, um das Frühstück für die beiden Gäste zuzubereiten, aber ich kann das nicht jeden Tag übernehmen, ich muss mich ja um die Buchhandlung kümmern. Ich habe zwar eine Aushilfe, die mir zur Hand geht, aber die kann das nicht alles alleine bewerkstelligen. Und Gaspard hat im Restaurant alle Hände voll zu tun.« Die Arbeit als Koch hielt Clems Mann ziemlich auf Trab. »Meinst du, du könntest in der Petite Sorcière mithelfen? Nur solange du Zeit hast, natürlich. Ich versuche, so schnell wie möglich jemanden zu finden, den wir einstellen können, bis Mamie wieder auf den Beinen ist, und vielleicht sogar darüber hinaus, falls ihr die ganze Arbeit dann zu viel sein sollte …« Sie brach ab, und ich spürte, wie viel Angst um Mamie sie hatte. Was sie nicht aussprach, war unser beider Sorge, dass Mamie vielleicht gar nicht wieder auf die Beine kommen könnte. Ich legte eine Hand auf ihren Arm.
»Wir kriegen das hin. Ich übernehme natürlich erst mal alles.«
»Nur bis du zurück zu deiner Arbeit musst«, sagte Clem und lächelte mir dankbar zu.
»Da muss ich nicht mehr hin. Ich wurde gefeuert«, platzte es aus mir heraus.
»Was?« Clem machte einen kleinen Schlenker. Hinter uns hupte ein Auto, und Clem winkte dem Fahrer beruhigend zu, bevor sie ruckartig weiterfuhr.
»Jep, und das ist noch längst nicht alles. Aber das erzähle ich dir nachher.«
Wir bogen auf den Parkplatz des Krankenhauses ein. Mit einer geübten Bewegung lenkte Clem den Wagen in eine kleine Lücke vor dem kantigen Gebäude.
»Unbedingt. Ich will alles hören!« Sie stellte den Motor ab und zog den Schlüssel heraus. »Mamie liegt in einem Einzelzimmer, deshalb können wir außerhalb der Besuchszeiten zu ihr.«
Beklommen stieg ich aus dem Wagen und folgte meiner Schwester durch die Glastüren in das Krankenhaus. Wir liefen endlose Gänge entlang, die alle gleich aussahen, weiß und gelb bepinselt, etwas abgehalftert und steril. Endlich hielt Clémence vor einer Tür und drückte ohne ein Klopfen die Klinke hinunter. Und dort lag sie, dünn und blass, die weißen Haare um ihren Kopf auf dem Kissen verteilt, die Augen geschlossen. Das weiße Krankenhausnachthemd betonte die Geisterhaftigkeit ihres Aussehens noch. Durch das kleine Fenster und die gestickten Vorhänge fiel Licht in den Raum. Einige Sonnenstrahlen, durch das Muster gebrochen, tanzten mit den Bewegungen des Vorhangs über Mamies Gesicht. Ich ging zum Bett und nahm die kühle Hand meiner Großmutter in die meine.
»Mamie«, hauchte ich.
Clem warf ihr einen liebevollen Blick zu, gab ihr einen Kuss auf die Stirn und flüsterte eine Begrüßung, bevor sie sich den Blumen auf dem Tisch zuwandte. Mit einem »Dass sich aber auch niemand darum kümmert, da wurde einfach das Wasser vergessen« schnappte sie sich einen Strauß mit traurig herabhängenden Blütenköpfen und war schon wieder zur Tür hinaus.
Ich setzte mich verloren auf die Bettkante, meine Hand noch immer um die meiner Großmutter geschlossen, und versuchte, die Tränen zurückzuhalten. Sanft streichelte ich über ihre Hand.
»Mamie, was hast du nur gemacht?«, fragte ich sie leise. Sie atmete ruhig. Nach einigen Momenten zogen die Gerätschaften um sie herum meine Aufmerksamkeit auf sich. Ein Schlauch führte von Mamies anderer Hand zu einem Infusionsbeutel über ihrem Bett, ein Gerät piepte gleichmäßig im Takt ihres Herzens. Ein weiterer Beutel hing am Bettrand und war über einen Drainageschlauch, der unter der Bettdecke verschwand, mit ihrem Körper verbunden. Es sah beängstigend aus.
Da hörte ich es plötzlich. Ein heiseres Keuchen. Meine Augen richteten sich auf ihr Gesicht. Und ich sah, wie ihre Lider zuckten. Ich erschrak, mein Blick flog zu der Anzeige, um ihren Herzschlag zu kontrollieren. Vielleicht sollte ich besser die Schwester rufen? Doch ihr erneuter Versuch, etwas zu sagen, hielt mich zurück. Ich beugte mich näher zu ihr, um sie zu verstehen.
»Buch … das Backbu…«, kam es krächzend aus ihrem Mund.
»Pinou, hier ist Pinou. Mamie, bist du wach?« Pinou, so nannte nur sie mich, und ich hoffte, dass ihr der Name helfen würde, mich zu erkennen.
»Extra … ge… wis… Ex…«
»Mamie, bist du wach?«
»Ex… Buch«, wiederholte sie.
Delirierte sie? Ich wollte ihr so gerne helfen, die Worte zu dem Sinn zusammenzufügen, der ihr vorschwebte, aber ich war völlig verloren. Mamie schien sich aufzuregen. Ihre Augenlider flatterten, wieder bewegte sie die Lippen und versuchte, etwas zu sagen.
»Bu…«, doch weiter kam sie nicht. Die Silbe versiegte tonlos, die Lider beruhigten sich, und die Atmung verlangsamte sich wieder.
Ich rührte mich nicht, wartete, ob sie nochmals sprechen oder sich regen würde. Da öffnete sich die Tür hinter mir, und Clémence kam schnellen Schrittes herein, eine Vase mit den Blumen in der Hand.
»Ich habe den Schwestern gesagt, dass sie sich mehr darum kümmern und in eine Vase durchaus auch Wasser füllen müssen.« Ihr Blick fiel auf mein Gesicht. »Was hast du?«
»Mamie war wach, sie hat gesprochen.«
»Sie hat gesprochen?« Clem warf einen ungläubigen Blick auf unsere still daliegende Großmutter und dann wieder auf mich. »Was hat sie gesagt?«
»So was wie ›Buch‹ und ›Extra‹.«
Clem sah mich mit gerunzelter Stirn an. »Vielleicht hat sie geträumt. Ich hole die Schwester, sie sollen sie sich ansehen.« Und wieder war sie zur Tür hinaus.
Der Arzt, den die Krankenschwester auf unser Drängen hin geholt und dem wir von Mamies Verwirrung berichtet hatten, war noch jung, mit quietschgelben Turnschuhen an den Füßen, die nicht recht zu dem Ort passen wollten. Er untersuchte Mamie, zog ihre Lider hoch und strahlte mit einer kleinen Lampe in ihre Augen. Dann wandte er sich uns zu.
»Nun, wie Sie ja bereits wissen, hat Madame Mariaux eine Gehirnerschütterung erlitten«, begann er mit leicht näselnder Stimme und fuhr sich über den dünnen Schnurrbart. »Die Desorientierung und Apathie sind typische Symptome. Ihre Großmutter ist mitgenommen und erschöpft. Außerdem wurden ihr Schmerzmittel verabreicht, die ebenfalls zu der Desorientierung beitragen können. Wie lange der Zustand anhalten wird, können wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen.« Immer wieder wechselte sein Blick von seiner Patientin zu Clem und mir. »Schwerwiegender dürften die Frakturen sein, und davon gibt es einige. Wir haben multiple Brüche im linken Fuß, zwei Rippen sind angebrochen, die Hüfte müssen wir im Blick behalten. Ich gehe davon aus, dass sie bereits zuvor wegen ihrer Hüftgelenksarthrose behandelt wurde. Durch den Sturz hat sie sich Prellungen im Beckenbereich zugezogen, die ihre Schmerzen mit Sicherheit verstärken. Nun ja, an sich dürften solche Verletzungen eigenständig heilen. Da Madame … ähm«, er warf einen Blick auf die Krankenakte, »Madame Mariaux mit ihren achtundsiebzig Jahren allerdings schon betagter ist, können keine exakten Prognosen zur Dauer des Heilungsprozesses aufgestellt werden. Wir werden die Patientin genau beobachten.« Damit beendete er seinen Bericht, fuhr sich nochmals über den Schnurrbart, warf Clem einen Blick zu, und als keine Frage kam, sagte er in weniger offiziellem Ton: »Fahren Sie nach Hause, erholen Sie sich ein wenig von dem Schrecken. Wenn sich etwas an ihrem Zustand ändert, werden wir Sie umgehend benachrichtigen.«
Wir dankten ihm, blieben noch eine Weile unschlüssig an Mamies Bett stehen und machten uns dann auf den Weg. Ich wollte gerade etwas sagen, als ich Clem leise fluchen hörte. Sie sah auf ihr Handy und tippte ungeduldig darauf herum.
»Entschuldige, Pepe, ich muss mich beeilen. Meine Aushilfe hat mir einen halben Roman getextet. Offenbar ist in der Buchhandlung gerade Land unter. Irgendein Problem mit dem Bestellprogramm, das wird mich den ganzen Abend kosten. Ich setze dich nur schnell ab, ja?« Während der Fahrt versuchte sie per Headset das Gröbste zu lösen, während ich meinen Gedanken über Mamie nachhing. Als wir die Petite Sorcière erreichten, hielt sie mit einer Hand das Mikrofon des Headsets zu.
»Entschuldige, Pepe, dass ich es so eilig habe. Ich möchte unbedingt hören, was in Berlin passiert ist.«
»Keine Sorge, wir finden schon noch die Zeit, jetzt bin ich ja erst mal hier.«
»Gut, dann bis morgen, Kleine! Ich melde mich, falls ich etwas höre.« Und schon rauschte sie davon.
Das Haus war dunkel, als ich es betrat, und still. Kein Licht brannte in der Küche, und auch der Salon war unbeleuchtet. Die Gäste hatten sich offenbar auf ihre Zimmer zurückgezogen. Ich ging in die Küche und füllte Fuchurs Napf. Auch wenn von dem Kater gerade nichts zu sehen war, wusste ich, dass er irgendwann auf der Suche nach Futter durch die Katzenklappe hereintapsen würde. Für mich selbst holte ich ein Croissant aus dem Brotkorb, das noch vom Frühstück übrig geblieben sein musste. Ich setzte mich im Wohnzimmer in den Sessel vor dem unbefeuerten Kamin, lauschte den Geräuschen des Hauses, dem Knacken der Balken, dem Wind, der sanft am Haus entlangwehte und die Lavendelfelder ringsum in ein beruhigendes Rauschen versetzte, und knabberte an dem trockenen Gebäck. Meine Gedanken wanderten wieder zu Mamie, zu dem Unglück, das ihr mit diesem Unfall widerfahren war. Wieder fragte ich mich, wie es dazu hatte kommen können. Wieso war Mamie auf dem Dachboden gewesen, und was war dort oben passiert, dass sie aus dem Fenster gestürzt war? Ich konnte mir die Szene einfach nicht vorstellen. Ob sie das Fenster putzen oder aus irgendeinem Grund reparieren wollte und dabei abgerutscht war? Aber dann hätte man doch Putzutensilien beziehungsweise Werkzeug finden müssen. Was sonst hätte sie dort hinaufführen sollen? Ich dachte an Mamie, an die lebhafte Großmutter aus meiner Erinnerung und an die blasse alte Frau, die ich heute im Krankenhaus gesehen hatte, und schüttelte den Kopf. Wie plötzlich sich das Leben verändern konnte, wie schnell man ins Straucheln geraten und mit einem Schlag alles verlieren konnte. Die Vorstellung jagte mir Angst ein. Was, wenn Mamie es nicht schaffte? Bevor ich den Gedanken zu Ende denken konnte, schob ich ihn beiseite. Mamie würde es schaffen, sie hatte bisher schon so vieles geschafft. Ich musste einfach an sie glauben und sie unterstützen, so weit es mir möglich war.
Nach einer ganzen Weile, die ich reglos dagesessen hatte, richtete ich mich mühsam auf. Ich stapfte kraftlos in den Flur und öffnete die Tür zu dem kleinen Abstellraum, der als Büro benutzt wurde. Dort hing das Schlüsselbrett. Ich registrierte, welche Zimmer die beiden Gäste belegt hatten, und nahm den Schlüssel des kleinsten Zimmers auf der oberen Etage. Dann holte ich den Koffer, den ich hinter der Salontür verstaut hatte, und schulterte meine Handtasche. Stufe um Stufe ging ich die Treppe nach oben. Ich schaltete das Deckenlicht des Zimmers an und warf einen Blick hinein: Es sah sauber aus, das Bett, das links von mir an der Wand stand, war frisch bezogen. Ob ich das nun meiner Schwester zu verdanken hatte oder Mamie die Betten schon für die Sommergäste vorbereitet hatte – ich murmelte einen dankbaren Gruß und sandte ihn gedanklich an beide. Durch das leicht geöffnete Fenster an der gegenüberliegenden Seite drangen das nächtliche Zirpen der Zikaden und das Rauschen der Felder. Der süßliche Duft des Lavendels hing im ganzen Raum. Den Koffer ließ ich vor dem Bett stehen. Ich legte meine Handtasche auf den weiß lackierten Schreibtisch, der an der Fensterseite stand, und kramte mein Handy heraus, um den Wecker für morgen früh zu stellen. Dann bereitete ich mich für das Zubettgehen vor. Ob ich schlafen konnte, war zwar ungewiss, die Spirale meiner Gedanken würde mich nur schwer Ruhe finden lassen, aber ich würde den Rhythmus einhalten, zu dem ich mich zwang: Abends legte man sich ins Bett und schloss die Augen, um morgens aufzustehen und seine alltäglichen Pflichten zu erfüllen. Und meine Pflicht war es nun, für Mamie da zu sein.