

Buch
Sommer in Sag Harbor, Long Island. Für Emma, die im American Hotel die Gäste empfängt, bedeutet das Hochsaison. Auch ihr guter Freund, der Maler Henry Wyatt, kam einst als Sommergast – und blieb. Als er unerwartet stirbt, vermacht er seine Villa mitsamt allen Kunstwerken Emmas Tochter Penny. Diese ist ebenso überrascht wie Henrys einstige Geliebte Bea. Was hat er sich bei diesem Testament nur gedacht? Bald stößt Bea auf eine Spur: Offenbar hat Henry an verschiedenen Orten in Sag Harbor Zeichnungen hinterlassen. Zeichnungen, die eine Botschaft enthalten und ihrer aller Leben für immer verändern werden …
Weitere Informationen zu Jamie Brenner
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Jamie Brenner
Das Erbe
eines Sommers
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Sylvia Strasser
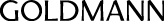
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019
unter dem Titel »Drawing Home«
bei Little, Brown and Company, Hachette Book Group, Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2020
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Jamie Brenner
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Jakob Valling/getty images und FinePic®, München
Redaktion: Regina Carstensen
LS · Herstellung: ik
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-24727-0
V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz





Für meine Georgia
»Es ist unmöglich, eine perfekte Mutter zu sein, aber es gibt eine Million Möglichkeiten, eine gute Mutter zu sein.«
Jill Churchill, Schmutz und Sühne
»Mein liebes Mädchen, wann begreifst du, dass es nicht unbedingt eine Tugend ist, normal zu sein? Im Grunde handelt es sich nur um einen Mangel an Mut.«
Tante Frances in Zauberhafte Schwestern (1998)
An den Sommerwochenenden hatte man das Gefühl, das American Hotel in Sag Harbor sei der Nabel der Welt. Die Einheimischen kamen, um sich einen Drink zu genehmigen, und die Touristen in der Hoffnung, eins der acht Zimmer zu ergattern.
Es war der Freitag vor dem Memorial Day, also noch nicht offiziell Sommer, aber doch beinahe. Die Busse der Hampton-Jitney-Linie hielten direkt vor dem Hotel und spuckten stündlich eine neue Ladung Besucher aus Manhattan aus.
Emma Mapson, die in Sag Harbor geboren war, beobachtete schon lange, wie der sommerliche Touristenstrom von Jahr zu Jahr anschwoll. Sie hatte gesehen, wie immer noch schickere Restaurants und an der Main Street immer noch mehr Luxusboutiquen eröffnet worden waren. Eines aber war über die Jahre gleich geblieben, und das war das American Hotel. Der Kolonialbau aus rotem Backstein mit den antiken Holzmöbeln, den Gemälden mit maritimen Motiven an den Wänden und den Tiffany-Leuchtern sah noch genauso aus und fühlte sich auch noch genauso an wie zu der Zeit, als Emma ein junges Mädchen gewesen war. Im Empfangsbereich standen dieselbe abgewetzte Couch und derselbe Backgammontisch, an dem sie von ihrem Vater Backgammon gelernt und sie selbst es ihrer eigenen Tochter beigebracht hatte. Alles schien sie aufzufordern: Na los, genieß das Leben ein bisschen! So hatte es sich jedenfalls bisher angefühlt.
Eine Frau näherte sich dem Empfang und sagte: »Es gibt da ein paar Dinge, die mich an meinem Zimmer stören.«
»Oh, das tut mir leid«, erwiderte Emma, warf einen Blick auf das von Hand ausgefüllte Reservierungsbuch und versuchte herauszufinden, mit welchem Gast sie es zu tun hatte. »Was genau stört Sie denn?«
»Einfach alles!«, antwortete die Frau. »Es gibt keine einzige Steckdose, damit ich mein Telefon aufladen kann, es gibt keinen Fernseher und keinen Wandschrank.«
Emma setzte routiniert eine neutrale Miene auf. Zu verständnisvoll, und es kam einem Eingeständnis gleich, dass tatsächlich einiges im Argen lag; zu verwirrt, und der Gast fühlte sich provoziert. Eine ausdruckslose Miene war das Unverfänglichste.
»Ihr Name, Ma’am?«, fragte Emma.
»Stoward.« Sie sagte es so langsam und deutlich, als hätte sie es mit jemandem zu tun, der gerade erst lesen und schreiben gelernt hatte.
Emma sah die Einträge im Reservierungsbuch durch. Die Frau war im Cooper-Zimmer untergebracht. Es stimmte schon, einen Fernseher gab es dort nicht, genauso wenig wie in allen anderen Zimmern. Und einen Wandschrank gab es auch nicht, aber dafür einen großen antiken Schrank. Steckdosen allerdings hatte es genug. Ihr war völlig schleierhaft, wieso die Frau keine finden konnte.
»Mrs Stoward, ich …« Emma schaute auf. Ihr Blick fiel auf einen vertrauten dunklen Lockenkopf auf der anderen Seite der Halle.
Nirgendwo in der Stadt konnte man die Leute besser beobachten als vom Empfang des American Hotel aus. Emma wusste nie, wer es sich als Nächstes auf dem Sofa bequem machen würde, von dem aus man sowohl einen Blick auf die Main Street als auch auf die immer volle Hotelbar hatte. Manchmal schaute sie auf und sah den Hafenmeister der Stadt dort sitzen, vielleicht auch einen Touristen aus dem Mittleren Westen, einen Promi-Koch oder Billy Joel, einen Einheimischen. Am glücklichsten aber war sie, wenn es sich bei der Person, die auf dem begehrten Platz saß, um ihre vierzehnjährige Tochter Penny handelte – so wie jetzt gerade.
Pennys schmale Gestalt war wie üblich über einen Zeichenblock gebeugt. Emma konnte ihr Gesicht nicht sehen, weil es von ihren Haaren verdeckt wurde. Oh, diese Haare! Als Penny noch ganz klein war, hatten die Leute auf der Straße sie immer auf die Lockenpracht ihrer Tochter angesprochen. Emma sah zu ihr hin, als könnte sie sie durch bloße Willenskraft dazu bewegen aufzuschauen. Ein Blick in Pennys Augen – große, dunkle Augen, ganz anders als ihre eigenen – genügte, und Emma wusste, wie ihre Tochter gelaunt war. Lag es an dem schwierigen Alter oder an Pennys Charakter? Die Geschwindigkeit, mit der ihre Launen wechselten, war jedenfalls nicht zu unterschätzen.
Emma wandte sich wieder dem Hotelgast zu. »Ich komme gleich zu Ihnen rauf und werde sehen, was ich tun kann. Nur einen kleinen Augenblick, ja?«, sagte sie lächelnd, um Zeit zu gewinnen. Sie musste wissen, weshalb Penny so früh aus der Schule zurück war. Als die Frau außer Sichtweite war, schlüpfte sie hinter dem Empfang hervor.
Penny, die in ihrer Schultasche kramte, schien ihre Mutter nicht zu bemerken.
»Hi, Schatz«, sagte Emma. »Wieso bist du nicht in der Schule?«
Penny hob ihren Kopf und schob sich ihre Locken aus dem Gesicht.
»Heute war doch nur vormittags Unterricht. Verlängertes Wochenende. Vergessen?«
Richtig! »Stimmt, das hab ich in der Tat.« Sie beugte sich hinunter und wollte ihre Tochter in die Arme nehmen, aber Penny entzog sich ihr. Emma richtete sich wieder auf und versuchte, nicht verletzt zu wirken. »Okay. Und, was hast du für Pläne?«
»Ich werde mich zu Mr Wyatt setzen. Aber erst muss ich noch ein Buch kaufen.« Sie sah ihre Mutter mit jenem treuherzigen Hundeblick an, der besagte: Ich brauche Geld.
Emma seufzte. »Kannst du es nicht in der Bücherei ausleihen?«
»Die haben es noch nicht, und ich will es Mr Wyatt unbedingt heute noch zeigen.«
Emma drehte sich um und sah zu der Ecke hinüber, wo der alte Mann, ein weltberühmter Künstler, mit dem sich Penny trotz des Altersunterschieds angefreundet hatte, spätnachmittags immer saß. »Na schön. Aber stör ihn jetzt nicht, er unterhält sich gerade.« Sie ging mit Penny zur Rezeption hinüber, wo sie ihr einen Zwanziger zusteckte. Ihre Tochter beugte sich vor und drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
»Jetzt weiß ich wenigstens, was es kostet, in der Öffentlichkeit ein kleines Zeichen deiner Zuneigung zu bekommen«, bemerkte Emma trocken.
Penny verdrehte die Augen und eilte Richtung Ausgang.
Das Telefon läutete. Emma hob ab, nahm eine Zimmerreservierung entgegen und ging dann in den zweiten Stock hinauf, um zu sehen, was sie für ihren unzufriedenen Gast tun konnte.
»Na endlich«, empfing Mrs Stoward sie. Sie war nicht allein im Zimmer. Auf der Kante eines der beiden Messingbetten saß ein Mann – Mr Stoward vielleicht? – und tippte eifrig auf seinem Handy herum. Er blickte nicht einmal auf.
»Verstehen Sie jetzt, was ich meine?« Mrs Stoward machte eine weit ausholende Handbewegung, als wollte sie sagen: Schauen Sie sich das mal an! Ist das nicht furchtbar?
Emma ließ ihren Blick durch das Zimmer schweifen. Ein antiker Ganzkörperspiegel, eine Couch mit rot-golden gestreiftem Bezug, zwei Dominy-Stühle. Außerdem ein wunderschöner Schrank, groß genug für eine komplette Garderobe.
Es machte sie rasend, wenn Sommergäste den Charme des Hotels nicht zu schätzen wussten. Es war 1843 erbaut worden, aber die Leute erwarteten die Annehmlichkeiten eines modernen Four Seasons. Sag Harbor war eine geschichtsträchtige kleine Stadt, doch das interessierte die wenigsten. Wussten sie, dass von hier aus einst Walfänger mit ihren Booten in See gestochen waren? Es an diesem Ort eine Schriftstellerkolonie gab? Eine historische afroamerikanische Gemeinde, die Teil der Underground Railroad war, dem Netzwerk, das Sklaven zur Flucht verholfen hatte? Dass John Steinbeck hier gewohnt hatte? Nein, das Einzige, was die Touristen interessierte, waren Restaurantempfehlungen.
»Hier ist eine Steckdose, sehen Sie?« Emma bückte sich und zeigte auf eine, die vom Bein eines Holzschreibtischs verdeckt wurde.
»Schön, damit wäre ein Problem gelöst«, bemerkte Mrs Stoward, die Hände in die Hüften gestemmt.
Emma ging zum Schrank und öffnete ihn. »Ich kann Ihnen gern noch mehr Kleiderbügel bringen lassen. Sie werden sehen, hier geht eine Menge rein.«
Mrs Stoward musterte den Schrank misstrauisch. »Ist das Zedernholz?«
»Benutz den verdammten Schrank doch einfach, Susan«, murmelte der Mann.
»Und was ist mit dem Fernseher?«, wollte Mrs Stoward wissen.
Jetzt hob der Mann den Kopf und sah Emma gereizt an. »Ja, wir brauchen einen Fernseher hier drin. Um sieben wird ein Spiel übertragen.«
Emma wollte gerade zu der Erklärung ansetzen, dass es im Hotel keine Fernseher gab, als von unten ein gellender Schrei heraufdrang.
»Entschuldigen Sie mich bitte.« Emma eilte aus dem Zimmer und zur Treppe, wo ihr eine Servicekraft entgegengelaufen kam.
»In der Bar ist jemand umgekippt!«, keuchte sie.
Umgekippt? Es war noch früh am Nachmittag. Hatte trotzdem schon jemand zu tief ins Glas geschaut? War alles schon passiert.
»Habt ihr einen Krankenwagen gerufen?« Emma rannte die Treppe hinunter und stieß die Holztür zwischen Treppenhaus und Eingangshalle auf, obwohl sie wusste, dass nicht selten ein Teewagen oder ein Tisch dort stand und den Zugang verbarrikadierte. Aber die Verandatür zu benutzen und außen herum zum Vordereingang zu gehen würde zu viel Zeit kosten.
Zum Glück stand heute nichts im Weg. Emma eilte zur Rezeption, wo das schwarze Festnetztelefon stand, und wählte die 911.
»Hier ist Emma Mapson vom American Hotel. Schicken Sie bitte einen Krankenwagen, einer unserer Gäste ist ohnmächtig geworden.« Der Koordinator in der Notrufzentrale wollte Näheres wissen, aber von ihrem Platz aus konnte sie den am Boden Liegenden nicht sehen, und ihr Telefon war kein schnurloses. Manchmal stellten die altmodischen Eigenheiten des Hotels eine echte Herausforderung dar. Sie hätte ihr Handy benutzen sollen, aber auf das lückenhafte Mobilfunknetz in dieser Gegend war kein Verlass.
Kellner und Servicekräfte hatten sich um den Gast geschart. Chris, der Barkeeper, kniete am Boden und versuchte zu helfen. Er schien zu wissen, was er tat. Emma wäre nicht überrascht, wenn er auch Rettungssanitäter wäre. Fast alle, die in der Stadt arbeiteten, waren mehr oder weniger Allrounder, die verschiedene Jobs hatten. Der Typ, der am einen Abend eine Essensbestellung entgegennahm, steuerte am nächsten Tag vielleicht das Wassertaxi.
Emma ließ ihren Blick über die Gesichter schweifen, während sie rätselte, ob der Gast am Boden ein Einheimischer oder ein Tourist war. Einige Stammgäste kehrten sommers wie winters jeden Tag zur Happy Hour ein. Selbst wenn draußen ein Schneesturm tobte, konnte man sie hier antreffen. Sie waren der harte Kern, für den das American Hotel ein Club war.
Ihr fiel auf, dass ein Barhocker leer war, und zwar der an der Ecke zur Halle.
O nein! Eine böse Ahnung beschlich sie. Sie hoffte inständig, dass sie sich irrte.
***
Penny überquerte die Main Street und machte sich auf den Weg zur Buchhandlung. Ihrer Meinung nach hatte die Stadt zwei große Pluspunkte: die Buchhandlung und BuddhaBerry, die Joghurteisdiele. Wenn sie zwischen diesen beiden pendelte, würde sie das verlängerte Wochenende schon irgendwie rumkriegen.
Zu viel Freizeit bekam ihr nicht. Da fing sie an zu grübeln.
»Denk doch an etwas Schönes, etwas, für das du dankbar sein musst, und sei es nur eine Kleinigkeit, anstatt dir immerzu Sorgen zu machen«, hatte ihre Mom gesagt.
Etwas, für das sie wirklich dankbar war, war, dass sie die achte Klasse bald hinter sich hatte. Es war ein brutales Jahr gewesen. In Mathe wäre sie um ein Haar durchgerasselt. Robin, ihre beste Freundin, hatte kaum noch Zeit für sie, seit sie zu der angesagten Clique gehörte – den Mädchen mit den vom Glätteisen superglatten Haaren und den neuen iPhones und den trendigen Klamotten. Dann, im Dezember, war auch noch das einzige Kino der Stadt abgebrannt. Ein totaler Schock für alle. Ein historisches Gebäude, und der Brandgeruch hatte noch Wochen später über der Main Street gehangen. Die Lücke mit den Trümmern sah hässlich aus, das schon, aber Peggy staunte doch über das Ausmaß der allgemeinen Betroffenheit.
»Das ist symbolisch, weißt du«, sagte ihre Mutter. »Es ist der plötzliche Verlust. Zu vieles hier verändert sich, deshalb will man einfach an manchen Dingen festhalten.«
Ohne Kino gab es einen Zeitvertreib weniger, um die einsamen Wochenenden zu füllen. Und den nahen Sommer.
Aber wenigstens hatte sie noch die Buchhandlung, Harbor Books.
Im Laden roch es nach den Früchten und Gewürzen von der Dobrá Tea Bar im hinteren Teil des Raums. Alexis Pine, die Mittzwanzigerin, der der Laden gehörte, hatte Penny schon Monate vor der Eröffnung der Teebar von ihren Plänen erzählt. Tee – Oolong-Tee, Pu-Erh-Tee, Grüntee – war Alexis’ ganz große Leidenschaft. Sie hatte lange Haare, die einmal blond gewesen waren, jetzt aber jenen pinkfarbenen Rotstich hatten, der vom Färben mit Kool-Aid kam, und sie trug flippige, ausgefallene Sachen. So wie sie wollte Penny auch sein. Alexis hatte außerdem zwei Katzen in ihrem Laden und im hinteren Teil eine Sammlung alter Bücher in einer Glasvitrine, und sie wusste erstaunlich gut über Graphic Novels Bescheid.
Sie stand hinter der Ladentheke, als Penny eintrat. »Hey, Penny! Dein Buch ist da.«
Pennys Manga- und Superheldenphase schwächte sich ab. Stattdessen begann sie, sich für realistische Graphic Novels wie Ein Sommer am See von Jillian und Mariko Tamaki zu interessieren.
Penny schob die Zwanzigdollarnote, die sie von ihrer Mutter erhalten hatte, mit den Fingerspitzen über den Ladentisch, wobei sie versuchte, sie so wenig wie möglich zu berühren.
»Und, was hast du am Wochenende vor?«, fragte Alexis, als sie ihr das Wechselgeld herausgab.
Penny steckte es schnell ein, holte dann das verbotene Purell-Gel aus der Tasche und gab einen großen Klecks auf beide Hände. Das Desinfektionsmittel brannte auf ihrer vom vielen Waschen trockenen, rissigen Haut.
»Weiß noch nicht genau«, antwortete sie.
Es war ihr peinlich zuzugeben, dass sie keine Pläne fürs Wochenende hatte. Warum kam sie sich neuerdings wie eine totale Versagerin vor? Das Gefühl rührte nicht bloß daher, dass sie keinen Dad hatte – jedenfalls keinen, der da war – oder dass sie in einem Haus wohnte, das klein war und im falschen Teil der Stadt stand. Nein, ihr Anderssein fühlte sich von Woche zu Woche tiefer, unabänderlicher an.
Das war auch der Grund, warum sie sich in Gesellschaft älterer Menschen wohler fühlte. Ihnen schien nichts Ungewöhnliches an ihr aufzufallen. Die meisten waren einfach nur nett. Und so hatte sie es sich angewöhnt, praktisch jede freie Minute in dem Hotel zu verbringen, in dem ihre Mutter arbeitete.
Dorthin ging sie jetzt auch zurück, weil sie Mr Wyatt ihr neues Buch zeigen wollte.
Mr Wyatt hatte weißes Haar, trug immer ein Tweedjackett und benutzte einen Gehstock von Fabergé, der aus Nephrit, einem jadeähnlichen Schmuckstein, gefertigt war. Sein Stammplatz war an der Ecke der Bar, wo er mit dem Rücken zur Empfangshalle saß und mit niemandem redete, weil er die ganze Zeit damit beschäftigt war, etwas auf eine Serviette zu kritzeln. Sie hatte erst nach einiger Zeit bemerkt, dass einige dieser Zeichnungen gerahmt und im Speisesaal aufgehängt worden waren. An dem Abend, als ihr das aufgefallen war, hätte sie ihre Mutter gern gefragt, was es damit auf sich hatte, aber sie wusste, dass ihre Mom sie dann nach Hause geschickt hätte – sie hatte sie in der stets vollen Bar bisher nur nicht gesehen. Und so fragte sie den alten Mann: »Wie haben Sie es geschafft, dass die hier Ihre Zeichnungen aufgehängt haben?«
»Oh, eigentlich hatte ich gar nichts damit zu tun. Sie haben sie aus dem Müll gefischt oder aus einem Haufen zerknüllter Servietten herausgesucht.«
Es dauerte einen Augenblick, bis sie das verarbeitet hatte. Dann sagte sie: »Ich zeichne auch.« Zeichnen war eines der wenigen Dinge, die ihr Freude machten.
»Erstaunlich, dass jemand aus deiner Generation das Telefon lange genug aus der Hand legt, um zu Papier und Bleistift zu greifen«, erwiderte er.
»Ich darf kein Smartphone haben«, sagte Penny. Sie litt an der Zwangserkrankung OCD sowie Angststörungen, und das Handyverbot war in puncto Freundschaften nicht gerade hilfreich.
»Du darfst kein Telefon haben, aber du darfst in Bars herumlungern?«, sagte er.
»Meine Mutter arbeitet hier.« Sie zeigte unauffällig mit dem Finger auf sie. »Deshalb komm ich her.«
Der alte Mann schaute zu ihrer Mutter hinüber, dann sah er wieder Penny an. Zum ersten Mal lächelte er. »Emmas Tochter. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar.« Das war eine Lüge. Ihre Mutter war wunderschön und sie, na ja, sie nicht.
Nach diesem Abend bat Mr Wyatt sie, ihm ihre Bilder zu zeigen. Sie trafen sich in der Empfangshalle und setzten sich auf die Couch. Penny trank eine Limo, er bestellte sich Martinis und erklärte ihr, wie man Konturen zeichnete und Proportionen richtig erfasste. Etwa einen Monat später fiel ihr auf, dass Henrys Skizzen nicht nur im Hotel hingen: Sie waren überall in der Stadt anzutreffen. Henry war berühmt.
Sie trat aus der Buchhandlung auf die Straße hinaus, als ihr Telefon, ein beschissenes altes Klapptelefon, für das man sich schämen musste, ihr mit einem Klingelton den Eingang einer SMS meldete.
Sei nicht sauer. Klar kannst du zu der Party kommen. Ich schick dir die Adresse.
Penny ignorierte die Nachricht. Sie brauchte Robins Einladung nicht. Sie hatte etwas Besseres vor.
Sie ging zum Hotel zurück. Es dauerte einen Moment, bis sie die Streifenwagen bemerkte. Zwei standen in einem merkwürdigen Winkel direkt vor dem Gebäude. Der Verkehr wurde umgeleitet. Auf dem Bürgersteig hatte sich eine kleine Menschenmenge versammelt.
Penny zog den Kopf ein und versuchte, unauffällig die Veranda zu überqueren und zum Eingang zu gelangen.
Ein Officer hielt sie auf. »Da kannst du jetzt nicht rein, junge Dame!«
Er breitete die Arme aus und versperrte ihr den Weg. Penny überlegte, ob sie sich zur Rückseite des Hotels schleichen sollte. Doch dann …
»In der Bar ist ein älterer Mann tot zusammengebrochen«, sagte jemand. »Saß vor seinem Martini und fiel einfach tot um.«
»So möchte ich auch gehen«, sagte ein anderer.
Penny stand da wie versteinert. Ganz in der Nähe heulte die Sirene eines Krankenwagens. Sie presste sich beide Hände auf die Ohren. Jetzt hatte die Angst sie definitiv gepackt. Und mitten in dem ganzen Chaos rollte der Vier-Uhr-Bus heran. Als er am Straßenrand hielt, stiegen Dutzende Fahrgäste aus, mit Gepäck beladen, ihre Handys am Ohr. Penny, die nur noch wegwollte, war gefangen im Strom der Sommerferiengäste, die es kaum erwarten konnten sich zu amüsieren.
Nur wenige Dinge im Leben bereiteten Bea Winstead so viel Vergnügen wie ein Raum voller Menschen.
Bea, eine legendäre New Yorker Kunstmäzenin, war berühmt für ihre intimen kleinen Treffen, zu denen ungefähr hundert oder mehr Leute kamen, die sich aufgrund ihres Vermögens und ihrer Bereitschaft, ein Werk des nächsten großen Ausnahmetalents zu erstehen, das Recht auf eine Einladung erworben hatten. Hinzu kamen die Ehrengäste, jene glücklichen Künstler, die, wenn sie Beas Park-Avenue-Apartment betraten, nicht wussten, wovon sie im nächsten Monat die Miete ihrer Einzimmerwohnung in Greenpoint bezahlen sollten, und sich am Ende des Abends über einen Verkauf ihrer Werke im sechsstelligen Bereich freuen konnten. Seit mehr als vierzig Jahren war es diese spannende Verknüpfung von Kunst und Geld, die Beas Partys zu einem bedeutsamen Ereignis machte, wo das Unvorhersehbare für eine prickelnde Atmosphäre sorgte.
Doch jetzt schien es, als würde ihr Einfluss schwinden. Sie ließ ihre Blicke durch den Raum schweifen und stellte fest, wer alles fehlte. Hatten ihre Partys ihren Glanz verloren? Oder lag es am Memorial Day und dem verlängerten Wochenende, wenn alle in die Hamptons flohen? Gott, wie sie die Hamptons hasste!
»Kyle, sag den Leuten vom Partyservice, sie sollen mit ihren Getränkewagen mindestens anderthalb Meter Abstand von den Bildern halten!«
Ihr Assistent war ein gut aussehender junger Mann mit vollem Haar, strahlend blauen Augen und den markanten Zügen eines Filmstars. Sie hatte angenommen, dass er, als sie ihn das erste Mal in ihrem Apartmenthaus gesehen hatte, wo er verschiedene handwerkliche Arbeiten erledigte, so wie ihr Lieblingskellner im Aureole, der es bis in eine Sitcom geschafft hatte, genau das werden wollte, Schauspieler.
Aber als sie ihn fragte, hatte er geantwortet: »Nein, Ma’am, ich mag meinen Job, ich bin gern ein Mann für alles.«
Bea gefiel diese Einstellung. Freude an der Arbeit, egal welche, war wichtig. Das zeugte von einem anständigen Charakter. Und so hatte sie ihn um Hilfe beim Aufbau einer besonders komplizierten Kunstinstallation in ihrem Apartment gebeten. In der gleichen Woche kündigte ihre Assistentin. Warum nicht mal zur Abwechslung jemanden einstellen, der praktisch veranlagt ist?, hatte Bea gedacht. Sie hatte genug von diesen verträumten Kunstjüngern ohne nennenswerte Fähigkeiten. Also machte sie ihrem zukünftigen Assistenten ein Angebot, das so lukrativ war, dass er nicht ablehnen konnte.
Bea warf einen letzten prüfenden Blick auf die Gemälde, die Kyle für das Event an diesem Abend aufgehängt hatte. Die Bilder stellten überlebensgroße Blumen, Amöben oder Vögel dar. Der Künstler hieß Frank Cuban, stammte aus der Bronx und war sechsundzwanzig Jahre alt. Bea hatte die Ausstellung organisiert, weil sie einer alten Freundin einen Gefallen tun wollte. Sie kannte Joyce Carrier-Jones noch aus der Zeit, als die Galerien in der Tenth Street angesagt waren. Heute war Joyce die für die Zulassungen zuständige Dekanin an der renommierten New York Academy of Art, und Cuban war ein ehemaliger Schüler. Nicht nur im Leben, auch in der Kunst kam es auf die richtigen Beziehungen an.
Zur Ausstellung gehörte ein Werk in Acryl, Grafit, Holz und Nagellack. Ein anderes war ein Ölpastell auf Papier mit Edding-Stift und Sprühfarbe. Amüsant, ja. Innovativ, nein. Bea sehnte sich nach den alten Zeiten, in denen jedes Jahrzehnt eine oder zwei große Kunstströmungen hervorgebracht hatte. Sie vermisste das Gefühl, einen richtigen Star zu entdecken.
Aber der Schlüssel zu einem langen Leben war, nach vorn zu schauen. Zurückzublicken schadete nur.
Joyce Carrier-Jones kam herüber und reichte Bea ein Glas Wein. Joyce kleidete sich gern auffällig – Kaftane in kräftigen Farben und klobiger Keramikschmuck. Ihr schwarz gefärbtes Haar hatte vorn eine dramatische Silbersträhne, und ihre Brille mit der rechteckigen Fassung war überdimensional groß.
»Prost«, sagte Joyce. »Auf einen aufgehenden neuen Stern am Kunsthimmel! Weißt du, Bea, ich bewundere dich. Was für eine fantastische Karriere! Ich habe mir überlegt, ob ich nicht auch Künstler managen soll, so wie du es früher getan hast. Ich meine, es ist nie zu spät, oder?«
Bea hörte kaum zu. Sie hielt ihr Weinglas hoch und starrte es ungläubig an. Es hatte keinen Stiel! Hielt sich heutzutage denn niemand mehr an die Regeln?
»Das ist inakzeptabel!«, sagte sie.
»Hat es einen Sprung?«, fragte Joyce.
»Nein, es hat keinen Stiel! Weißwein serviert man doch nicht in einem stiellosen Glas!« Ihre freie Hand flatterte gereizt zu den großen Perlen, die sie um den Hals trug.
»Ach, Bea, das macht doch nichts. Man muss mit der Zeit gehen. Solche Gläser sind im Moment in.«
»Der Stiel ist nicht zur Dekoration da, sondern er erfüllt einen Zweck. Man fasst das Glas am Stiel, damit der gekühlte Wein nicht von den Händen erwärmt wird.«
Bea stürmte ärgerlich in die Diele hinaus und dachte zum tausendsten Mal, dass die größte Demütigung des Alters nicht der eigene körperliche Verfall war, sondern mit ansehen zu müssen, wie es mit der Welt bergab ging.
Bea war in Newport, Rhode Island, aufgewachsen, wo nur eines wichtiger war als die Etikette – die Religion. Sie war nur wenige Jahre nach dem Neuengland-Hurrikan von 1938 zur Welt gekommen, und was ihre Eltern über jene furchtbare Nacht erzählten, in der unzählige Menschen in den Tod gerissen wurden, sagte im Grunde alles über die Stadt aus. Als der tödliche Sturm über die Region fegte, traf ihre Nachbarin Grace Graham Wilson Vanderbilt gerade die Vorbereitungen für ein festliches Dinner. Sie ließ sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als ein Großteil ihrer Veranda von dem verheerenden Hurrikan weggerissen wurde. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse, und die geladenen Gäste mussten sich entscheiden, ob sie ihr Leben aufs Spiel setzen oder Grace Graham Wilson Vanderbilt vor den Kopf stoßen wollten. Von den dreißig geladenen Gästen erschienen nur drei nicht.
»Kyle, ich muss mit dir reden!« Bea schnippte mit den Fingern und winkte ihn zu sich, damit er sich um die Sache mit den Weingläsern kümmerte.
»Ich mit dir auch«, sagte er. »Sieh dir das mal an.«
Er reichte ihr sein Smartphone, auf dessen Homescreen eine Eilmeldung zu lesen war: Minimal-Art-Pionier Henry Wyatt mit 83 Jahren verstorben.
Vor ihren Augen verschwamm alles. Die Party, die Gemälde, die Weingläser – alles verblasste. Bilder eines anderen Saals voller Menschen vor vielen Jahrzehnten stiegen vor ihrem inneren Auge auf. Ein junger Mann mit schmal zulaufenden Fingern und Farbe unter den Nägeln. Sie schloss die Augen und sah ein schlauchähnliches Apartment, ein Zimmer hinter dem anderen, und an den Wänden lehnten lauter Gemälde. Erinnerungen stürmten auf sie ein, lebendig und überwältigend. Als wäre es gestern erst gewesen, sah sie sich und Henry auf einer Bank im Washington Square Park sitzen, pleite und verunsichert, aber jung; sie hatten ihr ganzes Leben noch vor sich.
Bea griff Halt suchend nach Kyles Arm. »Wirf alle raus. Pack meinen Koffer und hol den Wagen. Fahr zum Vordereingang.«
»Jetzt gleich?«
»Ja, jetzt gleich!«
»Wo willst du denn hin?«
»Wir fahren in die Hamptons.«
Zusätzlich zu ihren gewohnten Pflichten musste Emma auf einmal eine weitere wichtige Aufgabe übernehmen: einen Anschein von Normalität wahren.
Sie kannte zwar die Gerüchte, dass es im American Hotel spuken sollte, aber sie hatte noch nie erlebt, dass hier jemand tatsächlich gestorben war. Und ausgerechnet während ihrer Schicht. Das war Pech. Und noch größeres Pech war, dass es sich um jemand handelte, den sie kannte und mochte. Aber die Bar war proppenvoll und die Warteliste für einen Tisch im zweistelligen Bereich – sie hatte keine Zeit, über Henry Wyatt nachzudenken.
Ihr Boss hatte die Sache in die Hand genommen. Jack Blake, der Besitzer des Hotels, hatte in seinem Büro lange mit dem Polizeichef zusammengesessen und war jetzt damit beschäftigt, die Presse in Schach zu halten. Emma bemühte sich so zu tun, als ob es ein ganz normaler Freitagabend sei, und sich darauf zu konzentrieren, die Wünsche der Gäste zu erfüllen.
Chris Vincenzi, der Chefbarkeeper, gab ihr ein Zeichen mit der Hand.
Zu den Barkeepern des Hotels hatte Emma eine besondere Beziehung. Das rührte zum Teil daher, dass ihr Vater ebenfalls Barkeeper gewesen war. Sie war noch sehr jung gewesen, als er starb, und in gewisser Weise stellte die Hotelbar eine Art Verbindung zu ihm dar. Sie schätzte die Barkeeper aber auch aus dem einfachen Grund, dass sie ihr ihre Arbeit erleichterten.
Die Bar war der Mittelpunkt des Hotels. Wenn die Cocktails in Strömen flossen und die Unterhaltungen eine fiebrige, schrille Tonlage erreichten, wenn die Gäste sich aus einer perfekten Mischung von Einheimischen und Touristen, von Wohlhabenden und einfachen Arbeitern, von Jung und Alt zusammensetzten, war die Welt in Ordnung. Die Stimmung riss selbst den anspruchsvollsten Hotelgast mit. Als Emma sich um einen Job im Hotel beworben hatte, war es ihr größter Wunsch gewesen, hinter der Bar zu stehen. Aber Jack Blake hatte in seiner ganzen Zeit als Hotelbesitzer noch nie einen weiblichen Barkeeper eingestellt. Sexistisch? Vielleicht. Die Jungs in der Bar nannten es Tradition. Manchmal fragte sie sich, ob ihr Vater das auch so gesehen hätte.
»Em, kannst du mir bitte diesen Wein holen?« Chris kritzelte den Namen eines ganz bestimmten Châteauneuf-du-Pape auf eine Barserviette. »Ich glaube nicht, dass einer von den Kellnern ihn finden wird, und ich kann im Moment unmöglich hier weg.«
Jack nahm das Thema Wein sehr ernst. Er hatte Anfang der Siebzigerjahre begonnen, eine Sammlung aufzubauen, und inzwischen umfasste die Weinkarte über fünfundachtzig Seiten mit etwa tausendsiebenhundert Weinen. Obwohl Emma seit fast zwölf Jahren im Hotel arbeitete, staunte sie manchmal immer noch über das komplizierte Labyrinth des Weinkellers. Als sie an den Weinregalen entlangging, schoss ihr plötzlich ein Gedanke durch den Kopf: Penny! Sie hatte seit Stunden nicht an ihre Tochter gedacht. Für Penny würde Henry Wyatts Tod ein schwerer Schlag sein. Emma hoffte, dass sie es von ihr und nicht von irgendjemand sonst oder aus dem Internet erfahren würde.
Wenn sie zwölf oder vierzehn Stunden am Stück arbeitete, bekam sie Penny praktisch kaum zu Gesicht – das war das Schlimmste an ihrem Job. Die Stadt war zwar sicher, jeder kannte jeden, aber dennoch war es alles andere als ideal, wenn eine Vierzehnjährige nach der Schule sich selbst überlassen war. Penny war ein gutes Kind, und doch konnte alles Mögliche passieren. Und wenn im Hotel Hochbetrieb herrschte und Emma viel um die Ohren hatte, war es, als hätte sie keinerlei Bezug mehr zu ihrer anderen, sehr viel wichtigeren Aufgabe – nämlich Mutter zu sein. Eine alleinerziehende Mutter.
Der Weinkeller hatte ein Nummernsystem, und manchmal irrte sie zwischen den Regalen umher wie jemand, der sich in einer fremden Gegend vergeblich mithilfe einer Landkarte zu orientieren versuchte, aber heute fand sie die gesuchte Flasche auf Anhieb. Einen Paul Jaboulet Aîné 2010 Domaine de Terre Ferme Rouge, Châteauneuf-du-Pape. Okay, wenigstens das hatte geklappt. Vielleicht war das ja ein Zeichen, dass doch noch etwas aus dem Abend werden würde.
Sie ging wieder hinauf, brachte den Gästen den Wein an den Tisch und eilte zum Empfang, wo das Telefon klingelte.
»The American Hotel, Sie sprechen mit Emma.«
»Emma, hier ist Jim DiMartino.«
Jim DiMartino war seit zehn Jahren beim Sag Harbor Police Department. Er war als einer der Ersten eingetroffen und hatte geholfen, als Henry Wyatt zusammengebrochen war.
»Hi, Jim. Falls Sie den Chief suchen, der ist schon vor einer ganzen Weile wieder gegangen.«
»Ehrlich gesagt rufe ich wegen etwas anderem an. Penny ist hier bei mir auf dem Revier.«
In der Bar herrschte ein solcher Lärm, dass Emma nur Bruchstücke verstand. Irgendetwas von einer Party und Minderjährigen, die Alkohol getrunken hatten, und einem Auto, das in der Fahys Road rückwärts in ein Haus gekracht war. Penny hatte nicht getrunken, aber sie war zusammen mit den anderen festgenommen worden.
Emma blickte sich ratlos um. Alle Tische besetzt, Gedränge in der Hotellobby, die Bar brechend voll.
»Ich bin gleich da«, sagte sie. Zum Glück lag das Polizeirevier nur zwei Häuser weiter. Sie würde Penny abholen und dann Angus anrufen, damit er sie nach Hause brachte. Angus hatte zur Miete im Nachbarhaus gewohnt und war nach dem Tod seiner Frau vor fünf Jahren bei Emma und Penny eingezogen. Das hatte zum Teil finanzielle Gründe gehabt: Warum Miete für ein Haus bezahlen, in dem er ganz allein wohnte? Angus und Celia hatten ihr eigenes Haus schon Jahre vorher verkauft. Die gestiegenen Grundsteuern stellten für alle eine enorme Belastung dar, sogar für Besitzer bescheidener Eigenheime in billigen Wohngegenden. Emma kannte viele, die zu drastischen Entscheidungen gezwungen gewesen waren.
Der Hauptgrund für Angus’ Umzug aber war ein Versprechen, das er seiner Frau gegeben hatte. Celia, die auf Penny aufgepasst hatte, seit diese ein Baby war, wollte nicht, dass ihr Mann nach ihrem Tod allein lebte. »Der Mann war achtundfünfzig Jahre verheiratet«, hatte sie zu Emma gesagt. »Er wird allein nicht zurechtkommen. Ich möchte nicht wissen, was er essen würde, wenn niemand nach ihm guckt!« Sie wollte, dass jemand da war, der sich um ihn kümmerte und ihn umsorgte, und so nahm sie Angus und Emma das Versprechen ab, miteinander in einem Haus zu wohnen.
Emma rief ihn nicht gern so spät noch an. Angus arbeitete ehrenamtlich für die Sag Harbor Historical Society und im Walfangmuseum und ging normalerweise vor acht Uhr ins Bett. Außerdem sollte sie als Pennys Mutter ihre Tochter selbst nach Hause bringen. Aber so wie ein Kapitän auf der Brücke seines Schiffs blieb, musste sie an einem Freitagabend, wenn Hochbetrieb herrschte, die Stellung an der Rezeption halten. Sie hatte schon vor langer Zeit akzeptiert, dass es immer wieder Momente geben würde, wo entweder ihre Arbeit oder ihre Mutterpflichten auf der Strecke blieben.
Sie bog in die Gasse zwischen dem Rathaus und dem Restaurant Page ein. Die Fenster des Lokals standen offen, Musik und Gelächter erfüllten die Nacht.
Das Polizeirevier war zu klein für die vielen Teenager, die auf der Party aufgegriffen worden waren. Und so standen sie draußen in einer Reihe wie bei einer Feueralarmübung in der Highschool. An jedem einzelnen der jungen Gesichter klebte ein Smartphone. Emma ließ ihre Blicke suchend über die Gruppe schweifen. Penny, die mit ihren eins siebzig groß für ihr Alter war, war unter Gleichaltrigen normalerweise nicht zu übersehen. Ihre wilde Mähne stach ebenfalls hervor. Aber Emma konnte sie nirgends entdecken.
Sie ging hinein und sah Penny in Jims Büro neben seinem Schreibtisch sitzen.
»Danke, dass Sie angerufen haben.« Emma schüttelte dem Officer die Hand. Dann wandte sie sich ihrer Tochter zu. »Alles in Ordnung?«
»Ja, Mom, alles okay«, erwiderte sie leicht gereizt, als wäre Emma diejenige, die Ärger machte. In Augenblicken wie diesen wünschte sie sich einen Partner an ihrer Seite, dem sie einen Blick hätte zuwerfen und dann in komischer Verzweiflung die Augen hätte verdrehen können. Aber es half nichts, sie musste das allein durchstehen, und sie beide, ihre Tochter und sie, taten ihr Bestes.
»Du hast nicht gesagt, dass du auf eine Party gehst.«
»Das war ganz spontan. Und mein Telefon hat nicht funktioniert.«
Emma hatte keine Zeit für Diskussionen.
»Was für ein Abend«, bemerkte DiMartino.
»Ja, es wird nicht eine Sekunde langweilig«, sagte Emma. Obwohl das im Grunde nicht stimmte. Es war oft langweilig. Meistens sogar. Und dazwischen immer wieder kleinere Katastrophen. War das so, wenn man Mutter war – oder war das das Leben?
Sie ging mit Penny zur Main Street bis zu einer Bank vor einem Wegweiser zum Old Jail Museum, dem historischen Gefängnisgebäude. Sie befahl ihr, sich hinzusetzen und sich nicht vom Fleck zu rühren, bis Angus kommen würde.
Erst als sie wieder im Hotel war, fiel ihr ein, dass sie völlig vergessen hatte, Penny von Henry Wyatts Tod zu erzählen.
Manche Häuser hatten Adressen, andere hatten Namen. Das Haus, in dem Henry Wyatt die letzten dreißig Jahre seines Lebens verbracht hatte, gehörte zu Letzteren. Es war neun Uhr abends, als Bea in Sag Harbor eintraf. Kyle bog in die Actors Colony Road, eine strandnahe Privatstraße, ein, wo sich ein stattliches Anwesen ans andere reihte. Aber das Haus mit dem Namen Windsong übertraf alles – es glich einem Juwel in einer Krone.
Die Einfahrt führte seitlich am Haus vorbei und zu einer Garage im rückwärtigen Teil des Grundstücks. Henry hätte es niemals geduldet, dass der Anblick seines Hauses von parkenden Autos verschandelt wurde.
Kyle stieg aus und öffnete Bea die Wagentür. Als sie die kühle Nachtluft im Gesicht spürte, hätte sie fast das Gleichgewicht verloren. Das war real. Das passierte tatsächlich. Sie stand vor Windsong, aber Henry war nicht da. Henry war tot.
Während Kyle sich um das Gepäck kümmerte, ging Bea, einen einzelnen Schlüssel fest in der Hand, zur Haustür. Die Bewegungsmelder reagierten, die Außenbeleuchtung ging an. Kyle stieß einen leisen, bewundernden Pfiff aus, als er das Haus in seiner ganzen modernen, spektakulären Pracht erblickte.
Die Pläne für dieses architektonische Meisterwerk stammten von Henry persönlich. Er war Künstler durch und durch gewesen und keinem bestimmten Medium verpflichtet. Er war Maler, Zeichner, Bildhauer und der Architekt seines Hauses gewesen. Bea, die selbst weder Künstlerin noch besessen von kreativem Ehrgeiz war, hatte größten Respekt vor dem Talent anderer.
Der Minimalismus zog sich wie ein roter Faden durch Henry Wyatts Werk, und Windsong machte da keine Ausnahme. Das Haus, eine Kombination aus Holz, Stein und Metall, hatte einen offenen Grundriss und bodentiefe Fensterfronten.
Bea schob den Schlüssel ins Schloss. Obwohl sie ihn viele Jahre nicht mehr benutzt hatte, trug sie ihn seit dem Tag, an dem sie ihn von Henry bekommen hatte, an ihrem Schlüsselring.
Sie fand den Hauptlichtschalter auf Anhieb wieder.
»Ein Wahnsinnshaus«, bemerkte Kyle. Selbst bei Nacht bot das Ineinanderfließen von Innen- und Außenarchitektur einen atemberaubenden Anblick. »Bist du sicher, dass wir hier sein dürfen?«
»Habe ich einen Schlüssel oder nicht?«, fauchte Bea. Sie ging langsam weiter. Jedes Gemälde weckte Erinnerungen an ihren verstorbenen Freund. Zärtlich fuhr sie mit der Hand über einige seiner Plastiken, die überall im Haus mit Bedacht aufgestellt worden waren. Sie konnte es noch immer nicht glauben, dass Henry tot war.
Ein etwa achtzig auf hundert Zentimeter großes Ölgemälde war der Blickfang des Wohnzimmers. Die kräftigen grünen und schwarzen Pinselstriche hatten, wie alle seiner Gemälde, ein dominantes zentrales Element. Das Bild hatte viele Jahre im New Yorker Guggenheim Museum gehangen. Es hieß Greene Street, 1972, nach der Adresse der Galerie, die sie früher gemeinsam besessen hatten.
»Gehen wir nach oben.«
Wann war sie das letzte Mal hier gewesen? Sie hatte ganz vergessen, wie still es hier war. Sie blickte sich um. Fußböden und Decken waren aus weißem Eichenholz, die schlichten Türen hatten verdeckt liegende Zargen. Alles zeugte von durchdachtem Design und fügte sich harmonisch, ohne sichtbare Übergänge, zusammen. Jeder Zoll war Henry.
Den Medien zufolge hatte er einen tödlichen Herzinfarkt erlitten, aber Bea wollte sich nicht auf irgendwelche Spekulationen verlassen. Sie hatte Henrys Anwalt Victor Bonivent eine Nachricht hinterlassen, doch der hatte sich noch nicht gemeldet. Jetzt fragte sie sich, ob Victor überhaupt noch Henrys Anwalt war. Was wusste sie denn schon über Henrys Leben der letzten Jahre?
Die Treppe, die in den oberen Stock hinaufführte, vermittelte die Illusion, an einer weißen Wand entlang zu schweben. Bea überlegte, ob sie in Henrys Schlafzimmer gehen sollte, verwarf den Gedanken aber sofort wieder. Das würde sie emotional überfordern. Sie würde in einem der Gästezimmer schlafen.
Als Henry das Haus gebaut hatte, hatte sie sich jahrelang geweigert, ihn zu besuchen. Windsong war die Geliebte gewesen, die ihn von Manhattan weggelockt, ihn ihr gestohlen hatte. Der Bruch zwischen ihnen war nicht durch das Haus verursacht worden, aber in die Zeit gefallen, als es gebaut worden war, und so schien Windsong lange Zeit das Symbol ihrer zerbrochenen Freundschaft zu sein.
»Soll ich auspacken?« Kyle stand in der Tür eines Zimmers, dessen Fensterfront zur Bucht hin lag.
Bea machte eine wegwerfende Handbewegung. »Morgen.«
»Äh, Bea, wie lange werden wir denn bleiben? Übers Wochenende?«
Wie lange? Eine gute Frage. Wie lange brauchte man, um der Vergangenheit Ehre zu erweisen? Wie lange dauerte es, bis sie nicht mehr das Gefühl hatte, in die tosenden Wasser ihrer eigenen Vergänglichkeit zu blicken? Aber es war sinnlos, das einem zweiunddreißigjährigen Mann erklären zu wollen, der garantiert glaubte, er habe alle Zeit der Welt. Bea erinnerte sich gut an dieses Gefühl. Und es war untrennbar mit ihren Erinnerungen an ihre erste Begegnung mit Henry verbunden.
»Henry Wyatt war mein ältester Freund, Kyle. Und ich war im Grunde seine Familie, die einzige, die er hatte.« Sie konnte die Vergangenheit nicht ändern. Sie konnte Henry nicht wieder lebendig machen. Aber sie fühlte auf einmal eine Entschlossenheit, wie sie sie lange nicht mehr gekannt hatte. »Ich muss seinen Nachlass regeln. Er würde sich wünschen, dass ich mich um das Haus kümmere, das weiß ich. Wir werden bleiben, so lange es nötig ist.«
»Tut mir leid, dass meine Mom dich anrufen musste«, sagte Penny zu Angus.
Er warf ihr kaum mehr als einen flüchtigen Blick zu. Angus hatte weißes Haar und trug eine runde, randlose Brille. Er hatte die Figur eines ehemaligen Footballspielers: kräftig und breitschultrig und groß. Aber er war nicht Footballspieler, sondern Geschichtslehrer an der Highschool gewesen, und Penny war der Meinung, dass ihm der Ruhestand nicht sonderlich bekam. Seine Arbeit fehlte ihm. Wie sonst war es zu erklären, dass er ihr ständig Vorträge über die Geschichte von Sag Harbor hielt? Er sprudelte geradezu über vor Informationen. Ihre Mutter fand das total faszinierend, aber Penny hatte das Gefühl, beim Frühstücken mitschreiben zu müssen, und das gefiel ihr gar nicht.
Emma hatte ihr erzählt, dass sie sich nach dem Umzug in den Mount Misery Drive kurz nach Pennys Geburt sofort mit ihren neuen Nachbarn Angus Sinclair und seiner Frau Celia angefreundet hatte. Emma Mapson gehörte nicht zu den Zugereisten, die seit etwa zehn Jahren den Ort überschwemmten und jeden Preis für eine Immobilie bezahlten, sondern zu den Alteingesessenen. Genau wie die Sinclairs: Angus’ Familie war eine der ersten afroamerikanischen Familien gewesen, die sich in Ninevah Beach ein Ferienhaus gekauft hatten. In vielen anderen Teilen der USA war es Afroamerikanern damals, in den Vierzigerjahren, nicht erlaubt gewesen, ein Haus zu erwerben.
»Ich hab noch nicht geschlafen«, sagte Angus jetzt. Er hielt am Straßenrand vor ihrem Haus. »Ich hab mir die Nachrichten angesehen.« Er hatte eine so tiefe Stimme, dass alles, was er sagte, klang, als wäre es sehr wichtig. Heute klang er auch verärgert, aber das konnte auch daran liegen, dass sie ein schlechtes Gewissen wegen der Party hatte.
Penny ging hinein und huschte zur Treppe in den oberen Stock, weil sie jeder weiteren Unterhaltung aus dem Weg gehen wollte. Aber Angus war noch nicht fertig mit ihr.
»Ich hoffe nur, du machst keine Dummheiten, Penelope Bay Mapson«, sagte er.
Wenn Celia sie mit ihrem vollen Namen angeredet hatte, hatte Penny gewusst, dass es ihr bitterernst war. Den Namen Bay hatte Pennys Vater ausgesucht. Er und ihre Mutter hatten sich kennengelernt, als er einmal im Sommer im hiesigen Bay Street Theater in einem Stück aufgetreten war. Das war lange her, ihr Vater hatte die Stadt schon vor einer Ewigkeit wieder verlassen, aber der komische Name war Penny geblieben.
Sie ging in die Küche. »Nein, ich mach keine Dummheiten«, antwortete sie. Lügen, Lügen, nichts als Lügen.
Auf der Party war der Alkohol in Strömen geflossen: Es hatte Fassbier gegeben, Jell-O Shots, flaschenweise Wodka und Tequila. Als Penny hingekommen war, waren das Haus und die große Veranda direkt am Strand schon übersät mit roten Plastikbierbechern.
Penny traute sich nicht, Alkohol zu trinken. Ihre Mutter würde sie umbringen. Und da sie es bei der Arbeit ständig mit Betrunkenen zu tun hatte, würde sie das kleinste Anzeichen sofort bemerken. Während also alle anderen ihren Spaß hatten, begnügte sich Penny mit Zusehen. Keiner redete mit ihr. Keiner sah sie auch nur an. Und im Geist hörte sie immer noch das Heulen der Sirenen vor dem Hotel.
Auch wenn sie sich nicht sicher sein konnte, so wusste sie doch instinktiv, dass es Mr Wyatt war, der gestorben war. Sie hätte sich nur irgendjemandes Smartphone leihen und googeln müssen, aber sie hatte Angst vor der Wahrheit. Und dennoch musste sie unaufhörlich an ihn denken. Alle zehn Minuten war sie aufs Klo gegangen und hatte sich die Hände gründlich eingeseift und sie dann über das Waschbecken gehalten, bis sie einigermaßen trocken waren. Sie brachte es nicht über sich, das am Handtuchhalter hängende Handtuch zu benutzen. Irgendwann war dann Robin zu ihr gekommen und hatte ihr eine weiße Tablette angeboten, die so harmlos wie Aspirin aussah. Penny griff zu. Ihr war alles recht, was ihr die Flucht vor ihren eigenen Gedanken ermöglichte. »Keine Sorge, Mindy sagt, ihre Mutter wirft die ein wie Pfefferminzdrops«, hatte Robin gemeint.
Ungefähr eine halbe Stunde lang passierte gar nichts. Dann überkam sie von einer Sekunde zur anderen ein wohliges Glücksgefühl, als wäre sie in eine Zauberdecke gewickelt worden. Sie saß immer noch auf der Couch, sie wurde immer noch von den anderen ignoriert, aber sie spürte ganz deutlich, dass sich ihre Sorgen verflüchtigt hatten. Es war unglaublich.
Und dann schrie Jordan, Mindys ältere Schwester, auf einmal: »Die Bullen sind da!«
Ein Glück, dass sie die Finger von den Drinks gelassen hatte!
Angus brummte etwas vor sich hin, ließ sich in den Sessel neben dem Sofa fallen und schaltete den Fernseher mit der Fernbedienung ein. Während im Hintergrund die Nachrichten liefen, kramte Penny in den Küchenschränken. Sie fand eine Tüte Popcorn, schüttete es in eine Schüssel, ging ins Wohnzimmer zurück und bot es Angus an, der die Nachrichten mit gemurmelten missbilligenden Kommentaren verfolgte.
Und da sah sie das Laufband mit der Eilmeldung am unteren Bildschirmrand: KÜNSTLER HENRY WYATT IM ALTER VON 83 JAHREN VERSTORBEN.
Jetzt war es real. Mr Wyatt war tot. Und nicht einmal die kleine weiße Pille konnte etwas daran ändern.
Samstagmorgens herrschte im Hotel Hochbetrieb.
Emma kam normalerweise nicht dazu, eine Pause zu machen oder ihr Telefon auf Nachrichten zu überprüfen. Sie konnte froh sein, wenn sie kurz auf die Toilette konnte. Aber so war es eben, wenn man in der Gastronomie arbeitete. Doch Hochbetrieb hin oder her – Pennys Therapeutin, Dr. Alice Wang, hatte den vereinbarten Termin in der kommenden Woche absagen müssen und als einzige Alternative einen Termin am Samstag um zwölf anbieten können. In Anbetracht der Ereignisse vom Vorabend wollte Emma nicht, dass Penny eine Sitzung ausfallen ließ.
»Ich hol dich um halb zwölf ab«, hatte sie zu ihrer Tochter gesagt, als sie am Morgen das Haus verließ.
»Ich kann doch das Rad nehmen, und wir treffen uns dort«, sagte Penny. Für Emma wäre das bedeutend einfacher, aber Penny hatte Hausarrest.