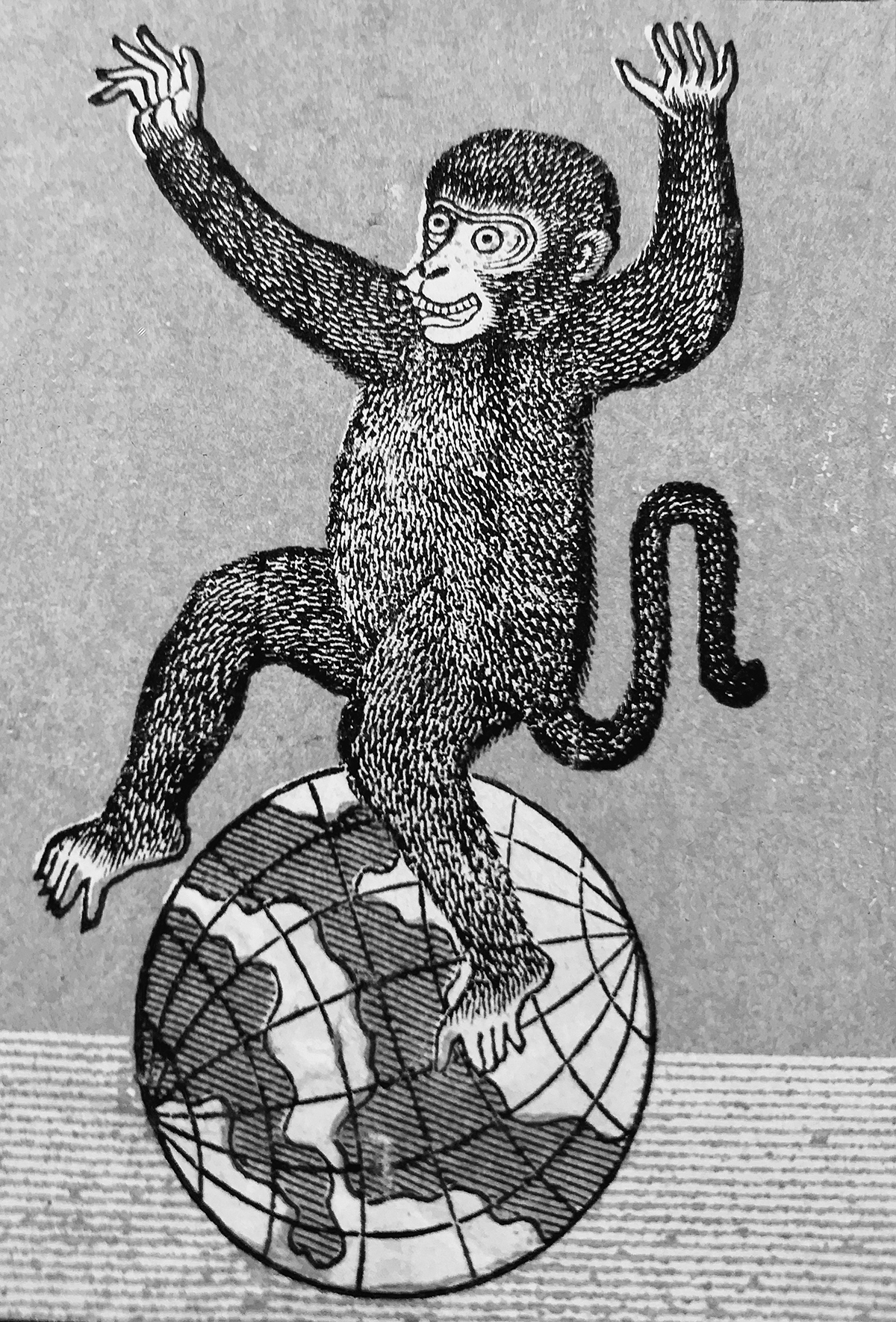
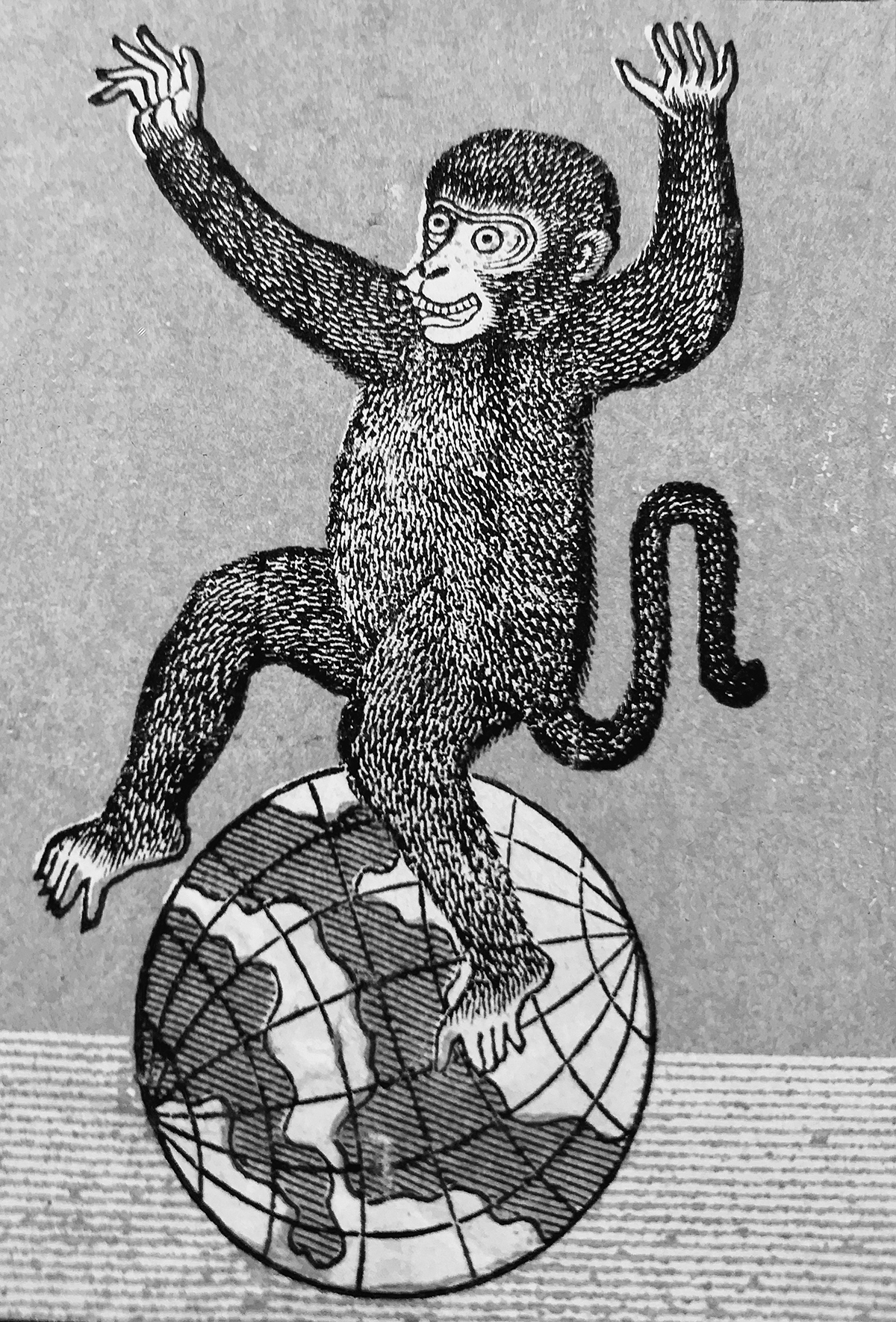
Eine tödliche Torheit kommt über die Welt.
– Antonin Artaud –
Es war weit nach Mitternacht, als wir vor dem Dream Motel hielten. Ich bezahlte den Fahrer, vergewisserte mich, dass ich alles hatte, und klingelte, um die Besitzerin zu wecken. Es ist drei Uhr nachts, sagte sie, gab mir aber trotzdem den Schlüssel und eine Flasche Mineralwasser. Mein Zimmer befand sich im untersten Stockwerk, mit Blick auf den langen Pier. Ich öffnete die Glasschiebetür und hörte das Rauschen der Wellen, begleitet vom leisen Bellen der Seelöwen, die ausgestreckt auf den Planken unter dem Kai lagen. Gutes neues Jahr!, rief ich. Gutes neues Jahr, wachsender Mond und telepathisches Meer.
Auf der gut einstündigen Fahrt von San Francisco hierher war ich hellwach gewesen, jetzt plötzlich fühlte ich mich schlapp. Ich zog den Mantel aus und ließ die Schiebetür einen Spalt offen, um den Wellen zu lauschen, fiel aber sofort in einen schlafähnlichen Zustand. Ich wachte jäh auf, ging ins Bad, putzte mir die Zähne, zog die Stiefel aus und legte mich ins Bett. Vielleicht träumte ich.
Neujahrsmorgen in Santa Cruz, ziemlich ausgestorben. Auf einmal überkam mich das Verlangen nach einem besonderen Frühstück: schwarzer Kaffee und Hafergrütze mit Frühlingszwiebeln. Die Chancen dafür standen hier nicht gut, aber eine Portion Eier mit Schinken würde es auch tun. Ich nahm meine Kamera und ging den Hügel hinunter Richtung Pier. Ein Schild, halb verdeckt von hohen, schlanken Palmen, ragte vor mir auf, und ich stellte fest, dass es gar kein Motel war. Auf dem Schild stand Dream Inn, und in der rechten Ecke prangte ein Strahlenkranz, der an die Sputnik-Ära erinnerte. Ich blieb stehen, um das Schild zu bewundern, und machte ein Polaroid, zog die Folie ab und steckte das Bild in meine Tasche.

– Vielen Dank, Dream Motel, sagte ich, halb an die Luft, halb an das Schild gerichtet.
– Es heißt Dream Inn!, korrigierte das Schild.
– Stimmt, sorry, sagte ich, leicht überrascht. Geträumt habe ich trotzdem nichts.
– Ach ja? Nichts?
– Nichts!
Ich kam mir vor wie Alice im Wunderland beim Verhör durch die Wasserpfeife rauchende Raupe. Um mich der prüfenden Energie des Schilds zu entziehen, senkte ich den Blick auf meine Füße.
– Trotzdem, danke für das Bild, sagte ich und wollte mich davonmachen.
Mein Weitergehen wurde jedoch durch das plötzliche Aufpoppen lebhafter Tenniel-Bilder vereitelt: Die falsche Suppenschildkröte. Der Fisch-Lakai und der Frosch-Lakai. Der Dodo, geschmückt in seinem einen prächtigen Jackenärmel, die hässliche Herzogin und der Koch, und schließlich Alice, die mürrisch eine endlose Teegesellschaft leitete, bei der, Verzeihung, kein Tee serviert wurde. Ich überlegte, ob die plötzliche Bilderflut selbst verschuldet oder der magnetischen Aufladung des Dream-Inn-Schilds zu verdanken war.
– Und was machst du jetzt gerade?
– Das ist mein Verstand!, rief ich entnervt, während die animierten Bilder sich rasend schnell vermehrten.
– Der wache Verstand!, gluckste das Schild triumphierend.
Um das Ganze zu stoppen, drehte ich mich weg. Aufgrund meines leichten Auswärtsschielens sehe ich tatsächlich oft, meistens rechts, solche hüpfenden Bilder. Außerdem ist mein Gehirn in vollem Wachzustand für alle erdenklichen Signale empfänglich, doch das wollte ich keinesfalls einem Schild gestehen.
– Ich habe nicht geträumt!, rief ich stur zurück und ging den Hügel hinunter, flankiert von flottierenden Salamandern.
Am Fuß des Hügels war ein niedriger Laden, auf dessen Fenster in ziemlich großen Buchstaben das Wort Kaffee stand, darunter ein Schild mit der Aufschrift Geöffnet. Wenn man dem Wort Kaffee so viel Platz einräumt, dachte ich, servieren sie bestimmt eine ziemlich gute Bohne und vielleicht sogar Donuts mit Zimt. Als ich jedoch die Hand auf den Türknauf legte, baumelte da ein kleineres Schild: Geschlossen. Keine Erklärung, kein In zwanzig Minuten zurück. Mich beschlich eine böse Vorahnung, was die Aussichten auf Kaffee anging, und eine noch bösere in Bezug auf Donuts. Wahrscheinlich lagen die meisten Leute noch mit einem Kater im Bett. Man kann es einem Café nicht verübeln, wenn es am Neujahrstag geschlossen bleibt, auch wenn Kaffee eigentlich das ideale Heilmittel nach einer durchfeierten Nacht wäre.
Ohne Kaffee setzte ich mich auf eine Bank vor dem Café und ging noch einmal die Ränder der vorigen Nacht durch. Es war der letzte von drei aufeinanderfolgenden Abenden, die wir im Fillmore in San Francisco auftraten, und ich zupfte gerade die Saiten meiner Stratocaster, als sich ein Typ mit fettigem Pferdeschwanz vorbeugte und auf meine Stiefel kotzte. Das letzte Röcheln von 2015, ein Sprühregen von Erbrochenem zur Einführung in das neue Jahr. Ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? In Anbetracht der Weltenlage schwer zu sagen. Mit solchen Gedanken beschäftigt, suchte ich in meinen Taschen das Zaubernuss-Tuch, mit dem ich normalerweise meine Kameralinse reinigte, kniete mich hin, wischte meine Stiefel ab und wünschte ihnen ein gutes neues Jahr.
Auf dem Rückweg ins Motel schlich ich vorsichtig an dem Schild vorbei, als eine Kette von merkwürdigen Wendungen aufblitzte. Ich suchte in meinen Taschen nach einem Bleistift, um sie aufzuschreiben. Aschgraue Vögel umkreisen die nachtbepuderte Stadt / Verlassene Wiesen, geschmückt mit Dunst / Ein mythischer Palast, der nur ein Wald war / Blätter, die lediglich Blätter sind. Das dichterische Einfallslosigkeits-Syndrom verlangt, dass man Ideen aus der launischen Luft pflückt wie Jean Marais in Cocteaus Orpheus, der sich am Stadtrand von Paris in einer alten Garage in einem ramponierten Renault verschanzt, das Radio einschaltet und Satzfetzen auf kleine Zettel schreibt – ein Tropfen Wasser enthält die Welt etc.
Zurück in meinem Zimmer, fand ich ein paar Tütchen Nescafé und einen kleinen Elektrokocher. Ich machte mir Kaffee, wickelte mich in eine Decke ein, öffnete die Schiebetür und setzte mich auf die kleine Veranda mit Blick auf das Meer. Eine niedrige Mauer blockierte teilweise die Aussicht, aber ich hatte meinen Kaffee, hörte die Wellen und war halbwegs zufrieden.
Dann dachte ich an Sandy. Eigentlich sollte er hier sein, nur ein paar Zimmer weiter. Wir hatten uns vor den Auftritten im Fillmore treffen und die üblichen Dinge tun wollen: im Caffè Trieste Kaffee trinken, im City Lights Bookstore Bücherregale durchstöbern, über die Golden Gate Bridge fahren und die Doors, Wagner und Grateful Dead hören. Sandy Pearlman, ein Freund, den ich seit über vierzig Jahren kannte, der in kurzen schnellen Sätzen Wagners Ring-Zyklus oder ein Riff von Benjamin Britten zerlegte, war immer da, wenn wir im Fillmore spielten, saß in seiner schlabbrigen Lederjacke und Baseballcap vor einem Glas Gingerale an seinem gewohnten Tisch hinter einem Vorhang nahe der Garderobe. Geplant war, dass wir uns nach dem Konzert am Silvesterabend absetzen und noch spät durch den dichten Nebel nach Santa Cruz fahren, um am Neujahrstag in seinem geheimen Taco-Lokal nicht weit vom Dream Motel zu Mittag zu essen.
Doch so weit kam es nicht. Sandy war am Tag vor unserem ersten Konzert bewusstlos auf einem Parkplatz in San Rafael gefunden und mit einer Hirnblutung in ein Krankenhaus in Marin County gebracht worden.
Am Morgen unseres ersten Konzerts gingen Lenny Kaye und ich in die Intensivstation in Marin County. Sandy lag im Koma, überall Schläuche, eingehüllt in gespenstische Stille. Wir standen je auf einer Bettseite und nahmen uns in Gedanken vor, bei ihm zu bleiben, eine Leitung offen zu halten und jedes Signal aufzufangen und anzunehmen. Nicht nur Scherben der Liebe, wie Sandy sagen würde, sondern das ganze Glas.
Wir fuhren in unser Hotel in Japantown zurück, kaum fähig zu sprechen. Lenny nahm seine Gitarre, und wir gingen ins On the Bridge, eine Kneipe, die sich an einem Verbindungssteg zwischen dem Ost- und Westteil der Mall befand. Dort saßen wir hinten an einem grünen Holztisch, beide starr vor Entsetzen. An den gelben Wänden hingen Poster von japanischen Mangas, Hell Girl und Wolf’s Rain, und Reihen von Comics, die eher Taschenbuchromanen glichen. Wir aßen, teilten uns feierlich einen Sake und brachen dann zum Soundcheck im Fillmore auf. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu beten und ohne Sandys begeisternde Präsenz zu spielen. Wir stürzten uns in den ersten von drei Abenden voller Feedback, Poesie, improvisierter Tiraden, Politik und Rock’n’Roll, spielten so hart, dass ich am Ende atemlos war, als könnten wir Sandy durch Schall und Musik erreichen.
Am Morgen meines neunundsechzigsten Geburtstags gingen Lenny und ich wieder ins Krankenhaus. Wir standen an Sandys Bett und schworen, ihn trotz aller Verpflichtungen nicht allein zu lassen. Lenny und ich sahen uns an, wir wussten beide, dass wir nicht bleiben konnten. Wir mussten arbeiten, Konzerte geben, unser Leben leben, egal wie nachlässig. Wir waren gezwungen, meinen neunundsechzigsten Geburtstag im Fillmore ohne ihn zu feiern. Am Abend, als wir If 6 Was 9 spielten, drehte ich der Menge während des Instrumentalteils den Rücken zu und kämpfte mit den Tränen, während ein Wortschwall sich über den nächsten legte und mit Bildern von Sandy vermischte, der noch immer bewusstlos auf der anderen Seite der Golden Gate lag.
Als wir unsere Arbeit in San Francisco erledigt hatten, ließ ich Sandy zurück und fuhr allein nach Santa Cruz. Ich brachte es nicht übers Herz, sein Zimmer zu stornieren, und ich saß hinten im Wagen, mit seiner Stimme im Kopf. Matrix Monolith Medusa Macbeth Metallica Sandys M-Spiel, das ihn, angelockt von einer samtenen Quaste, bis hin zur Library of Imaginos führte.
Ich saß auf meiner Veranda, eingehüllt in eine Decke wie eine Genesende aus dem Zauberberg, als mich plötzlich merkwürdige Kopfschmerzen befielen, geschuldet höchstwahrscheinlich einem plötzlichen Luftdruckwechsel. Auf dem Weg zur Rezeption, um mir eine Aspirin zu holen, stellte ich fest, dass mein Zimmer nicht im Erdgeschoss, sondern im Souterrain lag, was den Weg zum Strand verkürzte. Ich hatte das vergessen und ging verwirrt durch den schwach beleuchteten Flur. Da es mir nicht gelang, die Treppe zur Rezeption zu finden, gab ich das Aspirin auf und ging wieder zu meinem Zimmer zurück. Als ich nach dem Schlüssel griff, fand ich eine eng aufgewickelte Rolle Verbandsmull, ungefähr so dick wie eine Gauloise. Ich entrollte ein Drittel davon und rechnete fast damit, eine Botschaft zu finden, doch da war nichts. Ich hatte keine Ahnung, wie sie in meine Tasche gelangt war, aber ich rollte sie wieder auf, steckte sie zurück und ging in mein Zimmer. Ich schaltete das Radio ein, Nina Simone sang gerade I Put a Spell on You. Die Robben waren still, ich hörte nur die Wellen in der Ferne, Winter an der Westküste. Ich legte mich ins Bett und fiel in einen tiefen Schlaf.
Ich war mir sicher, im Dream Motel nicht geträumt zu haben, doch bei längerem Nachdenken stellte ich fest, dass dem nicht so war. Um genau zu sein, schlitterte ich am Rand eines Traums entlang. Die als Nacht maskierte Dämmerung enttarnte sich als Tagesanbruch und beleuchtete einen Weg von der Wüste bis zum Meer, dem ich bereitwillig folgte. Die Möwen kreischten und krächzten, während die Seelöwen schliefen, nur ihr König nicht, der eher einem Walross glich, seinen Kopf hob und die Sonne anbellte. Ich hatte das Gefühl, als wären alle verschwunden, wie in einer von J.G. Ballards Dystopien.
Der Strand war mit Süßigkeitenpapieren übersät, Hunderte, vielleicht Tausende lagen auf dem Sand verstreut wie Federn nach einer Mauser. Ich ging in die Hocke, um sie mir näher anzusehen, und steckte eine Handvoll ein. Butterfingers, Peanut Chews, 3 Musketeers, Milky Ways und Baby Ruths. Alle geöffnet, aber keine Spur von Schokolade. Niemand war in der Nähe, keine Fußabdrücke, nur ein Gettoblaster, halb verdeckt von einem Sandhaufen. Ich hatte meinen Schlüssel vergessen, aber die Schiebetür war nicht verschlossen. Als ich wieder in mein Zimmer trat, sah ich, dass ich immer noch schlief, und wartete bei geöffnetem Fenster, bis ich aufwachte.
Mein Doppel-Ich träumte weiter, selbst unter meinem wachsamen Blick. Ich stieß auf eine verblasste Reklametafel, die verkündete, dass sich das Bonbonpapier-Phänomen bis nach San Diego ausgebreitet hatte, zu einem kleinen Strand, den ich gut kannte, gleich neben dem Ocean Beach Pier. Ich folgte einem Fußweg durch endloses Sumpfland, gesäumt von verlassenen schiefen Hochhäusern. Aus den Rissen im Beton wuchsen lange, schlanke Grasbäume, deren Äste wie blasse Arme aus den toten Gebäuden ragten. Als ich den Strand erreichte, war der Mond aufgegangen und erhellte die Silhouette des alten Piers. Ich war zu spät gekommen, alle Papiere waren zu Haufen zusammengerecht und angezündet worden, bildeten eine lange Reihe aus giftigen Feuern, die trotzdem recht hübsch aussahen, weil sich das brennende Papier einrollte wie künstliches Herbstlaub.
Ein schattenhafter Traum, und er entwickelte sich noch weiter! Vielleicht war es eher eine Heimsuchung, eine Vorahnung künftiger Dinge, gleich einem riesigen Stechmückenschwarm, schwarze Wolken, die auf Fahrrädern taumelnden Kindern den Weg verdunkeln. Die Grenzen der Realität hatten sich so verschoben, dass es notwendig schien, eine Karte dieser neuen Topografie zu erstellen. Man benötigte lediglich ein wenig geometrisches Vorstellungsvermögen, um alles darzustellen. Hinten in der Schreibtischschublade lagen ein paar Pflaster, eine verblichene Postkarte, ein Kohlestift und ein zusammengefalteter Bogen Transparentpapier, was ich als großes Glück empfand. Ich klebte das Papier an die Wand und versuchte, dem rätselhaften Gebilde nachzuspüren, brachte aber nur ein bruchstückhaftes Diagramm zustande, das die ganze unwahrscheinliche Logik einer Kinderschatzkarte enthielt.

Verschwinden à la J.G. Ballard
– Denk nach, schimpfte der Spiegel.
– Setz deinen Verstand ein, empfahl das Schild.
Meine Tasche war vollgestopft mit Bonbonpapieren. Ich legte sie auf den Schreibtisch neben die Postkarte, ein Bild der Panama-Pacific International Exposition, was mich auf die Idee brachte, dass ich vielleicht nach San Diego fahren und mich selbst am Ocean Beach umsehen sollte.
Im Laufe meiner unergiebigen Analyse hatte ich mir einen ziemlichen Appetit geholt. In der Nähe entdeckte ich ein Diner, das Lucy’s, wo ich gegrillten Käse auf Roggenbrot, Blaubeerkuchen und schwarzen Kaffee bestellte. In der Nische hinter mir saßen ein paar Jugendliche, weit unter zwanzig. Ich hatte nicht darauf geachtet, was sie sagten, und eher dem Klang ihrer Stimmen gelauscht, die den Eindruck erweckten, als schwebten sie aus der am Tisch montierten und mit Münzen betriebenen Jukebox. Die Jukebox-Kids unterhielten sich leise, ein Summen, aus dem sich nach und nach Sätze schälten.
– Nein, es sind zwei Wörter, eine Adjektiv-Substantiv-Kombination.
– Auf keinen Fall, es sind zwei verschiedene Wörter, zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine ist ein Adjektiv, das andere ein Substantiv.
– Sag ich doch.
– Nein, du hast gesagt, es ist eine Kombination. Aber das stimmt nicht.
– So ein Schwachsinn, sagte eine neue Stimme. Plötzliches Schweigen. Der Sprecher hatte offenbar Autorität, denn alle waren still und hörten zu.
– Es ist ein Gegenstand. Eine Beschreibung. Ein Gegenstand, ich sag’s euch. Bonbonpapier ist ein Substantiv.
Ich horchte auf. Zufall oder was? Das Summen stieg wie Dampf von einem Block Trockeneis. Ich nahm meine Rechnung und blieb lässig an ihrer Nische stehen. Vier aggressiv coole Nerds.
– He, wisst ihr etwas darüber?, sagte ich und strich ein Papier glatt.
– Chews ist falsch geschrieben. Mit einem Z.
– Wisst ihr, woher das kommen könnte?
– Vielleicht ein Imitat aus China.
– Also, wenn ihr was hört, gebt Bescheid.
Während sie mich mit wachsendem Vergnügen musterten, nahm ich das unechte Peanut-Chews-Papier. Irgendwie war mir das falsche Z nicht aufgefallen. Die Frau an der Kasse öffnete gerade eine Rolle mit 25-Cent-Stücken. Mir fiel ein, dass ich kein Trinkgeld auf den Tisch gelegt hatte, und ich ging zu meiner Nische zurück.
– Übrigens, sagte ich und blieb vor den Teenies stehen, Bonbonpapier ist auf jeden Fall ein Substantiv.
Sie standen auf und zwängten sich an mir vorbei, ohne ein Trinkgeld zu hinterlassen. Mir fiel auf, dass jeder einen blauen Rucksack mit einem gelben Längsstreifen trug. Der letzte warf mir einen finsteren Blick zu. Er hatte dunkles, welliges Haar und schielte leicht mit dem rechten Auge, genau wie ich.
Mein Handy klingelte. Lenny rief an, um von Sandy zu berichten, allerdings gab es nichts Neues. Stabil, aber noch bewusstlos, wir konnten nur abwarten und beten. Ich schlenderte in einen Secondhandladen und kaufte spontan ein Batik-T-Shirt mit Jerry Garcias Gesicht. Hinten befanden sich zwei kleine Bücherregale mit Stapeln von National Geographic, Büchern von Stephen King, Videospielen und ungeordneten CDs. Ich entdeckte ein paar alte Nummern der Biblical Archaeology Review und ein abgegriffenes Taschenbuch von Gérard de Nervals Aurélia. Alles war billig, nur das Jerry-T-Shirt nicht, doch es war den Preis wert: Sein lächelndes Gesicht verströmte halluzinogene Liebe.
Zurück in meinem Zimmer, stellte ich überrascht fest, dass jemand mein Diagramm von der Wand genommen und aufgerollt hatte. Ich legte das Jerry-Shirt auf mein Kopfkissen, setzte mich in den Sessel und schlug Aurélia auf, kam aber kaum über den verlockenden ersten Satz hinaus. Unsere Träume sind ein zweites Leben. Ich driftete kurz in einen Revolutionstraum ab, Französische Revolution, mit jungen Männern in fließenden Hemden und Kniehosen. Ihr Anführer ist mit Lederriemen an ein schweres Tor gefesselt. Einer seiner Anhänger nähert sich ihm mit einer Fackel und hält sie ganz ruhig an die dicke Bindung, damit die Flamme sie durchbrennt. Der Anführer ist befreit, seine schwarzen Handgelenke von Blasen übersät. Er ruft nach seinem Pferd und erzählt mir dann, er habe eine Band namens Glitter Noun gegründet.
– Warum Glitter?, sage ich. Sparkle ist besser.
– Ja, aber Sparklehorse hat Sparkle schon verbraucht.
– Warum nicht schlicht und einfach Noun?
– Noun. Gefällt mir, sagt der Anführer. Nehmen wir Noun.
Er steigt auf seinen gescheckten Appaloosa und zuckt zusammen, als die Zügel sein Handgelenk streifen.
– Pass auf dich auf, sage ich.
Er hat dunkles welliges Haar und ein wanderndes Auge. Er nickt, reitet mit seinen Leuten in die ferne Pampa und hält an, um Wasser aus einem tosenden Fluss zu schöpfen, in dessen Strömung die gleichen falsch bedruckten Bonbonpapiere schwimmen wie kleine bunte Fische.
Ich wachte unvermittelt auf und schaute auf die Uhr, es war kaum Zeit vergangen. Zerstreut nahm ich eine der Biblical Reviews zur Hand. Ich habe sie immer gern gelesen, wie Ableger von Detektivgeschichten, stets kurz davor, ein aramäisches Fragment zu enthüllen oder die Reste von Noahs Arche aufzuspüren. Der Titel klang ziemlich faszinierend. Tod am Toten Meer! Wurde König Saul an die Mauern von Bet Sche’an genagelt? Ich grub in meinem Gedächtnis und hörte das klangvolle Mantra der Frauen, die die Rückkehr ihrer Männer aus der Schlacht bejubeln. Saul hat Tausend erschlagen, / David aber Zehntausend. Ich suchte in der Schublade nach einer Gideon-Bibel, aber sie war in Spanisch verfasst. Dann fiel mir ein, dass Saul, verwundet durch einen feindlichen Pfeil, sich selbst in sein Schwert gestürzt hatte, um dem demütigenden Spott und der Folter der Philister zu entgehen.
Ich sah mich im Zimmer nach einer anderen Zerstreuung um, nahm meine Decke und ging wieder auf die Terrasse, wo ich mehrere Minuten lang die Peanut-Chewz-Hülle untersuchte, sich mir aber nichts erschloss. Ich hatte das ausgeprägte Gefühl, dass gleich etwas passieren würde, und befürchtete, es könnte etwas Schlimmes sein, etwas völlig Unerwartetes oder, noch schlimmer, ein tief greifendes Nicht-Ereignis. Ich schauderte und dachte an Sandy.
Gidget