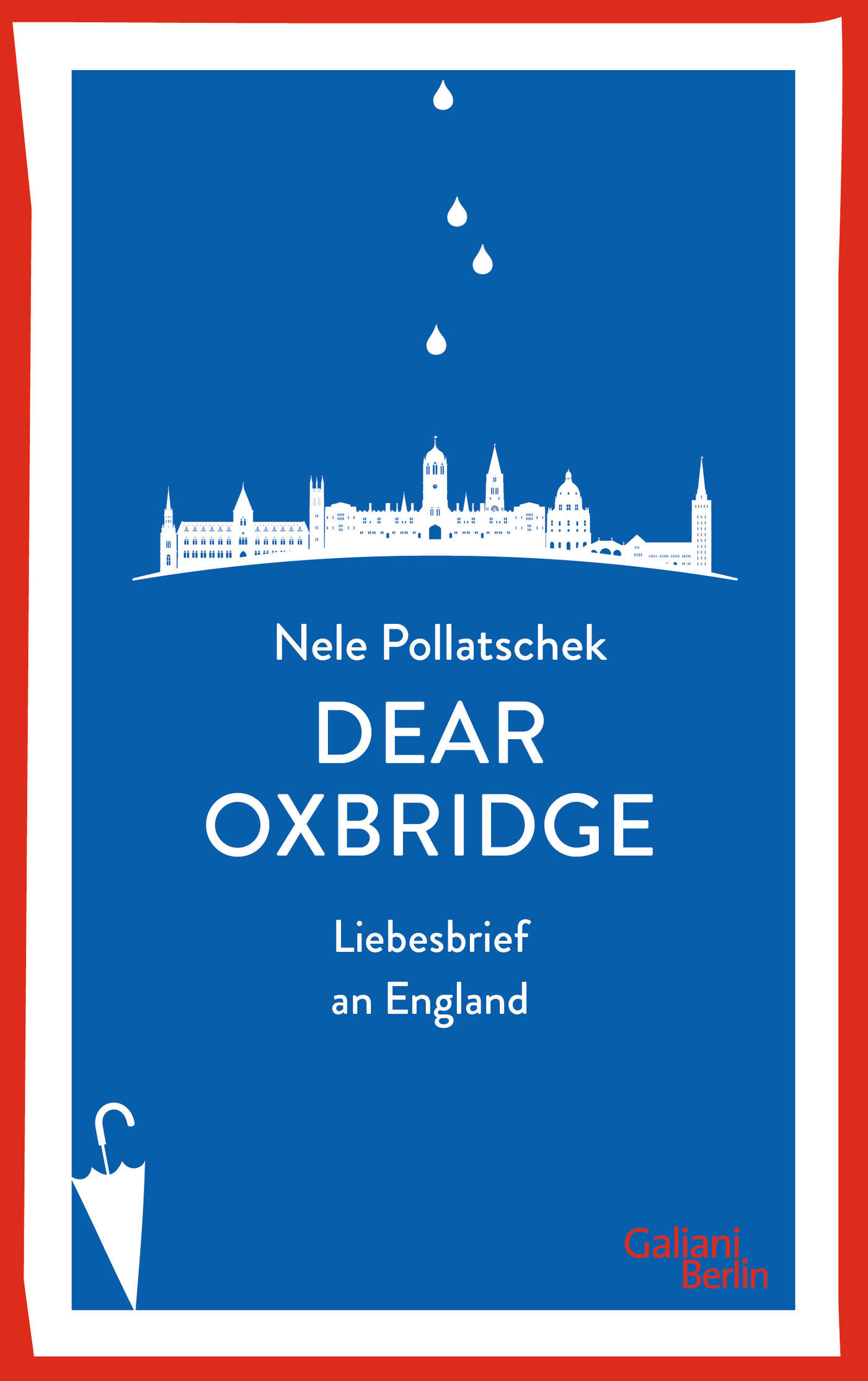
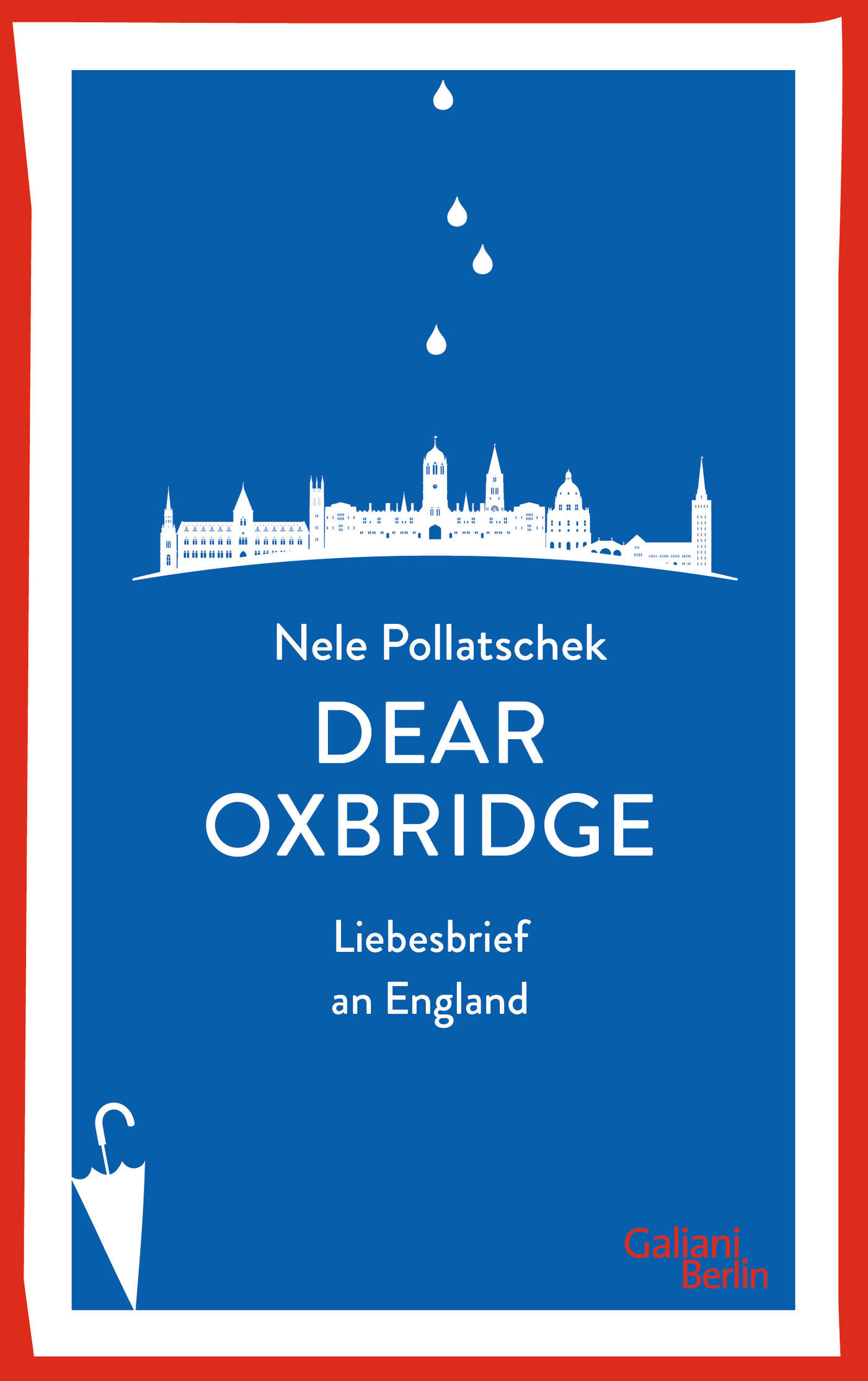
To Sherry and Kay.
And the people I met at Oxbridge.
Let me tell you about the very rich. They are different from you and me.
F. Scott Fitzgerald
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
Winston Churchill
This England never did, nor never shall,
Lie at the proud foot of a conqueror,
But when it first did help to wound itself.
William Shakespeare
Der Brexit hat mich reich gemacht. Am Abend des 23. Juni 2016 schlief ich auf einem Schuldenberg – na gut, Schuldenhügel – ein. Am Morgen des 24. Juni wachte ich schuldenfrei auf. Sogar ein kleines rechnerisches Plus hatte ich. Wenn man jahrelang verschuldet ist, dann bedeutet schuldenfrei sein nichts anderes als Reichtum.
Meine Schulden und der Brexit haben eines gemeinsam: Oxbridge – also die Universitäten Oxford und Cambridge, die, wie es sich für Celebrity-Pärchen gehört, gerne im Wort Oxbridge verschmolzen werden. Dieses Oxbridge ist der Ursprung meiner Schulden und des Brexits. Meine Schulden waren Studienschulden. Ich hatte sie mir hart erarbeitet in ungefähr sieben Jahren Studium, erst in Cambridge, dann in Oxford. Ich habe nie ausgerechnet, wie viel ein Studium in England wirklich kostet. Aber alleine die Studiengebühren liegen im Bachelor bei ca. 9000 £ und für Master und Promotion bei ca. 6000 £ pro Jahr. Und dann sind weder Miete noch Essen bezahlt, und beides ist in England deutlich teurer als in Deutschland.
Dass man in England Studiengebühren zahlt, ist erst seit 1998 der Fall. Davor war das Studium umsonst. Eingeführt wurden die Studiengebühren von der Labour-Regierung Tony Blairs. Wo hat Tony Blair studiert? Richtig, in Oxbridge. Er hat die Gebühren als Teil einer neoliberalen Finanzpolitik eingeführt, welche die Labour-Partei in den 1990ern in Anlehnung an den Erfolg Margaret Thatchers eingeschlagen hat. Wo hat Thatcher studiert? Auch Oxbridge, genauer: am Somerville College, Oxford. Das weiß ich, weil ich da auch mal studiert habe, nur dass man zu meiner Zeit da Studiengebühren zahlen musste. Thanks, Maggie.
Ich will natürlich nicht sagen, dass die Studiengebühren für den Brexit verantwortlich sind. Aber eine Verbindung zwischen der neoliberalen Politik, der daraus entstehenden Ungleichheit – ja, wenn ein Bachelor 9000 £ Studiengebühren im Jahr kostet, dann macht das die Menschen eines Volkes nicht gleicher – und einem allgemeinen Verdruss gibt es schon. Viele Engländer haben nicht für den Brexit gestimmt, sondern gegen Austerity – also die Austeritätspolitik, bei der die Ärmsten immer weniger Unterstützung bekommen, während gleichzeitig zum Beispiel die Studiengebühren angehoben werden (und die Reichen weniger Steuern zahlen). Das Problem ist, dass viele Engländer denken, die Austerität käme aus der EU, speziell von Merkel. Und natürlich ist Merkel – wie der Deutsche an sich – ein Freund der Sparsamkeit. Aber die schlimmsten Auswüchse der Austerity und des Neoliberalismus kommen ursprünglich aus England und sind, wenn sie von der EU verhängt werden, sozusagen nur ein Reimport.
Der größte englische EU-Freund war seinerzeit David Cameron. Und während er das Referendum vorbereitete, verkündete er, gleichzeitig auf einem goldenen Thron sitzend, bei einem Vier-Gänge-Menü, dass man den Gürtel jetzt deutlich enger schnallen müsste. Wo ist Cameron zur Uni gegangen? Ja, es war Oxford.
Und gleichzeitig wetterte Boris Johnson als Bürgermeister von London und Journalist gegen die EU und schürte alle möglichen Ressentiments, viele davon nachweislich frei erfunden. Wo ist Boris Johnson zur Uni gegangen? In Birmingham. Nein, Scherz, es war Oxford.
Michael Gove, der Strippenzieher, der dachte, er schafft es durch den Brexit zum Premierminister? Oxford.
Theresa May? Oxford.
Im Oktober 2016 waren von den 54 Premierministern der englischen Geschichte genau die Hälfte in Oxford gewesen. Ein weiteres Viertel hatte Cambridge besucht. Ein paar wenige haben in Schottland studiert, noch weniger im Ausland. Der Rest, Winston Churchill zum Beispiel, war auf Militärakademien gegangen und außerdem wohlgeboren genug, um ohne Studium Premier zu werden. (Wobei Churchills Geburtsort, Blenheim Palace, keine 30 Minuten von Oxford entfernt ist, man ihn also vielleicht auch Oxbridge zurechnen sollte.) In Großbritannien gilt: Manchmal regieren die Konservativen und manchmal regiert Labour, aber fast immer regiert Oxbridge.
Gläserne Decken, die bestimmte Gruppen vom Aufstieg abhalten, gibt es viele. Wenige sind so schwer zu durchdringen wie die der englischen Politik: Hier kann man die höchsten Spitzen ohne Oxbridge fast nicht erklimmen. Auch in den Führungsetagen großer Konzerne, den Vorständen der Banken, den Chefsesseln der Zeitungen und Medienanstalten – überall sitzt Oxbridge. In England ist Macht gleich Oxbridge.
Der Brexit lässt sich auch als eine Art Putschversuch gegen diese übermächtige Oxbridge-Elite verstehen. David Cameron will, dass wir in der EU bleiben? Dieser reiche Schnösel, der als Aufnahmeritual in die überelitäre Piers Gaveston Society in Oxford mal ein Schwein gevögelt haben soll, der seit Jahren von Sparsamkeit spricht und selber immer feister wird, will, dass wir für die EU stimmen? I say!
Es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass die Stimme des Brexits, Nigel Farage von der United Kingdom Independence Party (UKIP), als einer der wenigen wichtigen Politiker Englands nicht in Oxbridge war. Nigel Farage hat gar nicht studiert. Er ist ein Mann des Volkes. Zumindest konnte er sich so inszenieren und damit eine Revolution gegen die Machthaber – also gegen die Oxbridge-Elite – anzetteln. Aber wie im Kasino, wo immer das Haus gewinnt, gewinnt in England immer Oxbridge. Nach dem Referendum krähte eine Zeit lang kein Hahn mehr nach Farage. Er kann Menschen bewegen, aber die Fäden haben andere in der Hand. Die wahren Gewinner sind Boris Johnson and the Oxbridge Boys. Von Cambridge Analytica ganz zu schweigen.
Und gleichzeitig ist Oxbridge auch ein Verlierer. Also, nicht als Ursprung der Macht, sondern als zwei eigentlich ziemlich normale Universitäten. Als echte Orte voller echter Menschen, von denen die allermeisten nicht Premierminister werden. Viele von ihnen sind nicht reich, viele von ihnen sind gerade dabei, sich massiv zu verschulden. Sie studieren Altgriechisch oder Englische Literatur und werden im Café an der Ecke von Menschen bedient, die auch mal Altgriechisch oder Englische Literatur studiert haben. Viele von ihnen sind Ausländer, für die der Brexit eine Katastrophe ist. Viele von ihnen sind Wissenschaftler, für die die Sparpolitik, bei der rücksichtslos akademische Stellen und Gelder gestrichen werden, eine existenzielle Bedrohung darstellt. 73,8 % der im Kreis Cambridge lebenden Menschen haben für remain – also gegen den Brexit – gestimmt. In Oxford sah es ähnlich aus. Wer zum Zeitpunkt des Referendums zu Oxbridge gehörte, der war mit größter Wahrscheinlichkeit gegen den Brexit. Oxford und Cambridge sind remain-Hochburgen. Nirgendwo schlug die Nachricht des Brexit-Referendums härter ein als in Oxbridge. Ich weiß es, ich war da.
Es gibt so Momente im Leben, die vergisst man nicht mehr. In meiner Generation war das lange der 11. September. »Wo warst du am 11. September?« ist eine Frage, die wir fast alle beantworten können, wie frühere Generationen die nach dem Mauerfall oder der Mondlandung.
So ein Tag, den man nicht mehr loswird, war für mich der 24. Juni – der Tag, an dem der Ausgang des Brexit-Referendums bekannt gegeben wurde. Mein Freund und ich waren am Tag zuvor mit dem Auto von Deutschland nach England gefahren. Von Heidelberg nach Calais. Von Calais mit der Fähre nach Dover. Von Dover nach Oxford.
In Oxford luden wir meine Kisten ins Auto. Viel Zeug hatte sich in den Jahren, die ich in England gelebt hatte, nicht angesammelt. Anstrengend war es trotzdem, die Kisten aus meinem Dachgeschosszimmer ins Auto zu laden. In dem engen englischen Treppenhaus, in dem man auch ohne Kisten nur schwer gehen konnte, ohne anzuecken, waren die Kisten kaum zu manövrieren. Auf dem dicken Teppich, mit dem Engländer wirklich jedes Treppenhaus auslegen, rutschte ich aus. Immerhin, ich fiel weich.
Nachdem wir das Auto eingeräumt hatten, aßen wir Fish & Chips in meinem Lieblingspub, kehrten in mein WG-Zimmer zurück und schliefen ein. Meinen Freund hatte ich in mein 80-cm-Bett verfrachtet. Ich selbst schlief auf einer alten Sportmatte, die gerade so neben das Bett passte. Für zwei Menschen war das englische Studentenzimmer eigentlich zu klein, weswegen sich mein Freund auch bis zum Umzug gesträubt hatte, mich jemals in England zu besuchen. England ist einfach zu eng für Zweisamkeit.
Bevor ich einschlief, checkte ich noch mal den Wechselkurs. Wenn man ein Promotionsstipendium in Euro ausgezahlt bekommt, die Studiengebühren aber in Pfund bezahlen muss, dann wird der Wechselkurs zur Herzkurve. Das tägliche Überprüfen der Rate war für mich so normal wie Zähneputzen und gleichzeitig so aufregend wie Pferderennen.
Am Abend des 23. Juni 2016 lag der Pfundkurs bei 1,31 €. Nicht besonders hoch, nicht besonders tief. Höher als in den Tagen zuvor, was sich durch die zu wachsen scheinende Zustimmung zum EU-Verbleib erklären ließ.
Plus ein Drittel, das war lange Zeit meine Faustregel für schnelles Pfund-zu-Euro-Rechnen gewesen. Ungefähr 1,30 €, daran hatte ich mich gewöhnt.
Vor dem Einschlafen fragte ich mich kurz, ob ich meine Studienschulden vielleicht noch vor dem Ausgang des Referendums begleichen sollte. Das Geld hatte ich fast zusammen, es fehlten noch ein paar Hundert Pfund, aber den Großteil hatte ich bereits zusammengespart. Würden die Briten gegen den Brexit stimmen, dann würde das Pfund leicht in die Höhe gehen, meine Schulden sich also vergrößern. Wenn die Briten aber für den Brexit stimmten – was keiner glaubte –, würde der Kurs in den Keller fallen und meine Schulden schlagartig schrumpfen. Es war ein Pokerspiel. Und ich setzte auf Brexit.
Am nächsten Morgen weckte mich mein Handy. »The EUR to GBP exchange rate has reached your threshold«, stand da.
Den Tracker hatte ich Jahre zuvor mal aktiviert, nur für den Fall, dass der Kurs irgendwann für ein paar Sekunden fällt. Der threshold – also die Grenze, die ich eingegeben hatte – war reine Fantasterei. Der Tracker war ein Scherz mit mir selbst gewesen: Im Fall einer Zombie-Apokalypse sterbe ich wenigstens schuldenfrei.
Als ich die Nachricht auf meinem Handy sah, freute ich mich. Ganz kurz freute ich mich. Pfundkurs auf Rekordtief. Später fand ich heraus, dass es der schlechteste Pfundkurs – für Deutsche also der beste – seit 31 Jahren war. In meiner gesamten Lebenszeit war der Kurs nie zuvor so mies wie in den Tagen nach dem Brexit. Und ich hatte es geschafft, meine Schuldner bis zu diesem Rekordtag zu vertrösten.
Ich hatte gerade die Banking-App geöffnet, um schnell das Geld zu überweisen, da begriff ich erst, was dieser Kurs bedeuten musste. Als mich der Wechselkurs weckte, war meine Freude darüber so groß, dass mir erst mal gar nicht klar war, dass dieser Kurs nicht nur finanziell praktisch für mich, sondern politisch katastrophal war.
Plötzlich war mir übel. Ich stand auf, ging die zwei Stockwerke in die Küche hinunter, wo meine Mitbewohner mit gläsernen Augen in ihre Müslischalen starrten.
Wir waren sieben. Ein bunter Haufen aus Kontinentaleuropäern und Commonwealth – das bedeutet Australien und Kanada, aber auch Teile Afrikas. Wir studierten zwar alle in Oxford, Brite war aber keiner.
Wir schwiegen. Eine Mitbewohnerin stand auf und nahm mich in den Arm. Keiner musste es sagen, aber es lag so ein Gefühl im Raum: Wir fühlten uns mit Großbritannien zutiefst verbunden und gleichzeitig vollkommen fremd.
Ich ging wieder hoch. Durch den Schock hatte ich meine Überweisung unterbrochen. Jetzt wollte ich sie abschließen und gleichzeitig wollte ich auch nicht. Das Glück der Ersparnis war der Scham gewichen. Ich hatte auf den Brexit gewettet. Und ich hatte gewonnen. Was bedeutet: Wir hatten verloren.
Wenn ich jetzt das Geld überweisen würde, dann hätte ich vom Brexit profitiert. Das wollte ich nicht. Und gleichzeitig fragte ich mich, ob man, wenn man schon profitiert, nicht richtig profitieren sollte. Eines war schließlich klar: Wenn die Briten tatsächlich für den EU-Ausstieg gestimmt hatten, dann würde der Kurs ja noch weiter fallen. Ich überwies die Hälfte, den Rest ein paar Tage später, und kam mir schlecht vor, aber immerhin nicht mehr arm.
Bevor wir uns auf die Rückfahrt nach Deutschland machten, mussten wir noch mal zu meinem College. Schon beim Einsteigen freute ich mich – zum ersten Mal, seitdem wir es gekauft hatten – ein französisches Auto zu fahren. Neben dem Peugeot-Schriftzug prangte der Umriss der Insel Sylt. Wir waren zwar noch nie auf Sylt gewesen, hatten uns aber nicht die Mühe gemacht, den Sticker abzukratzen, als wir den Peugeot vom Gebrauchtwagenhändler holten. Jetzt war ich froh darüber. Was unserem klapprigen Peugeot-Kombi an Sex-Appeal fehlte, machte er mit europäischem Kontinentalstolz wieder wett. In einem See aus englischen Fahnen waren wir ein kleiner Flecken Europa. In unserem Peugeot waren wir die letzten beiden Gallier und überall nur Römer.
Als wir an meinem College ankamen, gab es keine Parkplätze. Somerville College, dessen Mitglied ich zu diesem Zeitpunkt seit vier Jahren war und, wie uns die damalige Dekanin bei der Immatrikulation erklärte, auch immer sein würde, liegt im angesagten Viertel Jericho. Hier sind Parkplätze schwer zu ergattern. Eigentlich konnte ich immer einen Porter – also College-Pförtner – fragen, ob ich ausnahmsweise auf dem Hof parken dürfe. Aber an diesem Morgen wollte ich keinen Porter sehen. Wie ich waren viele von ihnen Kontinentaleuropäer. Anders als ich befanden sie sich in finanzieller Abhängigkeit. Für sie würde der Brexit echte Konsequenzen haben. Die Stimmung in meiner WG-Küche hatte mir einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie es sich in der Porter’s Lodge, dem Pförtnerhäuschen, wohl gerade anfühlen würde. Ich hatte mit meinem Umzug genug zu tun und wollte dem gerne aus dem Weg gehen. Außerdem schämte ich mich. Weil ich auf den Brexit gewettet hatte, fühlte ich mich auf eine merkwürdige, abergläubische Art ein bisschen mitverantwortlich.
Also parkten wir auf der Woodstock Road, der großen Straße, die aus dem Stadtzentrum, an Somerville vorbei, hoch nach Summertown führt. Ich stieg aus, um Geld in den Parkscheinautomaten zu werfen, und merkte da erst, dass ich keine Pfund mehr hatte.
Ich ging die Straße entlang, Richtung Geldautomat, und rechnete aus, wie viel Zeit ich noch hatte, um Geld zu holen, es mir in Münzen wechseln zu lassen und zum Auto zurückzulaufen, wenn wir die Fähre noch bekommen wollten. Plötzlich geriet ich in eine Menschentraube.
Eigentlich ist Traube das falsche Wort. Die Menschen standen schweigend in regelmäßigem Abstand, dazwischen mindestens eine Armlänge Platz, auf dem breiten Bürgersteig und schauten alle in die gleiche Richtung. Ich folgte ihrem Blick. Sie schauten auf ein Café. Und auch noch auf ein geschlossenes. Ich hatte hier, im St. Giles Café, wie sich das Bistro nannte, mal eine Kleinigkeit gegessen, aber es war mir nicht weiter in Erinnerung geblieben. Mir fiel auf, wie diesig der Morgen war, wie am 1. Januar, wenn die Erinnerung an Feuerwerk noch in der Luft hängt. Irgendein Herdentrieb in mir veranlasste mich, auch stehen zu bleiben. Ich schaute auf das Café und wusste erst nicht, warum, bis ich die Schrift im Fenster sah. »Closed in Protest of EU vote« – »Geschlossen aus Protest gegen das EU-Referendum« – stand da in großen weißen Buchstaben. Daneben: »No EU, no café!«
Die Nachricht war nicht eloquent. Sie war nicht mal schön geschrieben. Der Besitzer hatte sie offensichtlich schnell und wütend hingeschmiert. Und trotzdem berührte sie ein Dutzend wildfremde Menschen so sehr, dass sie stehen blieben, um sie anzustarren. Aber vielleicht blieben wir auch nicht wegen der Nachricht stehen, sondern wegen des Gefühls, das wir miteinander teilten. Keiner, der hier stand, war ein Brexiteer, so viel war klar. Auf dem Bürgersteig vor dem St. Giles Café hatten wir ein gallisches Dorf gefunden.
»Kommst du?«, rief mein Freund vom Auto. Wir mussten die Fähre kriegen und dieser Moment des Stehenbleibens hatte mich wichtige Zeit gekostet. Ich schaute auf meine Uhr und wurde leicht panisch, gleichzeitig war ich immer noch wie gefesselt von diesem Café und den Menschen, mit denen ich hier stand.
»Kann mir jemand Euro in Pfund wechseln? Ich brauche Münzen für den Parkautomaten …«, fragte ich in die Runde. Alle schauten mich an. Sie hatten diesen gläsernen Blick, den ich schon von meinen Mitbewohnern kannte und den ich wahrscheinlich auch hatte, zumindest fühlte ich mich so.
Aus der Jackentasche zog ich einen Fünf-Euro-Schein hervor und hielt ihn vor mich.
»Ich brauch nur ein Pfund«, sagte ich und dann, um die Stimmung aufzulockern, versuchte ich einen Witz. Ich schwenkte meinen Euro-Schein und sagte: »Wird im Wert nur steigen … also im Verhältnis zum Pfund zumindest.«
»Wissen wir«, sagte eine Britin. Ein Mann nickte. Eine andere Frau versuchte zu lächeln, kämpfte aber augenscheinlich mit den Tränen. Von links streckte sich mir ein Fünf-Pfund-Schein entgegen.
»Ich kann Ihnen einen Schein geben«, sagte der Besitzer des Scheines.
»Ich brauche leider Münzen für den Automaten«, antwortete ich.
»Ich habe zwei Pfund«, sagte ein anderer Brite und zeigte mir seine zwei Pfund-Stücke.
»Danke«, sagte ich und wollte ihm meinen Fünf-Euro-Schein im Tausch geben. Er gab mir seine Münzen, nahm meinen Schein aber nicht. Ich versuchte ihm meinen Schein in die Hand zu drücken.
»Nein, das ist schon okay«, sagte er.
»Nein, nimm doch den Schein. Ihr werdet jeden Eurocent brauchen«, sagte ich. Er nickte. Alle nickten. Aber meinen Schein nahm er nicht.
»Bitte, nimm die Münzen und behalt deine Euro«, sagte er. Und dann: »I feel so embarrassed for what we did« – »Ich schäme mich so für das, was wir getan haben.« Bevor ich noch mal versuchen konnte, ihm meinen Schein zu geben, lief er schnellen Schrittes davon und zwang mich, schon zum zweiten Mal an diesem Tag vom Brexit zu profitieren.
Auch ich musste weg. Die anderen blieben stehen. Jetzt aber standen sie dicht beieinander. Aus der Ferne sah es aus, als würden sie sich umarmen.