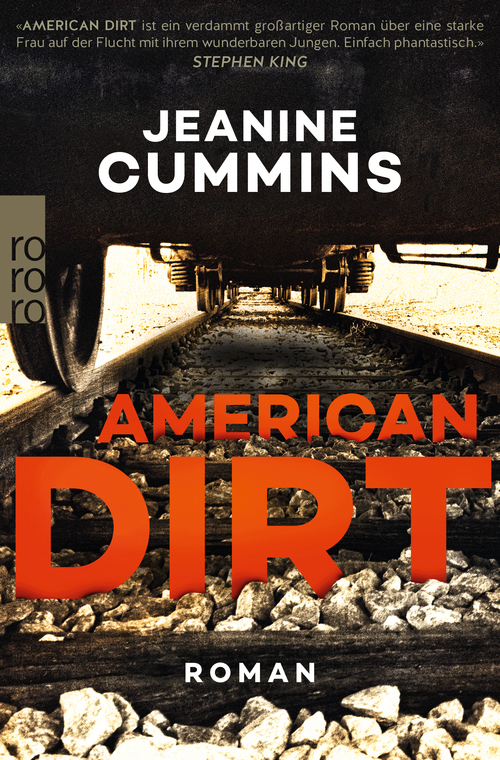
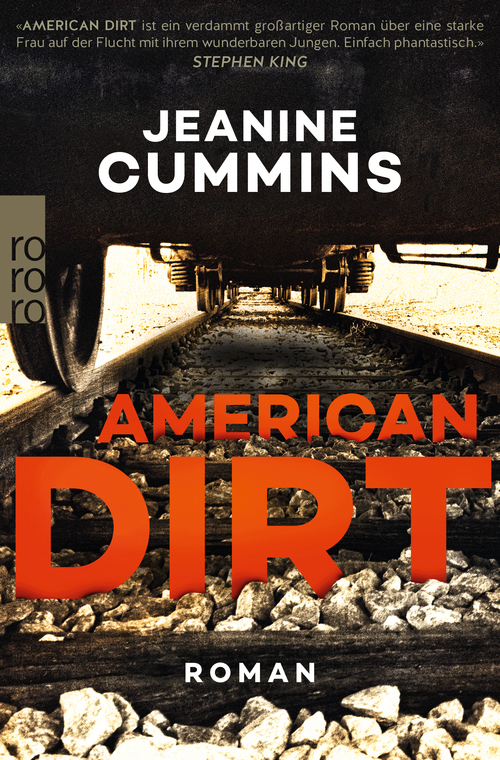
Für Joe
Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta.
Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro.
Da waren Durst und Hunger, aber du warst die Frucht in mir.
Da war Verfall und Trauer, und du warst mir das Wunder.
Pablo Neruda, «Das Lied der Verzweiflung»
Eine der ersten Kugeln kommt durch das offene Fenster über der Toilette, vor der Luca steht. Er begreift zuerst überhaupt nicht, dass es eine Kugel ist, und es ist reines Glück, dass sie ihn nicht zwischen den Augen trifft. Luca hört kaum das leise Geräusch, das sie macht, als sie knapp an ihm vorbeifliegt und in der gefliesten Wand hinter ihm einschlägt. Aber die Salve, die ihr folgt, ist laut, donnernd und hämmernd, es macht klack-klack-klack wie die Propellerblätter eines Hubschraubers. Er hört auch Geschrei, aber das hält nur ganz kurz an und wird bald von Schüssen zum Schweigen gebracht. Bevor Luca noch den Reißverschluss seiner Hosen hochziehen, den Klodeckel schließen und hinaufsteigen kann, um hinauszuschauen, bevor er noch die Zeit hat, die Quelle des schrecklichen Lärms zu ergründen, wird die Tür aufgerissen, und Mami ist da.
«Mijo, ven», sagt sie so leise, dass Luca sie kaum verstehen kann.
Ihre Hände sind gar nicht sanft; sie schubst ihn zur Dusche. Er stolpert über die kleine geflieste Stufe und fällt auf seine Hände. Mami landet auf ihm. Im Sturz beißt er sich auf die Lippe. Er schmeckt Blut. Ein dunkler Tropfen bildet einen winzigen roten Kreis auf dem hellgrün gefliesten Boden der Dusche. Mami schiebt Luca in die Ecke. Es gibt keine Tür an dieser Dusche, nicht mal einen Vorhang. Sie ist nur eine Ecke im Badezimmer seiner abuela. Eine dritte geflieste Wand grenzt die Dusche vom Rest des Badezimmers ab wie eine Kabine. Diese Wand ist vielleicht eins sechzig hoch und einen Meter breit. Gerade groß genug, um Luca und seine Mutter mit etwas Glück zu verbergen. Lucas Rücken ist eingekeilt, seine schmalen Schultern berühren beide Wände. Er hat die Knie ans Kinn gezogen, und Mami hat sich über ihn gelegt wie ein Schildkrötenpanzer. Die Tür des Badezimmers bleibt offen, was Luca Angst macht, obwohl er gar nicht über den Körper seiner Mutter und an der Duschmauer seiner abuela vorbeischauen kann. Er würde sich gern unter seiner Mutter hervorwinden und die Tür ganz leicht mit dem Finger anstupsen. Er würde sie gern zustoßen. Er weiß nicht, dass seine Mutter sie absichtlich hat offen stehen lassen. Dass eine geschlossene Tür nur zur Überprüfung einlädt.
Das Klackern der Schüsse draußen hält an. Der Geruch von verkohltem und verbranntem Fleisch dringt herein. Papi grillt da draußen carne asada und Lucas Lieblingsessen, Hähnchenschenkel. Er mag sie, wenn sie nur ganz leicht geschwärzt sind. Er mag den knusprigen, würzigen Geschmack der Haut. Seine Mutter hebt kurz den Kopf und schaut ihm in die Augen. Sie versucht, mit den Händen seine Ohren zuzuhalten. Draußen werden die Pausen zwischen den Schüssen länger. Dann hört das Schießen ganz auf, nur um wieder zu beginnen, in kurzen Salven, und Luca hat das Gefühl, als kämen sie gleichzeitig mit seinen unregelmäßigen und seltenen Herzschlägen. Dazwischen hört Luca immer noch das Radio. Eine Frauenstimme verkündet La Mejor FM Acapulco, 100.1!, und dann singen Banda MS davon, wie glücklich sie verliebt sind. Jemand schießt auf das Radio, und es ertönt Gelächter. Männerstimmen. Zwei oder drei, das kann Luca nicht genau sagen. Schwere Schritte auf Abuelas Terrasse.
«Ist er hier?» Eine der Stimmen ist genau unter dem Fenster.
«Hier.»
«Was ist mit dem Kind?»
«Mira, hier ist doch ein Junge. Ist er das?»
Lucas Cousin Adrián. Er trägt Stollenschuhe und sein Hernández-Trikot. Adrián kann einen balón de fútbol siebenundvierzig Mal mit den Knien kicken, ohne ihn fallen zu lassen.
«Weiß ich auch nicht. Sieht aus, als wäre er im richtigen Alter. Mach mal ein Foto.»
«Hey, Hähnchen!», sagt ein anderer. «Mann, das sieht vielleicht lecker aus. Wollt ihr Hähnchen?»
Lucas Kopf liegt genau unter dem Kinn seiner mami, sie hat ihren Körper ganz eng um seinen geschlungen.
«Vergiss das Hähnchen, pendejo. Durchsuch lieber das Haus.»
Lucas mami bewegt sich in ihrer hockenden Haltung und schiebt ihn noch enger an die geflieste Wand. Sie drückt sich gegen ihn, und sie hören beide das Quietschen und Zuschlagen der Hintertür.
Schritte in der Küche. Hin und wieder das Knattern von Schüssen im Haus. Mami dreht den Kopf und bemerkt Lucas einsamen Blutfleck, der leuchtend rot auf dem Fliesenboden liegt, angestrahlt vom Licht, das durch das Fenster dringt. Luca spürt, wie ihr der Atem in der Brust stockt. Im Haus ist es jetzt ganz still. Der Flur, der auf dieses Badezimmer zuführt, ist mit Teppich ausgelegt. Mami zieht den Ärmel ihrer Bluse über die Hand, und Luca schaut voller Angst zu, wie sie sich zum verräterischen Blutfleck beugt. Sie fährt mit dem Ärmel darüber, sodass nur ein blasser Fleck zurückbleibt. Dann lässt sie sich wieder über ihn fallen, genau in dem Augenblick, in dem der Mann im Flur den Kolben seines AK-47 dazu benutzt, die Tür bis zum Anschlag aufzustoßen.
Es müssen drei sein, denn Luca hört immer noch zwei Stimmen im Garten. Auf der anderen Seite der Duschwand öffnet der dritte Mann seine Hose und entleert seine Blase in Abuelas Toilette. Luca hält den Atem an. Mami hält den Atem an. Sie haben die Augen geschlossen, ihre Körper sind regungslos, selbst den Adrenalinpegel haben sie durch schiere, starre Willenskraft eingefroren. Der Mann hat Schluckauf. Er zieht die Spülung, wäscht sich die Hände. Er trocknet sie an Abuelas gutem gelbem Handtuch ab, das sie nur herausholt, wenn sie Gäste hat.
Sie rühren sich nicht, als der Mann geht. Auch nicht, als sie noch einmal das Quietschen und Zuschlagen der Küchentür hören. Sie bleiben da, erstarrt in ihrem festen Knoten aus Armen und Beinen und Knien und Kinnen und zugekniffenen Augen und verschlungenen Fingern, selbst als sie hören, dass der Mann zu seinen Kumpanen geht und verkündet, dass das Haus sauber ist und er jetzt Hähnchen isst, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, gutes Grillfleisch verkommen zu lassen, solange in Afrika die Kinder hungern. Der Mann ist immer noch nah genug am Fenster, dass Luca die feuchten, gummiartigen Schmatzgeräusche hören kann, die sein Mund beim Essen des Hähnchenfleisches macht. Er konzentriert sich auf seinen Atem, ein und aus, geräuschlos. Er sagt sich, dass das hier nur ein böser, ein schrecklicher Traum ist, wenn auch einer, den er schon sehr oft hatte. Er wacht dann immer mit klopfendem Herzen auf und ist vollkommen erleichtert. Es war nur ein Traum. Denn das hier sind die modernen Schwarzen Männer von Guerrero. Selbst die Eltern, die vor ihren Kindern nicht über die Gewalt sprechen, die den Sender wechseln, wenn wieder eine Schießerei gemeldet wird, die ihre schlimmste Angst vor ihnen verbergen, können nicht verhindern, dass ihre Kinder mit anderen Kindern sprechen. Auf den Schaukeln, auf dem fútbol-Feld, im Jungenklo in der Schule werden die gruseligen Geschichten immer größer und blähen sich auf. Diese Kinder, reich, arm, aus dem Mittelstand, haben allesamt schon Leichen in den Straßen gesehen. Zufallsmorde. Und sie wissen aus ihren Gesprächen, dass es eine Hierarchie der Gefahr gibt, dass einige Familien in größerer Gefahr schweben als andere. Obwohl Luca also von seinen Eltern nie auch nur den kleinsten Hinweis auf ein mögliches Risiko bekommen hat, obwohl sie ihren Mut vor ihrem Sohn tadellos zur Schau gestellt haben, wusste er – wusste er immer, dass dieser Tag kommen würde. Und diese Wahrheit kann den Schock kein bisschen mildern.
Es dauert eine lange, lange Zeit, bis Lucas Mutter endlich den festen Griff an seinem Nacken löst, bis sie sich so weit von ihm wegbeugt, dass er den Winkel des einfallenden Lichts in das Badezimmerfenster erkennen kann. Er hat sich verändert.
Die Momente nach der Angst und vor der Bestätigung, dass sie vorbei ist, sind eine Gnade. Als er es endlich wagt, sich zu regen, spürt Luca kurz dieses taumelnde Hochgefühl angesichts der Tatsache, dass er noch am Leben ist. Einen Moment lang genießt er das Gefühl, wie sein Atem stockend in seine Brust strömt. Er legt die Handflächen flach auf den Boden, um die kühlen Fliesen zu spüren. Mami sackt an der Wand ihm gegenüber zusammen und presst die Kiefer so fest aufeinander, dass man das Grübchen in ihrer linken Wange sehen kann. Es ist merkwürdig, sie mit ihren guten Sonntagsschuhen in der Dusche zu sehen. Luca berührt die Wunde an seiner Lippe. Das Blut ist getrocknet, aber er fährt mit den Schneidezähnen darüber, und die Wunde öffnet sich wieder. Er begreift: Wenn das hier ein Traum wäre, würde er kein Blut schmecken.
Endlich steht Mami auf. «Bleib hier», befiehlt sie ihm flüsternd. «Rühr dich nicht, bis ich dich holen komme. Mach keinen Mucks, verstehst du?»
Luca greift nach ihrer Hand. «Mami, geh nicht.»
«Mijo, ich bin gleich wieder da, okay? Du bleibst hier.» Mami löst Lucas Finger von ihrer Hand. «Rühr dich nicht vom Fleck», wiederholt sie. «Guter Junge.»
Luca fällt es leicht, dem Befehl seiner Mutter zu gehorchen, nicht so sehr, weil er so ein folgsames Kind wäre, sondern weil er das nicht sehen will. Seine ganze Familie da draußen, in Abuelas Garten.
Heute ist Samstag, der 7. April, die quinceañera seiner Cousine Yénifer, ihre Party zu ihrem 15. Geburtstag. Sie trägt ein langes weißes Kleid. Ihr Vater und ihre Mutter sind gekommen, Tío Alex und Tía Yemi, und Yénifers kleiner Bruder Adrián, der, weil er schon neun ist, gern behauptet, dass er ein Jahr älter sei als Luca, obwohl sie in Wirklichkeit bloß vier Monate auseinander sind.
Bevor Luca aufs Klo musste, hatten Adrián und er mit den anderen primos mit dem balón herumgebolzt. Die Mütter hatten auf der Terrasse um den Tisch herum gesessen; an ihren eiskalten Paloma-Gläsern auf den Servietten hatte sich Kondenswasser gebildet. Das letzte Mal, als sie alle zusammen bei Abuela gewesen waren, war Yénifer zufällig hereingekommen, als Luca gerade auf der Toilette war, und Luca war das so peinlich gewesen, dass er diesmal seine Mami gebeten hatte, mit ihm zu kommen und vor der Tür Wache zu stehen. Abuela gefiel das nicht; sie sagte Mami, dass sie ihn verzärtele, dass ein Junge in dem Alter allein auf die Toilette gehen solle, aber Luca ist ein Einzelkind, daher kommt er mit Dingen durch, die anderen Kindern nicht erlaubt werden.
Jedenfalls ist Luca jetzt allein im Badezimmer, und er versucht, ihn nicht zu denken, aber der Gedanke drängt sich trotzdem immer wieder in den Vordergrund: Diese ärgerlichen Worte zwischen Mami und Abuela waren vielleicht die letzten, die sie miteinander gewechselt haben, für immer. Luca war ganz zappelig an den Tisch getreten und hatte in Mamis Ohr geflüstert, und Abuela, die das beobachtet hatte, hatte den Kopf geschüttelt, einen tadelnden Finger gehoben und ihre Bemerkungen gemacht. Sie lächelte immer, wenn sie jemanden schalt. Doch Mami war stets auf Lucas Seite. Sie verdrehte die Augen und schob trotzdem ihren Stuhl vom Tisch, ohne auf die Missbilligung ihrer Mutter zu achten. Wann war das gewesen – vor zehn Minuten? Zwei Stunden? Luca fühlt sich völlig losgelöst von den Gesetzen der Zeit, die es schon immer gab.
Draußen vor dem Fenster hört er Mamis vorsichtige Schritte, das leise Knirschen ihrer Sohlen über etwas Zerbrochenes. Ein einzelnes Aufkeuchen, zu flüchtig, als dass man es Schluchzen hätte nennen können. Dann werden ihre Schritte schneller, sie überquert zielstrebig die Terrasse und drückt auf die Tasten ihres Telefons.
Als sie spricht, klingt ihre Stimme irgendwie gedehnt, ganz hoch und eng, als käme sie tief aus der Kehle. So hat Luca sie noch nie gehört.
«Schicken Sie Hilfe.»
Als Mami wiederkommt und Luca aus der Dusche holt, hat er sich zu einem kleinen Ball zusammengerollt und schaukelt vor und zurück. Sie sagt ihm, er solle aufstehen, aber er schüttelt den Kopf und macht sich nur noch kleiner. Sein ganzer Körper zittert vor panischem Widerwillen. Solange er hier in der Dusche bleibt, das Gesicht in der Ellenbeuge versteckt, solange er Mami nicht ins Gesicht schaut, kann er das Wissen vor sich herschieben, das er längst hat. Er kann den Augenblick irrationaler Hoffnung verlängern, dass vielleicht doch noch ein kleines Stückchen der Welt von gestern intakt ist.
Es wäre besser für ihn, hinauszugehen und sich umzuschauen, die leuchtenden Farbflecken auf Yénifers weißem Kleidchen und Adriáns Augen zu sehen, wie sie in den Himmel starren, Abuelas graues Haar, das ganz stumpf von einem Zeug ist, das gar nicht außerhalb einer Hirnschale existieren dürfte. Es wäre sogar gut für Luca, sich die noch warme Hülle seines Vaters anzusehen, der im Fallen die Grillzange verbogen hat und dessen Blut noch immer in den Terrassenboden aus Beton sickert. Denn nichts davon, so schrecklich es auch sein mag, ist schlimmer als die Bilder, die Lucas lebhafte Phantasie stattdessen heraufbeschwören wird.
Als sie ihn schließlich dazu bringen kann aufzustehen, schiebt Mami Luca zur Haustür, was vielleicht die beste Idee ist, vielleicht aber auch nicht. Wenn los sicarios, die Killer, zurückkommen, was wäre dann schlimmer – für alle sichtbar auf der Straße zu stehen oder drinnen im Versteck zu hocken, wo man ihre Ankunft nicht bemerkt? Die Frage ist unmöglich zu beantworten. Nichts ist jetzt besser oder schlimmer als irgendetwas anderes.
Sie gehen durch Abuelas gepflegten Vorgarten, und Mami öffnet das Tor. Zusammen setzen sie sich auf den gelb angestrichenen Bordstein, die Füße auf der Straße. Die andere Straßenseite liegt im Schatten, aber hier ist es hell, und die Sonne brennt heiß auf Lucas Stirn. Nach ein paar langen Minuten hören sie, wie sich Polizeisirenen nähern. Mami, die auch Lydia heißt, klappern die Zähne. Ihr ist nicht kalt. Unter ihren Achseln ist es nass, und sie hat Gänsehaut auf den Armen. Luca beugt sich vor und übergibt sich. Er spuckt einen Batzen Kartoffelsalat aus, der vom Fruchtpunsch rosa gefärbt ist und auf den Asphalt zwischen seinen Füßen platscht, aber seine Mutter und er rücken nicht davon weg. Sie scheinen es nicht einmal zu bemerken. Sie bemerken auch nicht die hastigen Bewegungen der Vorhänge und Jalousien an den Fenstern in der Nähe. Die Nachbarn bereiten sich darauf vor, später glaubhaft abstreiten zu können, irgendetwas gesehen zu haben.
Was Luca aber bemerkt, sind die Mauern in Abuelas Straße. Er hat sie schon unzählige Male gesehen; doch heute fällt ihm etwas auf: Jedes Haus hier hat einen kleinen Vorgarten, genau wie Abuelas, versteckt hinter einer Mauer, genau wie Abuelas, auf der Stacheldraht oder Hühnerdraht oder Metallstacheln befestigt sind, genau wie auf Abuelas, und zugänglich nur durch ein verschlossenes Tor, genau wie Abuelas. Acapulco ist eine gefährliche Stadt und wird jeden Tag gefährlicher. Die Leute treffen Vorsichtsmaßnahmen, selbst in guten Gegenden wie dieser hier – ganz besonders in guten Gegenden wie dieser hier. Doch was nützen diese Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Männer kommen? Luca lehnt den Kopf gegen die Schulter seiner Mutter, und sie legt den Arm um ihn. Sie fragt nicht, ob es ihm gutgeht, denn von jetzt an wird diese Frage schmerzhaft absurd klingen.
Lydia bemüht sich sehr, nicht über all die Worte nachzudenken, die jetzt nie mehr aus ihrem Mund kommen werden, die plötzliche Riesenlücke aus Worten, die sie nie mehr wird aussprechen können.
Die Polizei trifft ein und spannt gelbes escena del crimen-Absperrband über die Straße, um den Verkehr auszusperren und Platz zu machen für die makabre Kolonne von Notfallfahrzeugen. Ganz viele Polizisten, eine ganze Armee von Polizisten gehen mit choreographiertem Respekt herum und an Luca und Lydia vorbei. Als der ranghöchste Detective kommt und seine Fragen zu stellen beginnt, zögert Lydia einen Moment lang und überlegt, wohin sie Luca schicken könnte. Er ist noch zu klein, um alles mit anzuhören, was sie sagen muss. Sie sollte ihn in die Obhut von jemand anderem geben, damit sie ganz offen auf diese schrecklichen Fragen antworten kann. Sie sollte ihn zu seinem Vater schicken. Zu ihrer Mutter. Zu ihrer Schwester Yemi. Aber die liegen alle tot im Garten, ganz eng beieinander wie umgekippte Dominosteine. Und es ist sowieso bedeutungslos. Die Polizisten sind nicht gekommen, um zu helfen. Lydia beginnt zu schluchzen. Luca steht auf und legt seine kalte Hand in den Nacken seiner Mutter.
«Lassen Sie sie für einen Moment in Ruhe», sagt er wie ein erwachsener Mann.
Als der Detective zurückkehrt, hat er eine Frau dabei, die Rechtsmedizinerin, die Luca direkt anspricht. Sie legt die Hand auf seine Schulter und fragt, ob er sich mit ihr in ihren Transporter setzen will. Auf dem Truck steht SEMEFEO, und die hinteren Türen stehen offen. Mami nickt ihm zu, also geht Luca mit der Frau und setzt sich hinein. Die Beine lässt er über die hintere Stoßstange baumeln. Sie bietet ihm eine eiskalte Dose als refresco an.
Lydias Hirn, das durch den Schock kurzzeitig gelähmt war, fängt wieder an zu arbeiten, aber nur sehr langsam, als bestünde es aus Matsch. Sie sitzt immer noch auf der Bordsteinkante, und der Detective steht zwischen ihr und ihrem Sohn.
«Haben Sie den Schützen gesehen?», fragt er.
«Die Schützen, Plural. Ich glaube, es waren drei.» Sie wäre froh, wenn der Detective einen Schritt zur Seite treten würde, damit sie freie Sicht auf Luca hat. Er ist nur ein paar Schritte von ihr entfernt.
«Sie haben sie gesehen?»
«Nein, nur gehört. Wir haben uns in der Dusche versteckt. Einer ist reingekommen und hat gepinkelt, als wir da drin waren. Vielleicht können Sie Fingerabdrücke vom Wasserhahn nehmen. Draußen haben wir mindestens noch zwei weitere Stimmen gehört.» Lydia klatscht laut in die Hände, als wollte sie die Erinnerung verjagen.
«Haben Sie irgendetwas gesagt oder getan, das uns helfen kann, sie zu identifizieren?»
Sie schüttelt den Kopf. «Einer hat das Hühnerfleisch gegessen.»
Der Detective schreibt pollo in sein Notizbuch.
«Einer hat gefragt, ob er da wäre.»
«Ein spezifisches Ziel? Hat er gesagt, wer er ist? Einen Namen?»
«Das mussten sie nicht. Sie meinten meinen Mann.»
Der Detective hört auf zu schreiben und schaut sie erwartungsvoll an. «Und Ihr Mann ist …?»
«Sebastián Pérez Delgado.»
«Der Reporter?»
Lydia nickt, und der Detective pfeift durch die Zähne.
«Ist er hier?»
Sie nickt erneut. «Auf der Veranda. Der mit der Grillzange. Mit dem Pappschild.»
«Es tut mir leid, Señora. Ihr Mann hat viele Drohungen erhalten, ja?»
«Ja, aber in letzter Zeit nicht mehr.»
«Und wie genau lauteten diese Drohungen?»
«Sie wollten, dass er aufhört, über die Kartelle zu schreiben.»
«Oder?»
«Oder sie würden seine ganze Familie töten.» Ihre Stimme klingt ganz ausdruckslos.
Der Detective atmet tief durch und sieht Lydia mit einem Blick an, den man für mitfühlend halten könnte. «Wann wurde er zum letzten Mal bedroht?»
Lydia schüttelt den Kopf. «Ich weiß es nicht. Vor langer Zeit. Das hier hätte gar nicht passieren dürfen. Es hätte nicht passieren dürfen.»
Der Detective presst die Lippen aufeinander, sodass sie eine schmale Linie bilden, und antwortet nicht.
«Er wird mich auch umbringen», sagt sie und begreift erst, als sie die Worte ausgesprochen hat, dass sie vermutlich wahr sind.
Der Detective unternimmt keinen Versuch, ihr zu widersprechen. Er steht zufällig nicht auf der Gehaltsliste des Kartells, doch viele seiner Kollegen tun es. Er weiß nicht genau wer, aber das ist auch egal. Er vertraut sowieso niemandem.
Unter den mehr als zwei Dutzend Polizisten, Sanitätern und Ärzten, die in diesem Moment in Abuelas Haus und auf ihrer Terrasse sind und die Stellen markieren, wo sie Patronenhülsen finden, die Blutspritzer analysieren, Fotos machen, den Puls prüfen und Kreuze über die Leichen aus Lydias Familie schlagen, erhalten tatsächlich sechs regelmäßig Geld vom hiesigen Kartell. Die Summe, die man ihnen illegal gibt, ist drei Mal so hoch wie die, die ihnen die Regierung bezahlt. Tatsächlich hat einer von ihnen bereits el jefe eine Textnachricht geschickt, um dem Boss zu melden, dass Lydia und Luca überlebt haben. Die anderen tun nichts, denn genau dafür bezahlt sie das Kartell – dafür, Uniform zu tragen und so zu tun, als hätte die Regierung alles im Griff. Einige von ihnen leiden deswegen unter moralischen Konflikten; andere nicht. Sie haben ohnehin keine Wahl, also sind ihre Gefühle bedeutungslos. Die Zahl der ungelösten Gewaltverbrechen liegt in Mexiko weit über neunzig Prozent. Die kostümierten Auftritte der policía sollen nur die notwendige Illusion aufrechterhalten, das Kartell könnte nicht faktisch straffrei machen, was es wollte.
Lydia weiß das. Alle wissen das. Sie beschließt, dass sie hier rausmuss. Sie steht von der Bordsteinkante auf und ist selbst überrascht, dass ihre Beine sie tragen. Der Detective macht einen Schritt zurück, um ihr ein wenig Platz zu lassen.
«Wenn er begreift, dass ich überlebt habe, kommen sie zurück», sagt sie. Und dann kehrt die Erinnerung mit einem Schlag wieder: Eine der Stimmen im Garten, wie sie fragt Was ist mit dem Kind?, und Lydias Glieder fühlen sich an wie aus Gummi. «Er wird meinen Sohn umbringen lassen.»
«Er?», fragt der Detective. «Sie wissen genau, wer das getan hat?»
«Soll das ein Witz sein?», fragt sie zurück. Es gibt nur einen möglichen Verursacher von Blutbädern dieses Ausmaßes in Acapulco, und jeder weiß, wer dieser Mann ist. Javier Crespo Fuentes. Ihr Freund. Warum sollte sie seinen Namen laut aussprechen? Die Frage des Detective ist entweder Theater oder ein Test. Er schreibt noch mehr Wörter in sein Notizbuch. Er schreibt: La Lechuza? Er schreibt: Los Jardineros? Und dann zeigt er Lydia das Notizbuch. «Ich kann das jetzt nicht», sagt sie und schiebt sich an ihm vorbei.
«Bitte, nur noch ein paar Fragen.»
«Nein. Keine Fragen mehr. Null Fragen mehr.»
Sechzehn Leichen liegen im Garten, beinahe alle Menschen, die Lydia jemals geliebt hat, aber sie hat immer noch das Gefühl, am Abgrund zu dieser Information zu stehen – sie weiß, dass sie wahr ist, weil sie gehört hat, wie sie starben, sie hat ihre Leichen gesehen. Sie hat die noch warme Hand ihrer Mutter berührt und die Hand ihres Mannes angehoben, um den nicht mehr vorhandenen Puls zu fühlen. Aber ihr Verstand versucht immer noch, alles zurückzuspulen, es rückgängig zu machen. Weil es nicht sein kann. Es ist zu grauenvoll, um wirklich wahr zu sein. Die Panik schwebt bedrohlich über ihr, senkt sich aber nicht auf sie herab.
«Komm, Luca.» Sie streckt ihre Hand aus, und Luca lässt sich vom Transporter der Rechtsmedizinerin gleiten. Er lässt die fast volle Dose refresco auf der Stoßstange stehen.
Lydia nimmt ihn bei der Hand, und zusammen gehen sie die Straße hinunter bis zum Ende des Blocks, wo Sebastián ihr Auto abgestellt hat. Der Detective folgt ihnen und versucht immer noch, mit ihr zu sprechen. Er will einfach nicht akzeptieren, dass sie das Gespräch beendet hat. Hat sie sich nicht deutlich genug ausgedrückt? Sie bleibt so abrupt stehen, dass er beinahe in sie hineinrennt. Er muss sich auf die Zehenspitzen stellen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie dreht sich auf dem Absatz um.
«Ich brauche seine Schlüssel», sagt sie.
«Schlüssel?»
«Die Autoschlüssel meines Mannes.»
Der Detective redet weiter. Lydia drängt sich an ihm vorbei und zieht Luca hinter sich her. Sie geht zurück durch das Tor in Abuelas Vorgarten und sagt Luca, er solle dort stehen bleiben und warten. Dann überlegt sie es sich anders und geht mit ihm ins Haus. Sie setzt ihn auf Abuelas goldfarbene Samtcouch und schärft ihm ein, sich nicht vom Fleck zu rühren.
«Können Sie bitte bei ihm bleiben?»
Der Detective nickt.
Lydia hält kurz an der Hintertür inne, strafft dann die Schultern, um sie aufzustoßen und hinauszutreten. Über dem schattigen Garten liegt der süße Duft von Limetten und pappiger verkohlter Soße, und Lydia weiß, dass sie nie wieder Grillfleisch essen wird. Einige ihrer Familienmitglieder sind jetzt mit Planen abgedeckt. Im Garten sind überall kleine leuchtend gelbe Schildchen aufgestellt, auf denen schwarze Buchstaben und Ziffern stehen. Die Schildchen markieren die Stellen, an denen Beweismittel entdeckt wurden, die niemals in einem Prozess Verwendung finden werden. Die Schildchen machen alles nur noch schlimmer. Dass sie da sind, bedeutet, dass es wahr ist. Lydia spürt ihre Lunge – ihr Atem fühlt sich wund und hart an, so hat er sich noch nie angefühlt. Sie tritt zu Sebastián, der sich nicht rührt. Sein Arm steht immer noch in einem merkwürdigen Winkel von ihm ab. Die Grillzange schaut unter seiner Hüfte hervor. So, wie er da liegt, erinnert seine Haltung daran, wie er war, wenn er besonders lebhaft und aufgeregt war, wenn er mit Luca nach dem Abendessen im Wohnzimmer raufte. Sie quieken. Sie brüllen. Sie krachen gegen die Möbel. Lydia lässt unterdessen Wasser in den Ausguss in der Küche laufen und verdreht die Augen. Aber jetzt ist die ganze Hitzigkeit vergangen. Unter Sebastiáns Haut tickt die Stille. Sie will mit ihm sprechen, bevor alle Farbe aus ihm gewichen ist. Sie will ihm erzählen, was passiert ist, hastig, verzweifelt. Ein irrer Teil ihres Selbst glaubt daran, dass sie ihn davon überzeugen kann, doch nicht tot zu sein, wenn sie die Geschichte nur gut genug erzählt. Sie kann ihn davon überzeugen, wie sehr sie ihn braucht, wie sehr ihr gemeinsamer Sohn ihn braucht. Eine Art gelähmter Irrsinn steckt in ihrer Kehle.
Jemand hat das Pappschild entfernt, das die Schützen mit einem Stein beschwert auf seine Brust gelegt hatten. Auf dem Schild, das mit grünem Textmarker beschrieben war, stand: Toda mi familia está muerta por mi culpa. (Meine ganze Familie ist tot, und es ist meine Schuld.)
Lydia hockt sich zu Füßen ihres Mannes hin. Aber sie will nicht fühlen, wie seine blasse Haut immer kälter wird. Stattdessen greift sie nach seiner Schuhspitze und schließt die Augen. Er ist äußerlich fast unversehrt, und dafür ist sie dankbar. Sie weiß, dass sie das Pappschild auch mit der Klinge einer Machete an seiner Brust hätten befestigen können. Sie weiß, dass die relative Sauberkeit seines Todes eine Art kranke Freundlichkeit ist. Sie hat schon andere Tatorte gesehen, albtraumartige Dinge – Leichen, die keine vollständigen Körper mehr waren, sondern nur Leichenteile, mutilados. Wenn das Kartell mordet, tut es das, um Exempel zu statuieren, um andere mit einer übertriebenen und grotesken Demonstration zu warnen. Eines Morgens bei der Arbeit, als sie ihren Laden gerade öffnen wollte, sah Lydia einen Jungen, den sie kannte. Er kniete, um das Gitter vor dem Schuhladen seines Vaters zu öffnen, weil er den Schlüssel an einem Schnürsenkel um den Hals trug. Er war sechzehn Jahre alt. Als das Auto heranfuhr, konnte das Kind nicht wegrennen, weil der Schlüssel sich im Schloss verhakt hatte; er hing mt dem Hals in seiner Schnürsenkelschlinge fest. Also hoben die sicarios das Gitter an und hängten das Kind an dem Schnürsenkel auf. Dann schlugen sie auf ihn ein, bis er nur noch zucken konnte. Lydia war hineingerannt und hatte die Tür hinter sich verriegelt, daher konnte sie nicht sehen, wie sie ihm die Hose herunterzogen und ihn dekorierten, aber davon hörte sie später. Sie alle hörten davon. Und jeder Ladenbesitzer in der Nachbarschaft wusste, dass der Vater des Kindes nicht die mordidas an das Kartell hatte bezahlen wollen.
Also, ja, Lydia ist dankbar, dass sechzehn ihrer Lieben durch schnelle, saubere Gewehrsalven getötet wurden. Die Polizisten im Garten wenden den Blick von ihr ab, und dafür ist sie genauso dankbar. Der Tatortfotograf legt die Kamera auf den Tisch neben das Glas, an dessen Rand immer noch Spuren von Lydias trüffelfarbenem Lippenstift zu erkennen sind. Die Eiswürfel sind geschmolzen, ein kleines Pfützchen aus Kondenswasser hat sich um das Glas herum gesammelt. Diese Tatsache kommt Lydia unglaublich vor - dass ihr Leben in kürzerer Zeit vollkommen zerstört wurde, als ein Pfützchen Kondenswasser braucht, um zu verdunsten.
Sie ist sich der respektvollen Stille bewusst, die jetzt auf der Terrasse herrscht. Sie beugt sich zu Sebastián hinunter, ohne aufzustehen. Sie krabbelt auf allen vieren neben ihm ein Stückchen nach oben, dann hält sie inne, starrt seine ausgestreckte Hand an, betrachtet die Falten und Kerben seiner Knöchel, die perfekten Halbmonde auf seinen Nägeln. Die Finger rühren sich nicht. Der Ehering. Sebastiáns Augen sind geschlossen, und absurderweise fragt sich Lydia, ob er sie wohl absichtlich geschlossen hat, für sie, als letzten Akt der Zärtlichkeit, damit sie die Leere in seinem Blick nicht sehen muss. Sie legt die Hand auf ihren Mund, weil sie das Gefühl hat, dass ihr Innerstes sonst herausfallen könnte. Sie drängt das Gefühl wieder zurück, legt ihre Finger in die regungslose Hand und lehnt sich sanft über seine Brust. Er ist bereits kalt. Er ist kalt. Sebastián ist tot, und was geblieben ist, ist nur seine geliebte, vertraute Gestalt, die nicht mehr atmet.
Sie fährt mit den Fingern über seinen Kiefer, sein Kinn. Sie presst die Lippen zusammen und legt die Handfläche auf seine kühle Stirn. Als sie ihn zum allerersten Mal sah, saß er über einen Spiralblock gebeugt in einer Bibliothek in Mexico City, mit einem Stift in der Hand. Die Neigung seiner Schultern, die vollen Lippen. Er trug ein lilafarbenes T-Shirt mit der Aufschrift irgendeiner Band darauf, die sie nicht kannte. Sie versteht jetzt, dass es nicht sein Körper, sondern die Art war, wie er ihn belebte, die sie so begeistert hatte. Die unebenen Steinplatten graben sich in ihre Knie, und sie überschüttet ihn mit Gebeten. Ihre Tränen kommen schubweise. Die verbogene Grillzange liegt in einer Pfütze geronnenen Blutes, und am flachen Teil klebt noch ein wenig rohes Fleisch. Lydia kämpft gegen die aufsteigende Übelkeit an, lässt ihre Hand in die Hosentasche ihres Mannes gleiten, um die Autoschlüssel herauszuholen. Wie oft in ihrem gemeinsamen Leben hat sie schon in seine Tasche gegriffen? Nicht denken, nicht denken, nicht denken.
Ihm den Ehering abzuziehen ist schwierig. Die lockere Haut seiner Knöchel schiebt sich unter dem Ring zusammen, also muss sie ihn drehen. Sie muss den Finger mit einer Hand gerade halten und mit der anderen am Ring drehen, und endlich hat sie seinen Ehering in der Hand, denselben, den sie ihm vor mehr als zehn Jahren in der Catedral de Nuestra Señora de la Soledad an den Finger gesteckt hat. Sie schiebt sich den Ring auf den Daumen, legt beide Hände auf Sebastiáns Brust und stemmt sich so hoch. Sie taumelt beinahe von ihm fort. Sie wartet, dass sie jemand wegen der Schlüssel anspricht. Wünscht sich beinahe, dass jemand sagt, sie könne sie nicht nehmen, dass sie keine Beweismittel manipulieren dürfe oder so einen Bockmist. Wie befriedigend das wäre, zumindest für den Augenblick, an jemandem die Wut auslassen zu können.
Aber keiner wagt es.
Lydia steht mit gesenkten Schultern da. Ihre Mutter. Sie tritt zu Abuela, deren Leiche eine von denen ist, über die man eine schwarze Plastikplane gelegt hat. Ein Polizist kommt zu ihr, um sie aufzuhalten.
«Señora, bitte», sagt er schlicht.
Lydia sieht ihn mit wildem Blick an. «Ich brauche einen Moment, um mich von meiner Mutter zu verabschieden.»
Er schüttelt den Kopf, nur einmal, es ist eine kaum wahrnehmbare Bewegung. Seine Stimme ist leise. «Ich versichere Ihnen», sagt er, «dass das nicht Ihre Mutter ist.»
Lydia blinzelt, sie rührt sich nicht. Sie hält die Autoschlüssel ihres Mannes fest in der Hand. Er hat recht. Sie könnte noch länger in dieser Landschaft des Gemetzels bleiben, aber warum? Sie sind alle tot. So will sie sich nicht an sie erinnern. Sie wendet sich von den sechzehn auf dem Boden liegenden Gestalten im Garten ab und geht mit einem Quietschen und einem Knallen durch die Küchentür. Draußen nehmen die Beamten ihre Tätigkeiten wieder auf.
Lydia öffnet den Schrank im Schlafzimmer ihrer Mutter und holt Abuelas einziges Gepäckstück heraus: eine kleine rote Reisetasche. Lydia öffnet den Reißverschluss und sieht, dass sie vollgestopft ist mit kleineren Taschen. Eine Taschentasche. Lydia wirft sie alle aufs Bett. Dann öffnet sie den Nachttisch ihrer Mutter und holt ihren Rosenkranz und ein kleines Gebetbuch heraus. Sie legt beides in die große Tasche, zusammen mit Sebastiáns Schlüsseln. Dann beugt sie sich hinunter und schiebt den Arm unter die Matratze ihrer Mutter. Sie fährt darunter entlang, bis ihre Fingerspitzen Papier berühren. Sie holt das Bündel heraus: fast fünfzehntausend Pesos. Sie legt sie in die Tasche. Sie wirft die ganzen Taschen zurück in den Schrank ihrer Mutter, geht mit der Umhängetasche ins Badezimmer, öffnet den Medizinschrank und nimmt, was sie zu fassen bekommt – eine Haarbürste, eine Zahnbürste, Feuchtigkeitscreme, eine Tube Lippenbalsam, eine Pinzette. Alles kommt in die Tasche. Sie tut das alles mechanisch, ohne darüber nachzudenken, welche Gegenstände nützlich oder überflüssig sind. Sie tut es, weil sie nicht weiß, was sie sonst tun soll. Lydia und ihre Mutter haben dieselbe Schuhgröße, was jetzt ein kleiner Segen ist. Lydia nimmt das einzige Paar bequeme Schuhe aus dem Schrank ihrer Mutter – ein Paar gesteppte Goldlamé-Slipper, die Abuela immer im Garten trug. In der Küche fährt sie mit ihrer Razzia fort: eine Packung Kekse, eine Dose Erdnüsse, zwei Tüten Chips, alles heimlich in die Tasche gestopft. Die Handtasche ihrer Mutter hängt an einem Haken hinter der Küchentür neben zwei weiteren Haken, an denen sich Abuelas Schürze und ihr petrolfarbener Lieblingspulli befinden. Lydia nimmt die Tasche und schaut hinein. Es kommt ihr vor, als öffnete sie den Mund ihrer Mutter. Alles darin ist viel zu persönlich. Lydia nimmt die ganze Tasche, stopft das weiche braune Leder zusammengelegt in die Seitentasche der Reisetasche und zieht den Reißverschluss zu.
Der Detective sitzt neben Luca auf der Couch, als Lydia wiederkommt, aber er stellt ihr keine Fragen. Sein Notizbuch und der Stift liegen auf dem Couchtisch.
«Wir müssen gehen», sagt sie.
Luca steht sofort auf.
Der Detective steht ebenfalls auf. «Ich muss Sie wirklich davor warnen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Hause zurückzukehren, Señora», sagt er. «Das ist womöglich nicht sicher. Wenn Sie hier warten, kann einer unserer Männer Sie vielleicht fahren. Wir könnten einen sicheren Ort für Sie und Ihren Sohn finden.»
Lydia lächelt, und kurz wundert sie sich, dass ihr Gesicht noch dazu in der Lage ist. Ein kleines Auflachen. «Ich glaube, wir haben ohne Ihre Hilfe bessere Chancen.»
Der Detective runzelt die Stirn, nickt aber. «Kennen Sie einen sicheren Ort?»
«Bitte belasten Sie sich doch nicht mit der Sorge um unser Wohlergehen», versetzt sie. «Dienen Sie der Gerechtigkeit. Machen Sie sich darum Gedanken.» Sie weiß, dass die Worte wie winzige Dartpfeile ihren Mund verlassen, ebenso fruchtlos wie zornig. Sie gibt sich keine Mühe, sich zurückzuhalten.
Der Detective steht mit den Händen in den Taschen da und schaut finster zu Boden. «Ihr Verlust tut mir so leid. Wirklich. Ich weiß, wie es aussehen muss, weil die Morde alle nicht aufgeklärt werden, aber es macht mir trotzdem etwas aus. Es gibt noch Menschen, die sich Sorgen machen, die immer noch entsetzt über all diese Gewalt sind. Bitte seien Sie versichert, dass ich alles versuchen werde.» Er begreift ebenfalls die Sinnlosigkeit seiner Worte, aber er fühlt sich trotzdem bemüßigt, sie auszusprechen. Dann greift er in seine Brusttasche und zieht eine Visitenkarte mit seinem Namen und einer Telefonnummer hervor. «Wir brauchen eine offizielle Aussage, sobald Sie sich dazu in der Lage fühlen. Nehmen Sie sich ein paar Tage Zeit, wenn Sie wollen.»
Er streckt ihr die Karte entgegen, aber Lydia rührt sich nicht, daher greift Luca danach. Er hat sich dicht neben seine Mutter gestellt und einen Arm durch den Gurt der roten Umhängetasche gesteckt.
Diesmal folgt der Detective ihnen nicht. Ihre Schatten bewegen sich wie ein klobiges Tier den Bürgersteig entlang. Unter dem Scheibenwischer ihres Autos, einem orangefarbenen VW Käfer, den man sofort überall wiedererkennt, steckt ein winziger Zettel, so klein, dass er nicht einmal in der heißen Brise flattert, die durch die Straße weht.
«Carajo», entfährt es Lydia. Sie schiebt Luca automatisch hinter sich.
«Was ist, Mami?»
«Bleib hier. Nein, stell dich lieber da drüben hin.» Sie zeigt in die Richtung, aus der sie gekommen sind, und diesmal wehrt Luca sich nicht. Er trottet die Straße wieder hinunter, ein Dutzend Schritte oder mehr. Lydia lässt die Reisetasche vor ihre Füße auf den Bürgersteig fallen, tritt einen Schritt vom Auto weg, schaut sich nach beiden Seiten um. Ihr Herz schlägt ganz langsam; es fühlt sich in ihrer Brust an wie Blei.
Die Parkerlaubnis ihres Mannes klebt an der Windschutzscheibe. Ein paar Rostflecken sind auf der Stoßstange verteilt. Sie tritt auf die Straße, beugt sich vor, um den Zettel zu lesen, ohne ihn berühren zu müssen. Der Wagen eines Nachrichtensenders parkt direkt am gelben Absperrband am anderen Ende des Blocks, aber der Reporter und der Kameramann sind mit ihren Vorbereitungen beschäftigt und haben sie noch nicht bemerkt. Sie dreht ihnen den Rücken zu und zieht den Zettel unter dem Scheibenwischer hervor. Ein Wort, geschrieben mit grünem Textmarker: Buh! Der hastige Atemzug, den sie tut, fühlt sich an wie ein Stich durchs Innerste ihres Körpers. Sie schaut zu Luca hinüber, zerknüllt den Zettel in ihrer Faust und stopft ihn in ihre Tasche.
Sie müssen verschwinden. Sie müssen fort von Acapulco, so weit fort, dass Javier Crespo Fuentes sie niemals finden kann. Sie können nicht mit diesem Auto fahren.