Die Kleider der Frauen
Roman
Aus dem Englischen von Christine Strüh
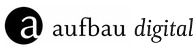
Natasha Lester war Marketingleiterin bei L’Oré;al und verantwortlich für die Marke Maybelline, bevor sie sich entschloss, an die Uni zurückzukehren und Creative Writing zu studieren. Heute lebt sie als Autorin und Dozentin in Perth, Australien, und ist Mutter dreier Kinder. Ihre Romane, in denen es stets um spezifisch weibliche Aspekte der Geschichte geht, sind internationale Bestseller.
Mehr zur Autorin unter www.natashalester.com.au
Christine Strüh übertrug u.a. Kristin Hannah, Gillian Flynn und Cecelia Ahern ins Deutsche. Sie lebt in Berlin.
»Zu lieben kann Wunden reißen, aber es kann diese auch heilen.«
1940: Als die Deutschen Paris einnehmen, wird die Haute-Couture-Schneiderin Estella in eine Mission der Résistance verwickelt, bei der sie dem geheimnisvollen Alex begegnet. In letzter Sekunde verhilft Estellas Mutter ihr zur Flucht, und sie gelangt nach New York – mit nicht mehr in der Tasche als einem goldenen Kleid und einem Traum: sich als Designerin in der von Männern beherrschten Welt der Mode einen Namen zu machen. Und dann steht sie auf einmal Alex gegenüber, der mehr über das Schicksal ihrer in Frankreich gebliebenen Mutter weiß, als er preisgeben will ...
»Natasha Lester erzählt von Frauen, die den Lauf der Welt verändern – und die Kleider, von denen sie schreibt, bringen einen zum Träumen!« Ulrike Renk
Einmal im Monat informieren wir Sie über
Folgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Die Kleider der Frauen
Roman
Aus dem Englischen von Christine Strüh
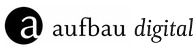
Inhaltsübersicht
Über Natasha Lester
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil 1 Estella
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Teil 2 Fabienne
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil 3 Estella
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Teil 4 Fabienne
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil 5 Estella
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Teil 6 Fabienne
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Teil 7 Estella
Kapitel 27
Kapitel 28
Teil 8 Fabienne
Kapitel 29
Teil 9 Estella
Kapitel 30
Kapitel 31
Teil 10 Fabienne
Kapitel 32
Teil 11 Estella
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Teil 12 Fabienne
Kapitel 37
Kapitel 38
Nachwort der Autorin
Dank
Anmerkung zur Übersetzung
Impressum
Für Ruby
Ich habe dir versprochen, dass du mit zwölf anfangen kannst,
meine Bücher zu lesen. Damals schien das so weit weg zu sein.
Aber nun ist es so weit, meine kleine Seelenverwandte,
und ich hoffe, du wirst Bücher und
historische Geschichten immer lieben.
Viel Spaß beim Lesen, mein wunderbares Mädchen.
2. Juni 1940
Estella Bissette rollte einen Ballen goldene Seide aus und sah, wie der Stoff zu tanzen begann und quer über den Arbeitstisch einen Cancan hinlegte. Fasziniert strich sie mit der Hand über den Stoff, der sich so zart und sinnlich anfühlte wie Rosenblüten und nackte Haut. »What’s your story, morning glory«, murmelte sie auf Englisch.
Prompt hörte sie ihre Mutter lachen. »Estella, du klingst amerikanischer als jeder Amerikaner.«
Estella lächelte. Ihr Englischlehrer, der letztes Jahr den Unterricht beendet hatte, um sich dem Exodus aus Europa anzuschließen, hatte genau das Gleiche gesagt. Kurz entschlossen klemmte sie den Stoffballen unter den Arm, drapierte die Seide über die Schulter und schwang sich, ohne auf die warnenden »Attention!«-Rufe der anderen Frauen zu achten, in einen wilden Tango. Von den Zwischenrufen angestachelt begann sie zu singen, und stimmte spontan, immer wieder von Lachsalven unterbrochen, Josephine Bakers rasantes I Love Dancing an.
Nach einer gekonnten Rückbeuge richtete sie sich zu schnell wieder auf, so dass die goldene Seide über den Arbeitstisch der beiden jungen Näherinnen wischte, Nannettes Kopf knapp verpasste, um schließlich auf Maries Schulter zu landen.
»Estella! Mon Dieu!«, schimpfte Marie und fasste sich an die Schulter, als wäre sie verletzt.
Estella küsste sie auf die Wange. »Aber sieh nur, er verdient mindestens einen Tango«, erklärte sie und deutete auf den Stoff, der selbst in der alltäglichen Umgebung des Ateliers leuchtete wie der Mond im Sommer und ganz eindeutig für ein Kleid bestimmt war, das nicht bloß für Aufmerksamkeit sorgen, sondern die Blicke schneller auf sich ziehen würde, als Cole Porters Finger im berüchtigten Jazzclub Bricktop’s in Montmartre über die Klaviertasten jagten.
»Der Stoff hat vor allem eines verdient – dass du dich mit ihm hinsetzt und endlich anfängst zu arbeiten«, grummelte Marie.
Angelockt von dem Lärm erschien auch Monsieur Aumont an der Tür, warf einen Blick auf die seidendrapierte Estella und meinte lächelnd: »Was hat ma petite étoile sich denn jetzt wieder ausgedacht?«
»Mich mit diesem Stoff zu prügeln!«, beklagte sich Marie.
»Ein Glück, dass du gut gepolstert bist und Estellas Späße aushalten kannst«, neckte sie Monsieur Aumont, und Marie nuschelte etwas vor sich hin, das niemand verstand.
»Was machen wir daraus?«, fragte Estella und strich zärtlich über die goldenen Falten.
»Das hier«, antwortete Monsieur Aumont. Mit einer eleganten Verbeugung reichte er ihr eine Skizze.
Es war ein Lanvin-Kleid, eine Überarbeitung der berühmten La-Cavallini-Robe aus den zwanziger Jahren, aber statt mit Tausenden Perlen und Kristallen war die große Schleife hier mit Hunderten winzigen goldenen Rosenknospen verziert.
»Oh!«, hauchte Estella und berührte behutsam die Zeichnung. Sie wusste, dass die zarten Blumenreihen von Weitem aussehen würden wie ein einziger funkelnder Goldstrudel und ihre wahre Komposition – ein geschwungenes Band von Rosen – erst zu erkennen sein würde, wenn man der Trägerin nahe genug kam. Und es gab bei diesem Kleid keine militärischen Schulterklappen, keine umgehängte Gasmaskentasche, genauso wenig wie es in einem der zahlreichen Blautöne gehalten war – Maginot-Blau, Royal-Air-Force-Blau, gedecktes Stahlblau –, die Estella inzwischen allesamt aus tiefstem Herzen hasste. »Wenn meine Entwürfe eines Tages so aussehen«, sagte sie und betrachtete bewundernd Lanvins exquisite Illustration, »werde ich so glücklich sein, dass ich nie wieder einen Liebhaber brauche.«
»Estella!«, wies Marie sie zurecht, als dürfte eine Zweiundzwanzigjährige dieses Wort nicht kennen und schon gar nicht laut aussprechen.
Grinsend schaute Estella zu Jeanne, ihrer Mutter, hinüber.
Diese hatte, wie es ihre Art war, während des ganzen Geschehens unbeirrt weiter winzige Kirschblüten aus Seide geformt. Sie blickte nicht auf, mischte sich nicht ein, aber Estella sah, dass sie sich ein Grinsen verkneifen musste, denn sie wusste, wie viel Spaß es ihrer Tochter machte, die arme Marie zu schockieren.
»Ein Kleid ist doch kein Ersatz für einen Liebhaber«, meinte Monsieur Aumont ernst und deutete auf die Seide. »Du hast zwei Wochen Zeit, um das hier in ein goldenes Bouquet zu verwandeln.«
»Wird es Reste geben?«, fragte Estella, den Stoffballen noch immer fest an sich gedrückt.
»Wir haben vierzig Meter bekommen, aber nach meinen Berechnungen solltest du nur sechsunddreißig brauchen – wenn du sorgfältig arbeitest.«
»Ich werde so exakt arbeiten wie beim Klöppeln von Calais-Spitze«, erwiderte Estella ehrfürchtig.
Die Seide wurde zum Spannen mit Nägeln auf einem Holzrahmen befestigt, dann, um sie fester zu machen, mit einer Zuckerlösung bestrichen, so dass Marie mit den schweren eisernen Stanzformen Kreise herausstechen konnte.
Als Marie fertig war, legte Estella ein sauberes weißes Stück Stoff über einen Schaumstoffblock, erhitzte ihre Modellierkugel auf niedriger Flamme, überprüfte die Temperatur in einer Schüssel mit Wachs, legte eine der runden goldenen Stoffscheiben auf das weiße Tuch und drückte dann die warme Kugel in die Seide, die sich sofort darumschmiegte und zu einem wunderschönen Blütenblatt formte. Estella legte das Blatt zur Seite, wiederholte den Vorgang mit dem nächsten goldenen Seidenkreis, und bis zum Mittag hatte sie bereits zweihundert Rosenblüten zusammengesetzt.
Wie jeden Tag plauderte und lachte sie bei der Arbeit vergnügt mit Nannette, Marie und ihrer Mutter, doch alle wurden ernst, als Nannette leise sagte: »Ich habe gehört, dass inzwischen mehr französische Soldaten aus dem Norden fliehen als belgische oder niederländische Zivilisten.«
»Wenn die Soldaten fliehen, was steht dann noch zwischen uns und den Deutschen?«, fragte Estella. »Sollen wir Paris mit unseren Nähnadeln verteidigen?«
»Der Wille des französischen Volkes steht zwischen uns und den Boches. Frankreich wird sich nicht ergeben«, erklärte Jeanne mit Nachdruck, und Estella seufzte.
Die Diskussion war sinnlos. So gern Estella ihre Mutter in Sicherheit gebracht hätte, so sicher wusste sie, dass sie und ihre Mutter niemals weglaufen, sondern weiterhin im Atelier sitzen und Stoffblumen formen würden, als wäre Mode das Wichtigste auf der Welt. Für sie gab es keinen Ausweg. Sie würden sich nicht den nach Süden strömenden Flüchtlingen aus den Niederlanden, Belgien und Nordfrankreich anschließen, denn sie hatten keine Verwandten auf dem Land, bei denen sie Zuflucht finden konnten.
In Paris hatten sie ein Zuhause und Arbeit, jenseits der Stadt hatten sie nichts. Obwohl der Glaube ihrer Mutter, dass die Franzosen der deutschen Armee Widerstand leisten könnten, ihr Sorgen bereitete, wusste Estella keine Erwiderung darauf. Und war es denn so falsch, solange Couturiers wie Lanvin nach goldenen Stoffblumen verlangten, innerhalb der vier Wände ihres Ateliers wenigstens noch ein paar Tage so zu tun, als könnte alles gut gehen?
In der Mittagspause aßen sie in der Küche des Ateliers Kanincheneintopf. Estella saß etwas abseits und zeichnete. Mit Bleistift skizzierte sie ein Kleid mit bodenlangem, schmal geschnittenem Rock, Flügelärmeln, einer schmalen Schärpe aus goldener Seide um die Taille und einem eleganten V-Ausschnitt, den als unerwartetes Detail ein Revers wie auf einem Herrenhemd zierte, was das Kleid modisch und besonders zugleich machte. Obwohl der Rock eng anlag, würde man darin gut tanzen können; kühn und golden, war dies ein Kleid, um das Leben zu feiern. Und alles, was Leben verhieß, war in Paris im Juni 1940 hochwillkommen.
Als Jeanne mit dem Essen fertig war, ging sie, obwohl die Mittagspause erst in fünfzehn Minuten zu Ende wäre, durchs Atelier zu Monsieur Aumonts Büro. Estella beobachtete die Gesichter der beiden, die leise miteinander tuschelten. Monsieur Aumont hatte im Großen Krieg gekämpft und gehörte zu den gueules cassées – so nannte man die Männer, deren Gesicht von einem Artilleriegeschoss, einer Kugel oder was auch immer zerstört worden war. Ihm hatte ein Flammensturm die Lippen verformt und von der Nase kaum etwas gelassen. Ein schrecklicher Anblick, der Estella längst nicht mehr auffiel, den Aumont jedoch außerhalb seines Ateliers unter einer Kupfermaske verbarg. Er machte kein Hehl aus seiner tiefen Abneigung gegen die Deutschen, die Boches, wie er und Jeanne sie nannten. In letzter Zeit hatte Estella immer wieder mitbekommen, dass Männer im Atelier aus und ein gingen und sich im Treppenhaus mit Aumont trafen. Angeblich lieferten sie Stoff oder Färbemittel, aber ihre Kartons wurden nur von Monsieur Aumont höchstpersönlich ausgepackt.
Jeanne gehörte zu den 700 000 Kriegswitwen aus dem Großen Krieg – ihr Mann war bald nach der Hochzeit gefallen, sie war damals gerade erst fünfzehn gewesen. Hier tuschelten also zwei Menschen ständig miteinander, die allen Grund hatten, die Deutschen zu hassen, und ihre Ernsthaftigkeit wies keinesfalls auf eine heimliche Romanze hin.
Estella beugte sich wieder über ihre Skizze, als ihre Mutter zurückkam.
»Très, très belle«, sagte Jeanne mit einem Blick auf den Entwurf ihrer Tochter.
»Das nähe ich mir heute Abend aus den Stoffresten.«
»Und ziehst es an, wenn du ins La Belle Chance gehst?«, fragte ihre Mutter. Das La Belle Chance war ein Jazzclub in Montmartre, den Estella besuchte, obwohl kaum noch Männer in der Stadt waren, seit die französische Armee vergangenes Jahr mobilgemacht hatte und die Briten bei der Schlacht von Dunkerque im Mai geflohen waren. Eigentlich gab es nur noch Männer, die in der Kriegsindustrie arbeiteten und deshalb vom Wehrdienst freigestellt waren.
»Oui.« Estella lächelte ihrer Mutter zu.
»Ich gehe nachher zur Gare du Nord.«
»Dann wirst du morgen müde sein.«
»Genau wie du heute«, erwiderte Jeanne.
Gestern war es Estella gewesen, die auf dem Bahnhof gestanden und Suppe an die Flüchtlinge verteilt hatte, die durch Paris zogen. Manche hatten es geschafft, mit dem Zug hierherzukommen, während andere auf der Flucht vor den Deutschen Hunderte von Kilometern zu Fuß zurückgelegt hatten. Sobald sie sich gestärkt hatten, machten die Flüchtlinge sich von Neuem auf den Weg, um Zuflucht bei Verwandten zu suchen, oder sie schleppten sich, so weit die Füße sie trugen, fort von der Front, auf die andere Seite der Loire, wo man angeblich in Sicherheit war.
Der Tag verging, Rosenknospe um Rosenknospe. Um sechs verließen Estella und ihre Mutter gemeinsam das Atelier. Sie gingen die Rue des Petits-Champs hinter dem Palais-Royal entlang, vorbei an der Place des Victoires und an Les Halles, vor denen anstelle der üblichen Lkw nun von Pferden gezogene Wagen warteten, um Lebensmittel anzuliefern. Die Realität, die Estella mit einem Stoffballen wunderschöner goldener Seide zu verdrängen versucht hatte, machte sich hier mit Nachdruck bemerkbar.
Zuallererst war es die gespenstische Ruhe – es war nicht wirklich still, aber um diese Uhrzeit hätte es hier von Näherinnen, Schneidern, Zuschneidern und Models wimmeln sollen, die nach Feierabend auf dem Heimweg waren. Doch kaum jemand eilte an den leeren Ateliers und Läden vorbei. Wo noch vor einem Monat alles voller Leben gewesen war, herrschte trostlose Leere. Als am 10. Mai der drôle de guerre – der »seltsame Krieg«, dann als »Sitzkrieg« bezeichnet – vorbei war und Hitlers Armee in Frankreich einmarschierte, hatten viele Menschen Paris auf schnellstem Wege verlassen. Als Erstes die Amerikaner in ihren schicken Limousinen mit Chauffeur, dann die Familien mit älteren Autos, dann diejenigen, denen es wenigstens gelungen war, Pferd und Wagen aufzutreiben.
Es war ein warmer, milder Juniabend, der Flieder duftete, wie mit Perlenketten behangen blühten die Kastanien, hier und dort gab es noch ein offenes Restaurant, ein Kino oder ein Modehaus, dessen Pforten noch nicht geschlossen waren wie bei der Maison Schiaparelli. Irgendwie ging das Leben weiter. Wenn man nur die Katzen hätte ignorieren können, die, von ihren geflüchteten Besitzern zurückgelassen, durch die Straßen streunten. Die abgedeckten Straßenlaternen, die Fenster mit Verdunkelungsvorhängen. Nichts davon erzählte von einem Pariser Sommer der Liebe.
»Ich habe gesehen, wie du mit Monsieur Aumont geredet hast«, begann Estella unvermittelt, als sie die Rue du Temple überquert hatten und der Marais sie mit seinem vertrauten Geruch nach Abfall und Leder empfing.
»Er begleitet mich heute Abend, wie üblich«, erklärte Jeanne.
»Zur Gare du Nord?«, hakte Estella nach. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass sich ihre Mutter in letzter Zeit, wenn sie abends wegging, nicht nur um das Verteilen von Suppe kümmerte.
»Oui«, antwortete Jeanne und drückte ihren Arm. »An der Gare du Nord fange ich an.«
»Und dann?«
»Bin ich vorsichtig.«
Was Estellas Verdacht bestätigte. »Ich komme mit.«
»Nein. Genieße lieber die Zeit, die noch bleibt.«
Auf einmal begriff Estella, dass das ganze Gerede, Frankreich werde standhaft bleiben, nicht mehr als ein brennender Wunsch war – jedoch kein Irrglaube, nein, ein Wunsch, an dem ihre Mutter ihr zuliebe festhielt. Nicht zum ersten Mal in ihrem Leben überkam Estella tiefe Dankbarkeit. Jeanne hatte sie allein großgezogen, sie in die Schule geschickt, hatte hart gearbeitet, um für Essen, Kleidung und ein Dach über dem Kopf zu sorgen, und obwohl ihr Leben enge Grenzen kannte und sich fast ausschließlich auf das Atelier und ihre Tochter beschränkte, beklagte sie sich nie.
»Ich liebe dich, Maman«, flüsterte Estella und küsste ihre Mutter auf die Wange.
»Das ist das Allerwichtigste«, erwiderte Jeanne und schenkte ihr eines ihrer seltenen, wunderschönen Lächeln, das ihr Gesicht völlig veränderte und sie auf einmal so jung aussehen ließ, wie sie tatsächlich war. Siebenunddreißig, alles andere als alt. Am liebsten hätte Estella diesen Moment festgehalten und für alle Ewigkeit auf den Nachthimmel gestickt.
Sie blickte ihrer Mutter nach, die nun auf der Rue du Temple in Richtung der Gare du Nord weiterging, und machte sich dann selbst auf den Weg zur Passage Saint-Paul, einer kleinen, schmutzigen Gasse, die zu einem versteckten Eingang der wunderschönen Église Saint-Paul-Saint-Louis führte. Hier wohnten sie. Als sie die Haustür öffnete, begrüßte sie der Concierge – Monsieur Montpellier, ein alter, stets betrunkener Mann – mit einem unfreundlichen Knurren und streckte ihr einen Zettel entgegen.
Estella las ihn und fluchte leise. Das passte ihr überhaupt nicht.
»Putain«, blaffte der Hausmeister, der sie gehört hatte und dem ihre Wortwahl nicht gefiel.
Estella ignorierte ihn, sie musste sich um etwas anderes kümmern. So schnell sie konnte, rannte sie die Wendeltreppe zu ihrer Wohnung im sechsten Stock hinauf und hüllte sich, obwohl es Juni war, in einen langen Umhang. Dann eilte sie denselben Weg zurück, zur Einkaufszentrale eines der amerikanischen Kaufhäuser in einer Seitenstraße der Rue du Faubourg Saint-Honoré.
Wie üblich war Madame Flynn, eine der wenigen amerikanischen Staatsangehörigen, die sich noch in Paris aufhielten, allein in ihrem Büro. Auf dem Schreibtisch stand ein Stapel Kartons mit der Aufschrift Schiaparelli. »Erledigen Sie das so schnell wie möglich«, sagte Madame Flynn, drehte sich weg und tat so, als wüsste sie gar nicht, was sie Estella auftrug. Dabei war natürlich das Gegenteil der Fall.
Estella holte die Kleider aus den Kartons, versteckte sie unter ihrem Umhang und rannte ohne ein weiteres Wort zu Madame Flynn die Treppe hinunter, die Straße entlang und dann eine andere Treppe hinauf zu dem Kopierhaus, in dem Estella, wenn dort Modenschauen stattfanden, ihrer Nebenbeschäftigung nachging. Während der Vorführungen konnten Zeichnerinnen wie sie an einem guten Tag fünfzehn Haute-Couture-Kleider abzeichnen, die sie dann dem Kopierhaus oder den Einkäufern amerikanischer Kaufhäuser verkauften.
Kopien der großen französischen Couturiers – Chanel, Vionnet, Lanvin, Callot Soeurs, Mainbocher – waren in Amerika ebenso gefragt wie in Paris. Estella wusste, dass sie mehr Geld verdient hätte, wenn sie offiziell im Kopierhaus gearbeitet hätte, aber sie wusste auch, dass sie nie die Courage aufbringen würde, etwas Eigenes zu entwerfen, wenn sie Tag für Tag nichts anderes täte, als die Entwürfe anderer Designer zu kopieren – genau genommen zu stehlen. Deshalb arbeitete sie nur während der Schauen als Zeichnerin, ließ ihren Bleistift diskret übers Papier sausen, damit die vendeuse nicht merkte, dass sie nicht nur die Nummer eines Kleides notierte, das ihr Interesse geweckt hatte, sondern die Modelle genauestens analysierte und jedes Detail registrierte – die Zahl der Falten in einem Rock, die Breite eines Jackenrevers, die Größe eines Knopfs. Wobei sie immer darauf hoffte, dass die Models, die die Kleider elegant durch den Raum schweben ließen, möglichst langsam an ihr vorbeitänzelten, damit sie nicht am Schluss mit unfertigen Skizzen dastand, die sie nie würde verkaufen können.
Die Schau von Chanel gefiel Estella immer am besten. Allerdings war es dort am allerschwierigsten, fünfzehn Skizzen zu schaffen. Zwar waren die Schnitte schlicht, aber von solcher Eleganz, dass es umso schwieriger war, sie korrekt einzufangen – bei diesen Entwürfen ging es um viel mehr als nur um Stoff, Knöpfe und Reißverschlüsse. Hier hatte jedes Kleid eine Seele. Außerdem verliefen die Präsentationen bei Chanel immer ruhig und abgeklärt, es herrschte keine Zirkusatmosphäre wie beispielsweise bei Patou, wo man kleine Schummeleien im allgemeinen Trubel gut verbergen konnte. Nein, die vendeuse von Chanel hatte schärfere Augen als ein Scharfschütze, jeder Besucher bekam nur ein einziges Blatt Papier für Notizen, kein dickes Programmheft, das sich zum Verbergen von Skizzen wunderbar eignete, und Estella durfte den Bleistift beim Zeichnen praktisch nicht bewegen.
Estella hatte sich immer eingeredet, es wäre nur ein Spiel, aber jetzt, wo die amerikanischen Einkäufer wegen des Krieges nicht mehr zu den Schauen nach Paris kamen und sie in der letzten Saison dadurch viel weniger verdient hatte, sagte sie sich, dass sie jede Gelegenheit nutzen musste. Nur auf diese Weise könnte sie bei Monsieur Aumont weiter ihre Schulden abbezahlen. Jeanne hatte darauf bestanden, dass ihre Tochter ordentlich Englisch lernte, und so hatte Estella, seit sie sechs war, jeden Tag nach der Schule Privatstunden bekommen, für die ihre Mutter jedoch nicht selbst aufkommen konnte. Monsieur Aumont war eingesprungen, denn in Frankreich durften Frauen kein eigenes Konto eröffnen und deshalb natürlich auch kein Bankdarlehen aufnehmen. Genauso wenig durften sie wählen – im Grunde waren Frauen Menschen zweiter Klasse, deren Existenzberechtigung darin bestand, brav zu Hause zu sitzen, zu backen und Kinder zu bekommen.
Für viele Frauen war der Krieg ein Schock, weil sie nichts anderes gewohnt waren, als sich so hübsch anzuziehen, wie es der Verdienst des Ehemanns erlaubte. Zum Glück hatte Jeanne Bissette ihre Tochter – notgedrungen – zu deutlich mehr Lebenstüchtigkeit erzogen. Auch wenn Monsieur Aumont zweifellos bereit gewesen wäre, ihnen die ganze Summe zu erlassen, wusste Estella ganz genau, dass es für ihre Mutter eine Frage der Ehre war, die Schulden bis zum letzten Centime zurückzuzahlen, und das war nur möglich, wenn Estella etwas dazuverdiente.
Dank der Englischstunden war Estella als Zeichnerin sehr gefragt, denn keiner der amerikanischen Einkäufer sprach Französisch. Wenn sie nun die Kopieraufträge nicht übernahm, würden die Schulden allein auf den Schultern ihrer Mutter lasten, und die Summe war in dem Jahr, das Estella an der Pariser Modeschule auf der Place des Vosges – dem französischen Ableger der New York School of Fine and Applied Art – verbracht hatte, sogar noch angewachsen. Inzwischen war die Schule wegen des Kriegs geschlossen, aber dort war Estellas Traum geboren worden, eines Tages ein eigenes Modestudio und Kundinnen zu haben, die von ihr entworfene, statt von ihr gestohlene Kleider tragen würden. In Momenten wie diesem, mit sechs Schiaparelli-Kleidern unter ihrem Umhang, zweifelte Estella zwar daran, dass ihr Traum jemals wahr werden würde, denn sie wusste nur zu gut, dass es alles andere als ehrenwert war, wenn eine amerikanische Einkäuferin wie Madame Flynn bereit war, eine Auswahl von Kleidern zum Kopieren weiterzugeben, und dass eine Designerin wie Elsa Schiaparelli, hätte sie es erfahren, Estella die Augenlider zunähen würde.
Estella schwor sich, dass es heute zum letzten Mal passieren sollte.
Doch jetzt wartete Madame Chaput darauf, dass Estella loslegte, denn anhand der Kleider, die sie unter dem Umhang hervorholte, erstellten die Anpasser die Schnittmuster, während Estella zeichnete und Madame Chaput notierte, welche Art von Knöpfen sie brauchte, und von den Nähten, an denen niemand es bemerken würde, kleine Stoffproben stahl. Danach bekam Estella von Madame Chaput Geld für ein Taxi und brachte die Kleider zusammen mit der Kommission, die Madame Chaput bezahlt hatte, zurück zu Madame Flynn. Estella wusste, dass die Kleider sich schon morgen auf einem Schiff nach New York befinden würden – falls in dem Chaos, das seit Kurzem herrschte, überhaupt noch Schiffe ablegten –, und dass Madame Chaput innerhalb von zwei Tagen die Modelle nähen ließ, um sie dann an ihre treuen Pariser Stammkundinnen zu verkaufen, die das haute ohne den Preis der couture in ihrem Kleiderschrank haben wollten.
Anschließend ging Estella zurück in den Marais. Ihr war klar, dass sie sich beeilen musste, wenn sie tatsächlich noch ihr Goldkleid nähen und vor Mitternacht im Jazzclub sein wollte. Wieder zu Hause, füllte sie am Wasserhahn im Hof einen Eimer mit Wasser, den sie unter dem schadenfrohen Blick des Concierge die Treppe hinaufschleppte, in die oberste Etage, wo man am wenigsten Miete zahlte. Der Mann hasste Estella und ihre Mutter, weil sie weder vor ihm kuschten noch ihm zu Weihnachten Portwein schenkten, und er weidete sich für sein Leben gern an ihren Mühen im Alltag, die sie mit all denen gemeinsam hatten, die in einem der zahlreichen Pariser Wohnhäuser ohne fließendes Wasser lebten.
Oben angekommen, goss Estella etwas Wasser in einen Topf, stellte ihn auf den Herd und kochte sich einen Kaffee. Dann setzte sie sich an die Nähmaschine, nahm ihre Schere und schnitt nach dem Entwurf, den sie im Atelier gezeichnet hatte, den Stoff zu. Nur zu gern hätte sie einen Zuschneider gehabt, der das Kleid so aus dem Stoff gezaubert hätte, dass es sich dem Körper genau so anschmiegte, wie sie es wünschte – aus ihr würde leider nie eine Madeleine Vionnet werden, die »Königin des Schnitts«, die keine Skizzen anfertigte, sondern gleich die Schere benutzte.
Nach anderthalb Stunden war sie fertig und betrachtete ihr Werk mit einem zufriedenen Lächeln – das Kleid war so geworden, wie sie es sich vorgestellt hatte, und sie zog es sofort an. Wieder einmal fielen ihr ihre abgetragenen Schuhe auf, aber das Schusterhandwerk beherrschte sie nun einmal nicht, und für neue Pumps fehlte ihr das Geld. Für den Fall, dass es später kalt wurde, warf sie wieder den Umhang über, verzichtete jedoch auf die Gasmaske, die eigentlich Vorschrift war. Immerhin hielt sie sich an die Anweisung ihrer Mutter und band ein weißes Halstuch um, damit Autofahrer sie in den verdunkelten Straßen besser sehen konnten.
In Montmartre angekommen, ging sie am Bricktop’s vorbei, das für sie unbezahlbar war, und betrat einen Club, der weniger elegant, aber dafür wesentlich amüsanter war und in dem sich das hier am Montmartre gesprochene Argot auf interessante Weise mit den Saxophon-Riffs mischte. Als sich ein Mann, der garantiert in einer Munitionsfabrik arbeitete, etwas zu dicht an ihr vorbeidrängte, wies sie ihn mit eisigem Blick und ein paar scharfen Worten in seine Schranken und setzte sich dann an einen Tisch zu Renée, Monsieur Aumonts Tochter.
»Bonsoir«, sagte Renée und küsste Estella auf die Wangen. »Hast du vielleicht noch eine Gauloise für mich?«
Estella holte ihre letzten zwei Zigaretten heraus, und sie zündeten sich beide eine davon an.
»Was ist das für ein Kleid?«, fragte Renée bewundernd.
»Das hab ich gerade genäht.«
»Hab ich mir gedacht. So was findet man nicht im Kaufhaus.«
»Stimmt.«
»Aber findest du es nicht ein bisschen zu … ausgefallen?«
Estella schüttelte den Kopf. Renée trug ein Kleid im Heidi-Stil, das einsam und vergessen an einem Ständer im Au Printemps gehangen haben mochte, als hätte es den Rückweg ins Gebirge nicht mehr gefunden. Damit sah sie aus wie alle anderen Frauen im Club, brav und unspektakulär – genau wie der verwässerte Wein, der ihnen serviert wurde.
»Von Estella erwarten wir doch nichts anderes!«, mischte sich eine andere Stimme unüberhörbar amüsiert ein – sie gehörte Huette, Renées Schwester, die sich nun zu Estella beugte und ihr die üblichen Begrüßungsküsschen auf die Wangen drückte. »Du siehst magnifique aus!«, rief sie.
»Tanz mit mir!«, unterbrach ein Mann sie ziemlich unverschämt. Er roch wie das Pigalle um Mitternacht – nach zu viel Alkohol, vermischt mit dem Parfüm all der Mädchen, mit denen er heute Abend schon auf der Tanzfläche geknutscht hatte. Ein Mann, der seinen Seltenheitswert genoss, weil er, wären nicht die meisten Männer beim Militär gewesen, mit seinen schlechten Umgangsformen bei den Frauen keine Chance gehabt hätte.
»Nein, danke«, erwiderte Estella.
»Ich tanz mit dir«, bot sich Renée an.
»Aber ich will die da.« Er deutete auf Estella.
»Nur will dich keine von uns«, entgegnete diese.
»Doch, ich schon!« Renée klang fast verzweifelt, was typisch für die derzeitige Situation war – es konnte passieren, dass ein Mädchen den ganzen Abend keinen Tanzpartner fand, und hier stand nun einer vor ihnen, ein ziemlicher Rüpel zwar, aber was machte das schon?
»Tu’s nicht, Renée«, warnte Huette.
Estella sah, wie Huette ihrer Schwester die Hand auf den Arm legte, eine spontane Geste der Zuneigung, obwohl Renée sie manchmal wahnsinnig machte, und Estella war ein bisschen neidisch. Natürlich war ihr bewusst, dass es albern war, sich nach etwas zu sehnen, was sie nie haben würde, einer Schwester. Sie ermahnte sich, lieber daran zu denken, dass sie wenigstens noch eine Mutter hatte, statt neidisch auf ihre Freundinnen zu werden.
Auf der Tanzfläche zog der Mann Renée so eng wie möglich an sich, und als Estella sah, wie ungeniert er seine Genitalien an sie presste, wandte sie angewidert den Blick ab.
»Komm, lass uns singen, irgendetwas Schnelles, damit sie ihn wieder loskriegt«, sagte Estella.
Huette folgte ihr hinüber zur Band, vier Männer, mit denen Estella und Huette schon an vielen Abenden Klavier gespielt, gesungen und den Musikunterricht aus der Schule sinnvoll genutzt hatten. Estellas Mutter hatte in der Klosterschule singen gelernt, sang zu Hause viel und mit Leidenschaft, als wolle sie die Wohnung lieber mit Musik als mit unnötigem Krimskrams füllen, und diese Liebe zur Musik hatte sie Estella von klein auf vermittelt. Aber während Jeanne vor allem die Oper liebte, bevorzugte Estella den dunklen, rauen Jazz.
Ohne ihr Spiel auch nur eine Sekunde zu unterbrechen, küssten die Musiker Estella auf die Wangen, und Luc, der Pianist, lobte ihr Kleid in einem heftigen Argot, das viele andere Französinnen wohl kaum verstanden hätten. Er spielte den Song zu Ende, stand dann auf, um sich an der Bar etwas zu trinken zu holen, und an seiner Stelle setzte Estella sich ans Klavier, während Huette neben Philippe ans Mikrophon trat. Estella nahm sich die Noten von J’ai Deux Amours vor, jener Hymne auf Paris, die durch Josephine Baker jeder kannte, und die Leute klatschten, als sie loslegte. Beim Spielen hoffte sie inständig, dass diese Liebe zu Paris, die gewiss alle in diesem Raum empfanden, ausreichen würde, um ihre Stadt vor dem zu beschützen, was ihr mit dem Näherrücken der Deutschen womöglich bevorstand. Doch schon bald schubste Huette ihre Freundin vom Klavierhocker, weil sie selbst die hohen Töne nicht gut traf und Estella an ihrer Stelle ans Mikrophon treten lassen wollte.
In den Refrain stimmten alle Gäste ein, und ein paar Sekunden lang gelang es Estella tatsächlich, daran zu glauben, dass doch noch alles gut werden würde. Paris war zu grandios, zu legendär, zu außerordentlich, als dass ein grotesker kleiner Mann namens Adolf Hitler ihm etwas anhaben konnte.
Nach dem Lied blieb sie nicht mehr lange, wechselte nur noch ein paar Worte mit Philippe, Huette und Luc und musste feststellen, dass sie es nicht geschafft hatte, Renée zu retten, denn die verließ den Club gerade mit dem schrecklichen Mann, der sie zum Tanzen aufgefordert hatte. Plötzlich fühlte sich Estella müde, als sei sie viel älter als zweiundzwanzig und melancholischer denn je.
»Ich muss los«, verkündete sie und gab allen die üblichen Küsschen zum Abschied.
In der Stille dieser Pariser Nacht angekommen, machte sie sich nicht sofort auf den Heimweg, sondern wanderte noch eine Weile durch die heruntergekommenen Straßen des Marais. Besonders auffallend war der Verfall bei den Hôtels particuliers, den einst so prachtvollen Stadthäusern des Adels, denen man noch immer ihren Stolz ansah, ganz gleich, was man aus ihnen gemacht hatte – manche wurden als Marmeladenfabriken genutzt, und viele der imposanten Innenhöfe waren mit windschiefen Bretterverschlägen verschandelt oder unter Stapeln von Wagenrädern und Paletten kaum mehr zu erkennen. Wie über den goldenen Stoff im Atelier strich Estella mit der Hand über die Steinmauern und fragte sich, ob die Eleganz, die diesen Mauern innewohnte, den Bomben der Stukas und einer Armee eisgrauer Uniformen standhalten könnte – so wie ein Couture-Kleid, anders als ein Prêt-à-porter-Modell, das Wesen seiner Eleganz niemals verlöre.
Auf den Märkten im Carreau du Temple war alles still, die Stoff- und Gebrauchtkleiderhändler lagen längst im Bett, bereit, in der Morgendämmerung jene Kleider feilzubieten, die von den Bewohnern der Champs-Élysées in ihren Mülltonnen entsorgt worden waren. Das ganze Viertel wirkte verlassen, und Estella begegnete kaum einem Menschen, während sie durch ihre Stadt schlenderte und auf einmal Dinge wahrnahm, die ihr schon lange vertraut waren, deren Schönheit sie jedoch erst jetzt, wo sie möglicherweise dem Untergang geweiht waren, nicht mehr für selbstverständlich nehmen konnte: den verblassenden rot-gold-blauen Glanz des Gemäldes über dem Tor des Hôtel de Clisson, die runden Türmchen, die wie zwei dicke Wächter das Tor des Gebäudes flankierten; die symmetrischen Pavillons und die große gewölbte Passage des Musée Carnavalet.
Ohne es zu wollen, stand Estella plötzlich vor einem Haus in der Rue de Sévigné, einem verlassenen Hôtel particulier, das sie als Kind oft zusammen mit ihrer Mutter besucht und wo sie in den nicht bewohnten Räumen gespielt hatte. Sie hatte den Verdacht, dass Jeanne sich hier mit Monsieur Aumont träfe, konnte aber nicht erkennen, ob sich jemand in dem Gebäude befand, denn alle Verdunkelungsvorhänge waren zugezogen. Lediglich die abgedeckten Laternen verbreiteten ihr gespenstisches blaues Licht. Anders als seine Nachbarn nicht im französischen Barockstil gebaut, ohne erkennbare Symmetrie und Form, besaß das Haus alle schaurigen Eigenschaften eines Spukhauses, es schien der bucklige Unhold der Straße.
Spontan öffnete sie die Holztür, die in den Innenhof führte, wo von den Hausmauern Skulpturen der vier Jahreszeiten herrisch auf sie herabblickten, der Sommer allerdings kopflos und all seiner Macht beraubt. Die Kieswege waren seit Jahren nicht mehr gefegt und geharkt worden, bildeten jedoch noch immer einen Stern, jeder Strahl von Hecken eingerahmt, die längst keine Form mehr besaßen und wild wucherten, wohin sie wollten. Minze, die früher sicher zu einem Kräutergarten gehört hatte, wiegte sich im Wind. Und dann hörte Estella es. Ein Scharren. Ihr lief ein kalter Schauer der Angst über den Rücken.
Suchend wandte sie sich nach dem Geräusch um und entdeckte auf einer schiefen Bank, völlig in sich zusammengesunken, Monsieur Aumont. Aus seiner Kleidung stieg unverkennbar der Geruch von Blut auf.
»Mon Dieu!«, stöhnte Estella.
Aumont hob den Kopf, und Estella sah einen dunklen Blutfleck vorn auf seinem Hemd. »Bitte nimm das«, flüsterte er und gab Estella ein kleines Päckchen. »Bring es zum Théâtre du Palais-Royal. Bitte. Tu es für Paris. Such den engoulevent, die Nachtschwalbe, ihm kannst du vertrauen.«
»Wo ist Maman?«, fragte Estella.
»Zu Hause. In Sicherheit. Geh!«
Er sank wieder nach vorn, und Estella schaffte es mit einiger Mühe, ihn mit dem Rücken an die Bank zu lehnen. Dann sah sie in seine flehenden Augen. »Geh«, wiederholte er heiser. »Tu es für Paris.«
Was immer es sein mochte, das Päckchen, das sie in der Hand hielt, bedeutete Gefahr. Doch es war offenbar so wichtig, dass er dafür sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte. War es wirklich erst eine Stunde her, dass sie von ihrer Liebe zu Paris gesungen hatte? Und nun flehte jemand sie an, etwas für ihre Stadt zu tun.
Monsieur Aumont schloss die Augen. Estella rollte das Bündel auf und entdeckte darin auf Seide gezeichnete Grundrisse von Gebäuden. Zum Glück ließen sie sich leicht in die unauffällige Tasche schieben, die sie ins Futter ihres Umhangs eingearbeitet hatte, um darin kopierte Kleiderentwürfe zu transportieren. Doch sie selbst war viel zu auffällig in ihrem nachtblauen, mit Silberperlen besetzten Samtumhang über einem schimmernden goldenen Kleid.
»Geh!«, flüsterte Monsieur Aumont noch einmal mit zusammengebissenen Zähnen.
Estella nickte, denn auf einmal fühlte sie, wie wahr die Worte waren, die sie im Club gesungen hatte: Paris schwebte in ernster Gefahr, und wenn sie Monsieur Aumonts Bitte erfüllte, konnte sie womöglich einen weiteren Übergriff auf ihre Stadt verhindern.
Estella rannte aus dem Innenhof, hinaus auf die Straße. In ihren Taschen raschelten leise die Karten, als wisperten sie ihr Geheimnisse zu, und sie dachte an all die Geschichten, die sie gehört hatte: dass die Deutschen aus der Luft vergiftete Süßigkeiten abwarfen, um die Kinder in der Stadt krank zu machen. Dass die Deutschen sich als Nonnen verkleideten, um die Einwohner von Paris auszuspionieren. Dass deutsche Fallschirmspringer mitten in der Nacht in der Stadt landeten. Und so fürchtete sie bei jedem, der ihr entgegenkam, er könnte zur Fünften Kolonne gehören, den faschistischen Sympathisanten und willigen Helfershelfern der Deutschen, und würde womöglich kein Mittel scheuen, um zu verhindern, dass sie mit ihrem Päckchen das Theater erreichte. Trotzdem ging sie weiter, die Rue Beautreillis hinunter, an der alten rostigen Uhr vorbei, die immer weiter tickte und die Pariser daran erinnerte, dass ihre Stadt unsterblich sein mochte, ihre Einwohner jedoch nicht. Und das galt auch für Estella.
Dann, in der Hoffnung, dass ihre zahlreichen Umwege sie im Mantel der Dunkelheit hatten verschwinden lassen, bog sie nach rechts ab und eilte in Richtung Palais-Royal. Als sie endlich das Theater erreichte, dankte sie Gott für ihr Kleid, das hoffentlich elegant genug war, den Eindruck zu erwecken, dass sie an einen solchen Ort gehörte.
Sie stieg die geschwungene, mit rotem Teppich bedeckte Treppe hinauf und gelangte oben in einen opulenten Empfangsraum, den sie unter anderen Umständen sicher bewundert hätte. Ein riesiger Kronleuchter verbreitete derart helles Licht, dass Estella unwillkürlich die Augen bedeckte. Üppig geraffte rote Samtvorhänge verhüllten die Eingänge zum Theaterraum, und die Wände waren in einem kräftigen Burgunderrot mit goldenen Verzierungen tapeziert. Auch sonst gab es allerorten Akzente in Gold – der Kronleuchter, die Geländer des obersten Rangs, der Fries, die Umrahmung des Deckenfreskos, das Flachrelief, das sich graziös über der Tür am anderen Ende des Raums wölbte. Frauen in Kleidern, die Estella als Modelle von Chanel, Lucien Lelong und Callot Soeurs identifizierte, saßen entspannt auf roten Samtsesseln, die Männer lachten und nippten Cognac oder Calvados. Estella wusste, dass viele Pariser ihr Leben voller Partys und Festlichkeiten führten wie bisher, aber nach dem, was sie gerade erlebt hatte, erschien es ihr, als wäre sie auf dem Mond oder sonst irgendwo fernab jener Realität gelandet, in der die deutsche Armee kurz davor stand, in Paris einzumarschieren.
Auf einem Klavier erklangen die ersten Takte eines Foxtrotts, und obwohl es dafür kaum Platz gab, begannen mehrere Paare zu tanzen. Estella schob die Kapuze des Umhangs von ihren langen schwarzen Haaren und betrat den Saal.
Wie sollte sie herausfinden, wer oder was diese offenbar männliche Nachtschwalbe war? Als sie den Blick über die Menge wandern ließ, merkte sie, dass in der Mitte des Raums und umringt von einem Kreis von Menschen ein Mann stand, der sie neugierig musterte, allerdings nicht mit dem gleichen unverhohlen lüsternen Blick wie einige der anderen Gäste.
Es half nichts, wenn sie jetzt den Mut verlor. Also machte sie sich, die zitternden Beine unter ihrem Kleid verborgen, auf den Weg durch den Saal, nahm die selbstbewusste Haltung ein, die sie bei so vielen Modenschauen gesehen hatte, und es wichen alle vor ihr zurück.
Als sie vor dem Mann stand, küsste sie ihn auf beide Wangen, lächelte und sagte laut: »Salut, chéri« – ebenfalls im Tonfall der Models, die mit dieser Methode oft genug erfolgreich die Ehemänner reicher Kundinnen verführten.
»Wie schön, dass du hier bist«, murmelte er und legte den Arm um ihre Taille. Er spielte mit, und nun war Estella sicher, dass sie sich nicht in ihm getäuscht hatte.
»Ich interessiere mich für Ornithologie«, murmelte sie leise. »Vor allem für die engoulevents.«
Er ließ sich nicht anmerken, ob ihre Bemerkung sein Interesse erweckte. »Wollen wir tanzen?«, fragte er nur, nahm ihre Hand, entschuldigte sich bei den anderen und führte Estella zu den Paaren, die im Takt der Musik umherwirbelten.
Als er jedoch Anstalten machte, die Schleife ihres Umhangs zu öffnen, schüttelte Estella hastig den Kopf, denn sie musste um jeden Preis verhindern, dass die Skizzen in die Hände des Theaterpersonals gelangten. »Ich behalte ihn lieber an«, erklärte sie.
Ohne ein weiteres Wort schloss er sie in die Arme, und so schwebten sie über die Tanzfläche. Die Musik war gerade in einen langsamen Walzer übergegangen, und da zu der späten Stunde viele der Theaterbesucher ziemlich angetrunken waren, schien es den meisten dabei vor allem um die körperliche Annäherung zu gehen. Estella wurde klar, dass sie ebenso verfahren musste, um nicht aufzufallen. Als ihr Partner einen Schritt auf sie zumachte, kam sie ihm entgegen, bis sie schließlich Brust an Brust, Wange an Wange tanzten und sie seinen festen, muskulösen Körper fühlte. Seine Sonnenbräune deutete darauf hin, dass er viel Zeit im Freien verbrachte, seine Haare waren fast so dunkel wie ihre, die Augen braun. Er sah sehr gut aus, und unter anderen Bedingungen hätte Estella den Tanz wohl genossen. Er schien kein gebürtiger Franzose zu sein, dafür sprach er zu korrekt, zu präzise.
Estella überlegte, ob sie etwas sagen sollte. Aus Monsieur Aumonts Verhalten und dem Blut auf seinem Hemd schloss sie, dass er und vielleicht auch ihre Mutter in etwas verwickelt waren, das viel gefährlicher war, als auf dem Bahnhof Flüchtlingen zu helfen, und dass ihr Tanzpartner ebenfalls beteiligt war. Sie hätte ihm kein Vertrauen geschenkt, wenn Monsieur Aumont, den sie seit ihrer Kindheit kannte, es ihr nicht aufgetragen hätte.
»Ich glaube, ich habe etwas für Sie«, sagte sie schließlich auf Englisch.
Das verblüffte ihn. »Wer zum Teufel sind Sie?« Er sprach nun ebenfalls Englisch, mit leiser, kontrollierter Stimme.
»Sie kennen mich nicht«, antwortete sie, jetzt wieder auf Französisch.
»Sie eignen sich nicht besonders gut für eine Aktion im Geheimen.« Er deutete auf das Kleid, von dem Estella sich in diesem Moment wünschte, es würde weniger Blicke auf sich ziehen.
»Niemand, der etwas zu verbergen hat, zieht so ein Kleid an.«
Der Mann versuchte zwar, es zu kaschieren, dennoch hörte Estella es – er lachte.
»Das ist nicht lustig«, zischte sie verärgert und war kurz davor, die Fassung zu verlieren. Aber sie musste die Sache hinter sich bringen, damit sie zu Monsieur Aumont zurückkehren konnte – bitte, lieber Gott, mach, dass es ihm gut geht – und dann nach Hause, in der verzweifelten Hoffnung, dass ihre Mutter tatsächlich in Sicherheit war.
»Sie sind ziemlich kratzbürstig.«
»Weil ich verflucht wütend bin«, fuhr sie ihn an. »Ich muss mein Cape irgendwo aufhängen, wo es nicht in falsche Hände gerät. Was empfehlen Sie?«
»Da drüben bei der Treppe steht Peter – er kann sich darum kümmern.« Während des ganzen Gesprächs tanzten und lächelten sie, und außer Estella und diesem Mann ahnte niemand im Saal, dass nichts so war, wie es schien.
Estella nickte, machte sich los, und während sie in Richtung der Treppe ging, löste sie die Schleife um ihren Hals und ließ die Hand einen kurzen Moment auf der linken Seitennaht ruhen. Wenn dieser Mann derjenige war, der die Pläne in Empfang nehmen sollte, für die es sich zu verbluten lohnte, würde er die Geste bemerken. Sie wollte ihren Umhang nicht verlieren; immerhin hatte sie ein ganzes Monatsgehalt für den Stoff ausgegeben. Aber es war ein geringer Preis, wenn sie damit Monsieur Aumont helfen konnte. Und ihrer Mutter. Und Paris.
Also überreichte sie ihren Umhang dem Mann, auf den ihr Tanzpartner gezeigt hatte, und rannte die Treppe hinunter, um so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, eilte mit großen Schritten hinaus in die Nacht, weg von den Dingen, die ihr Angst einjagten und ihr zu verstehen gaben, dass ihr bisheriges Leben, das in einem Schneideratelier, umgeben von schönen Dingen, so vielversprechend begonnen hatte, vorbei war.
Plötzlich berührte eine Hand ihren Arm, und sie zuckte erschrocken zusammen. Sie hatte nicht gesehen, dass ihr Tanzpartner ihr folgte, aber irgendwie hatte er es geschafft, neben ihr aufzutauchen. »Ziehen Sie das über«, sagte er und gab ihr eine schwarze Jacke. »Um diese Uhrzeit und in diesem Kleid kommen Sie sonst nicht lebend nach Hause. An Ihrem Umhang ist Blut. Ist es Ihres?«
Seine Hand bewegte sich zu ihrem Gesicht, und sie wich instinktiv zurück, merkte jedoch, dass er nicht vorgehabt hatte, sie zu schlagen, sondern nur prüfen wollte, ob sie verletzt war. Ihre heftige Reaktion brachte ihn dazu, die Hand blitzschnell zurückzuziehen, und im nächsten Augenblick kam es ihr fast vor, als hätte er sie gar nicht erhoben.
»Es ist nicht mein Blut, sondern das von Monsieur –«
Er fiel ihr ins Wort. »Es ist besser, wenn ich nicht weiß, wie er heißt. Können Sie mich zu ihm bringen?«
Estella nickte, und er folgte ihr. Allem Anschein nach kannte er sich in den Straßen von Paris ebenso gut aus wie sie selbst, denn er fragte kein einziges Mal nach, sondern ging mit raschen Schritten ganz selbstverständlich neben ihr her. Erst als sie durch die Passage Charlemagne gingen und das Labyrinth der bröckelnden, weiß gekalkten Innenhöfe des Village Saint-Paul betraten, durch das ihnen niemand ungesehen würde folgen können, warf er ihr einen fragenden Blick zu.
Sie hatte nicht mit ihm gesprochen, seit sie losgegangen waren. »Es ist nicht mehr weit«, erklärte sie und fügte dann hinzu: »Wer sind Sie eigentlich?«
Er schüttelte den Kopf. »Es ist besser für Sie, wenn ich Ihnen das nicht sage.«
Ein Spion. Obwohl ihr klar war, dass er sie hier, in den Mauern des Village, verborgen im Marais, mühelos erschießen oder erstechen konnte – oder was immer Männer wie er mit den Menschen anstellten, die ihnen in die Quere kamen –, konnte sie sich die Frage nicht verkneifen: »Auf welcher Seite stehen Sie?«
»Ich habe mich noch nicht bedankt«, sagte er, was eigentlich keine Antwort war. »Aber diese Unterlagen werden dem französischen Volk einen großen Dienst erweisen.«
»Und den Briten?«, drängte sie nach mehr Information.
»Und allen Alliierten.«