Die Spionin
Roman
Aus dem Englischen
von Gabriele Weber-Jarić
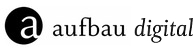
Imogen Kealey ist das gemeinsame Pseudonym des Drehbuchautors Darby Kealey und der Autorin historischer Romane Imogen Robertson. Kealey lebt als Autor und Producer in Los Angeles. Neben der hochgelobten Serie »The Patriots« hat er zahlreiche Kino- und TV-Drehbücher geschrieben. Imogen lehrte in Cambridge und lebt heute in London. Ihre Romane wurden mehrfach ausgezeichnet. »Die Spionin« ist ihr erster gemeinsamer Roman und wird zurzeit mit Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway verfilmt.
Gabriele Weber-Jarić lebt als Autorin und Übersetzerin in Berlin. Sie übertrug u. a. John Boyne, Mary Morris, Mary Basson und Kristin Hannah ins Deutsche.
Die Geschichte, die keiner kennt: ein einmalig fesselnder Roman über eine der faszinierendsten und dennoch kaum bekannten Heldinnen der jüngeren Geschichte: Nancy Wake.
Für die Allierten ist sie ihre beste Agentin, eine gefürchtete Kämpferin, die ihre Gegner mit einem Handschlag zu töten vermag.
Für die Nazis ist sie die meistgesuchte Person Frankreichs, ein gefürchtetes Phantom, auf dessen Kopf fünf Millionen Francs ausgesetzt sind.
Ihr Name ist Nancy Wake – und sie kämpft für die Liebe.
Marseille, 1940: Nancy und Henri lieben sich und genießen ihr mondänes Leben. Dann wird Frankreich von den Deutschen besetzt, und fortan riskiert Nancy ihr Leben für die Résistance. Ihre Schönheit und ihre glamouröse Erscheinung werden zur besten Tarnung der »Weißen Maus«, auf die ein Millionenkopfgeld ausgesetzt ist – denn die Nazis vermuten in ihr stets einen Mann. Schließlich wird Henri verhaftet. Nancy entkommt nach England, wo sie zur Geheimagentin ausgebildet wird. Per Fallschirm gelangt sie zurück in die Wälder der Auvergne und übernimmt das Kommando über 7.000 Partisanen. An der Seite ihrer Männer kämpft Nancy blutige Schlachten gegen die Deutschen – ihr gefangener Mann gerät indes in immer größere Gefahr.
Einmal im Monat informieren wir Sie über
Folgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Die Spionin
Roman
Aus dem Englischen
von Gabriele Weber-Jarić
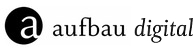
Inhaltsübersicht
Über Imogen Kealey
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Teil II
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Teil III
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Historische Anmerkungen der Autoren
Anmerkungen der Übersetzerin
Impressum
Südfrankreich/London 1943
Das war keine gute Idee gewesen. Ganz und gar keine gute Idee. Verdammt.
Nancy duckte sich und lehnte sich gegen das, was von der gesprengten Hausmauer übrig geblieben war. Für einen Moment schloss sie die Augen. Der beißende Brandgeruch drang durch ihre Nase bis in den Rachen, der Rauch brannte in ihren Augen. Sie versuchte, noch tiefer in Deckung zu gehen, und spürte, wie ihre Muskeln verkrampften. Die deutsche Patrouille war nicht mehr weit entfernt, ihre Stimmen wurden immer lauter.
»Da, auf der linken Seite!«
Die Mauer der Wohnung, hinter der Nancy sich verbarg, war am Vortag noch Teil eines Hauses gewesen – des Heims einer Familie. Sie hatte zu den schmalen alten Mietshäusern Marseilles gehört, in denen die weniger angesehenen Bürger der Stadt lebten, liebten, sich in die Haare gerieten und mit Gaunereien über Wasser hielten.
Nancy schaute sich um. Sie trug ihren zweitbesten Mantel und ihre drittbesten Pumps, und nun hockte sie in diesem Schuttloch, vor ihr Mauerreste, leere Fensteröffnungen – und nur eine Tür. Ihre Schuhe drückten. Sie ließ ihren Blick nach oben wandern und blickte in den wolkenlosen Winterhimmel.
Diese verfluchten Nazis. Überall waren sie dabei, Sprengsätze zu zünden und die Bewohner des Viertels Le Panier zu vertreiben. Andere kontrollierten, ob sich noch jemand in den zerstörten Häusern aufhielt, und sie nahmen alles unter Beschuss, was ihnen über den Weg lief.
Nancy hörte, wie sie auf ihr Schlupfloch zukamen.
Irgendwo schlugen Granaten ein, fielen Mauern berstend in sich zusammen, weiter oben am Hang wurde geschossen.
»Wir haben noch ein paar Ratten aufgestöbert«, sagte jemand, der nach einem älteren Mann klang, wahrscheinlich ein Offizier.
»Dabei wollen wir doch eine weiße Maus«, warf ein zweiter ein, und alle lachten.
Der Großteil von Nancys wohlhabenden Freunden hätte nicht einmal im Traum daran gedacht, Le Panier zu betreten, weder jetzt noch vor dem Krieg. Es war für sie das Reich der Unterwelt.
Doch als Nancy vor fünf Jahren in die Stadt kam, war sie irgendwann auch in diese Gegend geraten. Sie sah die engen, steilen Gassen, die Ganoven, Trinker und Spieler, und sie verliebte sich sofort in das Viertel. Die verblichenen Farben der heruntergekommenen Häuser, das aufbrausende Temperament der Menschen, das Zwielichtige ihrer Geschäfte, all das zog sie an. Sie hatte von jeher ein Talent besessen, sich an Orten aufzuhalten, die man besser mied. Früher als Journalistin war ihr das zugutegekommen, und hier in Marseille wusste sie, dass man ihr als Australierin Dinge nachsah, die sich eine Französin niemals hätte erlauben können.
Noch vor wenigen Tagen hatte Nancy sich in den verwinkelten Gassen wie zu Hause gefühlt. Sie teilte ihre Zigaretten mit den kleinen Ganoven, die bei krummen Touren an den Ecken Schmiere standen, und wenn sie sich mit einem der Bosse unterhielt, benutzte sie dieselbe Sprache wie er. Auch seitdem sie mit einem der reichsten Geschäftsmänner der Stadt liiert war, hatte sie nicht aufgehört, durch die übel beleumundete Gegend zu streifen. Und es hatte sich bezahlt gemacht. Denn als der Krieg begann und die Lebensmittel sogar im unbesetzten Süden Frankreichs knapp wurden, war Nancy mit der Hälfte der Schwarzmarkthändler von Marseille auf Du und Du.
»Hier unten ist alles geräumt«, hörte sie draußen jemanden sagen.
»Also weiter.«
Dann besetzten die Deutschen den Süden Frankreichs, die Illusion, von ihnen verschont zu bleiben, löste sich in Luft auf. Auch in der Altstadt von Marseille lernte man ihre Schreckensherrschaft kennen, und nun sprengten sie hier seit dem Vortag die Häuser, um all die provocateurs, die Schmuggler und Diebe zu verjagen, die Nester des Widerstands zu zerstören und Juden aufzuspüren. Und all diejenigen, die sich nicht rechtzeitig davonmachten, wurden erschossen.
Nancy hätte sich ohrfeigen können. Wie war sie bloß auf die Schnapsidee gekommen, sich hier mit ihrem Kontaktmann zu treffen? Hatte sie nicht gewusst, dass die Deutschen überall sein würden? Hatte sie vergessen, dass diese gestiefelten Mörder nach nichts begieriger Ausschau hielten als nach der Weißen Maus, einem Phantom, das als Kurier und Fluchthelfer für die Résistance agierte? Und dass es vielleicht eine wirklich schlechte Idee sein könnte, ausgerechnet hierher zu kommen, da sich dahinter niemand anders als sie selbst verbarg – Nancy Wake, einst Journalistin, heute verwöhntes Mitglied der Marseiller Oberschicht?
Sie zwang sich zur Ruhe. Das Treffen war ihr wichtig gewesen, und es hatte an diesem Tag stattfinden müssen, selbst wenn die Deutschen dabei waren, die Straßen ringsum in Schutt und Asche zu legen. Und so hatte sie auf volles Risiko gesetzt, war Patrouillen ausgewichen und hatte ihren Kontaktmann aufgespürt, diesen windigen Kerl, bei dem sie bis zuletzt nicht gewusst hatte, ob er sich an ihre Abmachung halten würde.
Doch nun steckte die Beute unter ihrem Arm, eingeschlagen in eine der verlogenen Zeitungen der Vichy-Regierung. Tausend Francs hatte der Spaß sie gekostet, aber das, was sie erstanden hatte, war ihr jeden Centime wert – vorausgesetzt, sie schaffte es lebend nach Hause.
Nancy warf einen Blick auf ihre Uhr. Verdammt, sie musste los. Sie überlegte, was sie tun würde, wenn sie auf dem Rückweg an eine deutsche Patrouille geriet, und beschloss, gegebenenfalls ihre übliche Masche abzuziehen und so zu tun, als hätte sie sich verlaufen. »Du liebe Güte, wie bin ich bloß hierher geraten?«, würde sie mit Unschuldsmiene flöten. »Ich muss vom Friseur die falsche Abzweigung genommen haben. Wie gut Sie in Ihrer Uniform aussehen. Ihre Mutter muss sehr stolz auf Sie sein.« Natürlich konnte sie nie sicher sein, damit durchzukommen, aber bisher hatte es immer geklappt. Rot geschminkte Lippen, Augenzwinkern, ein tiefer Blick – und schon schaffte man es durch eine Kontrolle, ohne dass jemand die Handtasche durchsuchte, unter deren Futter sich Ersatzteile für ein Funkgerät verbargen, oder den Körper abtastete und entdeckte, dass eine Geheimnachricht an der Innenseite ihres Schenkels befestigt war.
Aber wie sollte sie von hier fortkommen? Zwei der Deutschen hatten das, was von diesem Haus übrig war, gerade betreten. Nancy überlegte. Wenn es ihr gelänge, sie zurückzuscheuchen, könnte sie über den Hof verschwinden. Wenn nicht, müsste sie sich den Weg freischießen.
Sie holte den Revolver aus ihrer Handtasche. Zeit, lange nachzudenken, hatte sie nicht mehr. Sie reckte den Hals und spähte durch die Fensteröffnung auf die Straße. Das gegenüberliegende Haus brannte, nur der erste Stock war noch halbwegs intakt. Durch die aufgerissene Fassade konnte sie ein vollständig eingerichtetes Zimmer erkennen, bis hin zu einer Blumenvase auf dem Tisch, in der die unergründlichen Wege des Lebens eine einzelne Rose das Geschehen hatten überdauern lassen.
Nancy öffnete die Trommel ihres Revolvers, ließ die Kugeln in ihre Hand fallen und schleuderte sie über die schmale Gasse in das brennende Haus.
Draußen drehte sich ein Soldat um, er musste die Bewegung aus dem Augenwinkel wahrgenommen haben.
Nancy presste sich gegen die Mauer und zählte mit angehaltenem Atem. Eins, zwei – dann kam der Knall. Das Feuer hatte die erste Kugel erreicht. Der zweite Knall folgte umgehend.
»Feuer erwidern!«, brüllte jemand.
Die beiden Deutschen stürzten hinaus in die Gasse und schossen ins Nichts. Nancy rannte durch das, was einmal eine Hintertür gewesen war, und durchquerte den Hof. Gleich darauf hastete sie durch das Labyrinth kleiner Straßen, bis sie die Rue du Bon Pasteur erreichte, wo weit und breit keine Deutschen zu sehen waren. Erleichtert atmete sie auf und lief den Hang hinunter, eine behandschuhte Hand auf ihrem Hut. Ihr Päckchen war gerettet.
Unten angekommen, lief sie beinahe doch noch einer Patrouille in die Arme. Glücklicherweise standen die Männer mit dem Rücken zu ihr. Nancy drückte sich an die Mauer eines Hauses und bewegte sich schrittweise rückwärts.
Im Fenster des Hauses saß eine Katze, die sie beobachtete. Nancy beschwor das Tier, lautlos sitzen zu bleiben, und hoffte, es spürte nicht, dass sie eine Hundefreundin war. Hinter ihrem Rücken öffnete sich eine Gasse, so eng, dass sie sich gerade so hineinzwängen konnte, und voller Unrat.
Nancy versuchte, mit dem Mantel nicht an die schmierigen Hausmauern zu stoßen. Der Gestank hier war schlimmer als der des Fischmarkts im Hochsommer. Nur noch durch den Mund atmend warf sie einen Blick auf ihre verdreckten Pumps und hoffte, dass Claudette wusste, wie man sie reinigen konnte. Es waren teure Schuhe gewesen, an denen Nancy hing, auch wenn sie drückten. Sie hörte die Stimmen der Soldaten. Offenbar hatten sie jemanden gefasst und brüllten ihn an. Seine Erwiderungen waren kaum zu verstehen, klangen jedoch verzagt.
Zeig ihnen nicht, dass du Angst hast, befahl Nancy ihm stumm. Angst stachelt sie an.
»Auf die Knie!«
Nancy blickte zu dem schmalen Streifen blauen Himmel hinauf und betete. Zwar glaubte sie nicht an Gott, aber falls es Ihn doch gab, erhörte Er sie vielleicht. Sie fragte sich, wie viele Menschen in den umliegenden Häusern mitbekommen hatten, dass einer von ihnen in Schwierigkeiten war, und ebenfalls beteten, ohne zu wissen, ob es etwas nützte.
Ein Gewehr wurde entsichert. Man hörte das Geräusch rennender Schritte, die sich ihr näherten. Der Dummkopf versuchte zu fliehen. Der Schuss hallte von den Häusern wider. Ein Schrei ertönte, die Schritte wurden schleppend. Mit einem Stöhnen fiel der Mann aufs Kopfsteinpflaster, genau auf Höhe der Gasse. Dann lag er still, das Gesicht zu Nancy gewandt. Er schien sie anzusehen.
Mein Gott, dachte sie, wie jung er noch war, bestimmt nicht älter als achtzehn. Er hatte den leicht olivfarbenen Teint eines Jungen, der unter der Sonne Marseilles groß geworden war, hohe Wangenknochen und dunkelbraune Augen. Das kragenlose Hemd, das er trug, war das eines Arbeiters, leicht verschlissen, aber sauber. Wahrscheinlich hatte seine Mutter es für ihn gewaschen. Unter ihm breitete sich eine Blutlache aus, sickerte in die Ritzen des unebenen Pflasters. Die Lippen des Jungen bewegten sich, als wolle er ihr ein letztes Geheimnis zuflüstern.
Dann versperrten ihr die Stiefel eines deutschen Soldaten den Blick auf das Gesicht des Jungen. Nancy wich, so weit sie konnte, zurück in die Gasse. Der Soldat rief etwas über die Schulter nach hinten, das sie nicht verstand.
Er nahm sein Gewehr von der Schulter, und Nancy konnte den Jungen wieder sehen. Ihre Welt verengte sich, bestand nur noch aus einem Stück Kopfsteinpflaster und dem Gesicht eines sterbenden Jungen. Der Schuss löste sich. Blut spritzte auf. Der Körper des Jungen zuckte und sackte in sich zusammen. Der Glanz seiner Augen erlosch.
Eine heiße Welle des Zorns brandete in Nancy auf. Sie schob eine Hand in ihre Handtasche, fasste ihren Revolver und erstarrte in ohnmächtiger Wut, als sie sich an die leere Trommel erinnerte.
»Sauerei!«, sagte der Schütze und wischte Blut von seinem Uniformrock. Er war zu dicht an sein Opfer herangetreten, beim nächsten Mal würde er es vermutlich besser wissen. Sein Blick glitt über die Häuser, verharrte auf dem Fenster, in dem die Katze gesessen hatte. Nur wenige Schritte trennten ihn von Nancy. Sie überlegte, was sie tun würde, sollte er sie entdecken. Mit bloßen Händen umbringen konnte sie ihn nicht, also musste sie sich irgendwie herausreden. Sollte sie die verschüchterte kleine Frau spielen? Oder die empörte Französin, die sich als Ehefrau eines einflussreichen Manns die Belästigung verbat? Oft war Angriff die beste Verteidigung, und in ihr drängte alles danach, den Deutschen anzuschreien – auch auf die Gefahr hin, dass er dann auch sie erschoss.
Er wurde von seinen Kameraden gerufen. Nachdem er sich ein letztes Mal umgesehen hatte, wandte er sich ab und verschwand.
Nancy wartete, den Blick auf das Gesicht des Toten geheftet. Bilder zogen an ihrem inneren Auge vorüber. Hitler, wie er in Berlin eine Rede hielt. Sie stand in einer kleinen Gruppe Auslandskorrespondenten, verstand kein Wort des Gesagten, spürte nur die hysterische Begeisterung der Menge um sich herum. Sie und ihre Kollegen waren aus Paris nach Deutschland gekommen, um sich selbst einen Eindruck von diesem komischen Kauz namens Hitler zu machen. Die anderen Korrespondenten waren deutlich älter und erfahrener als Nancy, ihre Besorgnis schienen sie jedoch zu teilen.
Dann Wien. Truppen der SA schlugen die Schaufenster jüdischer Geschäfte ein, schleiften die Besitzer auf die Straße und prügelten auf sie ein. Einige der Umstehenden wandten die Gesichter ab, andere feixten und applaudierten.
Dann Polen, von den Deutschen überfallen, und die Monate des Ausharrens, die sich anschlossen, nachdem England und Frankreich Deutschland den Krieg erklärt hatten, und zunächst nichts geschehen wollte.
Die Flüchtlinge mit ihren Bündeln, die sich in Paris in ihren Wagen drängten, als die Deutschen in Frankreich einfielen und aus ihren Flugzeugen mit Maschinengewehren auf Karawanen von Frauen und Kindern schossen. Die Eroberung von Paris. Henri, der, gedemütigt von der Totalität der französischen Niederlage, mit gebrochenem Herzen von der Front heimkehrte.
Nancy ballte ihre Hände zu Fäusten. An jenem Tag in Wien hatte sie sich geschworen, die Nazis zu bekämpfen, und alles, was sie seitdem von ihnen gesehen hatte, hatte sie in ihrem Entschluss bestärkt. Der Hass auf diese Verbrecher verlieh ihr Kraft, jeder kleine Triumph gab ihr Auftrieb. Ihre Hoffnung war, dass die deutschen Truppen und ihr wahnsinniger Führer schon bald und endgültig an Russland scheitern würden.
Nancy wusste, dass sie sich vor den Deutschen und ihren französischen Handlangern fürchten und mit eingezogenem Kopf auf das Ende der Besatzung warten sollte, aber dazu war sie nicht in der Lage. Geduld und den Kopf einziehen waren ihr nicht gegeben.
Ihr Blick fiel auf den Toten in der Gasse, in dessen Augen alles Licht erloschen war. Wieder ein Bild, das sie fortan begleiten würde.
Nancy trat an ihm vorbei und schaute über die Straße. Die Deutschen waren verschwunden. Sie lief zu dem kleinen Platz mit dem Brunnen, wo sie ihr Fahrrad abgestellt hatte, legte ihr Päckchen in den Korb an der Lenkstange und fuhr los.
Auf der Uferpromenade, hinter der sich das in der Sonne glitzernde Mittelmeer bis zum Horizont erstreckte, stieg Nancy vom Rad. Sie musste sich ihren Kauf noch einmal ansehen. Mit einem sorgfältig manikürten Fingernagel ritzte sie das Zeitungspapier auf und enthüllte eine Flasche Krug, Jahrgang 1928. Der Champagner, den Henri an ihrem ersten Abend in Cannes bestellt hatte. Liebevoll ließ sie ihren Blick auf dem Etikett ruhen. Dann zupfte sie das Einschlagpapier wieder zurecht und fuhr weiter zu dem Viertel, wo sie und Henri seit Kriegsbeginn wohnten. Und das Bild des sterbenden jungen Mannes verblasste.
Nancy hob ihr Gesicht in die Sonne und spürte den Wind, der vom Meer her wehte. Sie war die Weiße Maus, auf deren Kopf, tot oder lebendig, die Deutschen fünf Millionen Francs ausgesetzt hatten, und in ihrem Fahrradkorb lag eine Flasche des besten Champagners, den es auf dem Schwarzmarkt gab. Irgendetwas schien sie also richtig zu machen. Darauf würde sie an diesem Abend trinken, aber vorher musste sie sich noch zurechtmachen und ihr Brautkleid anziehen.
Henri Fiocca stand am Fenster seines Ankleidezimmers und sah seine künftige Ehefrau den Weg durch den Garten zum Haus heraufkommen. Wie immer machte sein Herz einen freudigen Satz. Dann befiel ihn die übliche Mischung aus Liebe, Furcht und Ärger. Musste sie sogar am Tag ihrer Hochzeit unterwegs sein? Wahrscheinlich hatte sie wieder einen Kurierdienst übernommen, hatte gefälschte Papiere und Geld zu jemandem in Toulouse oder Cannes gebracht, der Frankreich schleunigst verlassen musste, oder Nachrichten an eine der Widerstandszellen in Marseille weitergegeben. Ständig riskierte sie ihr Leben, um Menschen zu helfen, die sie nicht einmal kannte. Es machte ihn wahnsinnig. Alles bei der Résistance war improvisiert, ständig kamen neue Mitglieder hinzu, von denen man nicht wusste, ob man ihnen trauen konnte, und wem konnte man in diesen Tagen überhaupt noch trauen? Henri liebte sein Heimatland, und die Deutschen hasste er mit der gleichen Inbrunst, wie Nancy es tat. Er unterstützte die Widerstandskämpfer mit seinem Vermögen, lud sie an seine Tafel, aber musste er auch die Frau, die er liebte, opfern? Nancy mochte keine Furcht kennen, doch Henris Liebe zu ihr hatte ihn nur allzu gut gelehrt, was es bedeutete, sich zu fürchten. Nicht um sich selbst, sondern um den Menschen, den man liebte.
Er sah, wie Nancy unten im Haus verschwand, legte eine Hand auf die Fensterscheibe und flüsterte ihren Namen. Auf den ersten Blick hatte er sich in sie verliebt, es hatte sich angefühlt, wie von einer gewaltigen Flutwelle gepackt und mitgerissen zu werden.
Wie oft hatte er sich seitdem gefragt, warum sie sich für ihn entschieden hatte, immerhin war er um einiges älter als sie. Sicher, er war reich, aber im Vergleich zu ihrem war sein Leben nichts als langweilig. Doch der Altersunterschied schien für sie keine Rolle zu spielen. Und aus seinem Geld machte sie sich nichts. Zwar gab sie es gern aus, jedoch mit dem unschuldigen Vergnügen eines Kindes.
Inzwischen wusste er, dass seine Frau eine unglückliche Kindheit erlebt und Australien mit sechzehn Jahren verlassen hatte. Um die halbe Welt war sie gereist, um den Erinnerungen an diese Jahre zu entfliehen und sich von niemandem mehr etwas sagen zu lassen. Doch selbst ein so unabhängiger Mensch wie Nancy brauchte ab und zu jemanden zum Anlehnen, wie Henri inzwischen erkannt hatte, und er war dankbar, dass er derjenige sein durfte.
Und ab diesem Abend würde sie offiziell seine Frau sein. Zwar würde sie weiterhin sein Geld für andere ausgeben und ihr Leben für die Résistance riskieren, doch wenigstens an diesem Abend gehörte sie nur ihm.
»Ich muss mich doch sehr wundern«, ertönte eine nasale Stimme in Henris Rücken. »Zumindest am Tag ihrer Hochzeit hätte ich erwartet, dass Nancy pünktlich ist. Vielleicht sollte ich sie fragen, ob sie überhaupt heiraten will, wenn sie noch nicht einmal rechtzeitig zu ihrem Friseurtermin erscheint.«
Henri wandte sich um. Wie ein Vogel hockte seine Schwester auf der Bettkante und sah ihn mit verkniffener Miene an. Henri seufzte. Trotz ihrer dünnen Lippen und des knochigen Gesichts war Gabrielle einmal ein hübsches Mädchen gewesen, doch mit den Jahren war sie verbittert, was sie hässlich hatte werden lassen. Offenbar startete sie gerade einen letzten Versuch, ihm die Heirat auszureden.
»Nancy wird dir kaum zuhören, Gabrielle«, antwortete er. »Oder dir in unmissverständlichen Worten ihre Meinung sagen.«
Seine Schwester rümpfte die Nase. »Natürlich, sie kann fluchen wie ein Seemann in der letzten Stunde seines Landgangs. Ich frage mich, woher sie ihre grässliche Ausdrucksweise hat.«
Henri lächelte in sich hinein. Nancy zuzuhören, wenn sie auf Französisch so richtig loslegte, bereitete ihm eine diebische Freude.
»Sie ist eben sehr begabt, was Sprachen angeht.«
»Vor allem die der Gosse.« Seine Schwester lachte höhnisch auf. »Eine Frau ohne Mitgift, die sich überdies weigert, katholisch zu werden. Glaubt sie überhaupt an Gott?«
»Das bezweifle ich.«
»Wie kannst du diese Frau heiraten?« Gabrielles Stimme war schrill geworden. »Eine kleine australische Hure, die unserer ganzen Familie Schande macht.«
Henri spürte die Zornesröte, die sich auf seinem Gesicht ausbreitete. »Sprich noch einmal so über meine Frau, und du wirst dieses Haus niemals mehr betreten, Gabrielle. Selbst wenn ich mein ganzes Geld, mein Unternehmen und meine liebe Familie hergeben müsste, um nur eine Stunde in Nancys Gesellschaft verbringen zu dürfen – ich würde es tun.« Er deutete auf die Tür. »Und nun verschwinde.«
Seine Schwester erhob sich mit gekränkter Miene. »Ich denke dabei nur an dich und dein Wohlergehen«, antwortete sie im Hinausgehen.
Gott sei Dank wusste sie nichts von Nancys geheimen Aktivitäten, sagte sich Henri. In ihrem Hass würde Gabrielle vermutlich auf geradem Weg zur Gestapo laufen, Nancy mit Genuss denunzieren und händereibend das Kopfgeld kassieren.
Henri trat an den Spiegel, prüfte den Sitz seines Smokinghemds und strich sein Haar glatt. Seit er mit Nancy zusammen war, wunderten seine Freunde sich über sein jugendliches Aussehen. Es waren Männer, die seit Langem verheiratet waren, und er wollte ihnen lieber nicht zu nahetreten und erklären, dass es seine ungestüme junge Freundin war, die ihm Schwung verlieh. Überhaupt sprach er vor anderen nur ungern über sein Glück mit ihr. Es passte nicht in diese Zeit, in der sein Land so restlos aufgegeben hatte. Die Schlacht von Dünkirchen war verloren, die britischen Soldaten waren geflohen, und ein Großteil der im Hafen von Mers-el-Kébir liegenden französischen Flotte war außer Gefecht gesetzt, über tausend französische Männer waren getötet worden – auf Befehl von niemandem anders als Winston Churchill, der die Schiffe lieber zerstören lassen wollte, als sie in den Händen des Vichy-Régimes zu wissen. Seitdem hatte die überwiegende Zahl der Franzosen resigniert, und die Deutschen führten sich auf, als gehöre Frankreich ihnen. Wahrscheinlich hätte auch er alle Hoffnung begraben, doch davon wollte Nancy nichts wissen. Sie schwor, dass das wahre Frankreich wieder auferstehen werde. Und er glaubte ihr. Was würde er nur ohne sie anfangen?
Henris Gedanken wanderten zu Nancys Schwarzmarktfreunden. Ihnen verdankten sie Lebensmittel, von denen andere nur noch träumen konnten. Seit Monaten bewirteten sie in ihrem Haus unentwegt Gäste, die nicht über das nötige Geld oder einschlägige Beziehungen verfügten. Er versuchte, sich an ein Mahl zu erinnern, das er mit Nancy allein eingenommen hatte, ihm fiel keines ein.
Als an die Tür geklopft wurde, befürchtete er, dass seine Schwester zurückgekommen war, und rief mürrisch: »Was ist?«
Leise wie eine Katze schlüpfte Nancy durch die Tür, und wie immer berauschte ihr Anblick Henri. Nancy konnte noch nicht lange im Haus sein, trotzdem hatte sie es geschafft, ihr Haar in Locken legen und über ihrem herzförmigen Gesicht hochstecken zu lassen, ihr Gesicht zu pudern, die Lippen kirschrot zu schminken und ein elegantes blaues Seidenkleid anzuziehen, das ihre wundervollen Rundungen zur Geltung brachte.
»Wirst du mich ab jetzt immer so unfreundlich in dein Ankleidezimmer bitten?«, fragte sie.
Er trat auf sie zu und streckte die Arme aus.
Nancy machte einen Schritt zurück. »Nicht anfassen, du Wüstling. Meinetwegen können wir jetzt heiraten. Oder hat es deine Schwester doch noch geschafft, dir die Hochzeit auszureden? Ich bin ihr unten im Haus begegnet, und ihre Laune war nicht die beste.«
Henri legte die Hände auf Nancys Hüften und spürte, wie der zarte Stoff über ihre weiche Haut glitt.
»Musstest du dich auch heute in Gefahr begeben?«
»Ich bin doch wieder da.« Nancy streichelte seine Wange. »Nicht böse sein, du alter Brummbär. Es ging um etwas, das mir wichtig war.«
Aber so einfach ließ Henri sich nicht beschwichtigen. »Hast du die Aushänge nicht gesehen? Fünf Millionen Francs sind seit Neuestem auf den Kopf der Weißen Maus ausgesetzt. Ich vermute, den Deutschen hat es nicht gepasst, dass du die Gefangenen aus ihrem Lager in Puget befreit hast.«
»Das war es wert.« Mit sanftem Griff schob Nancy seine Hände fort, bevor er den edlen Stoff ihres Kleides ruinieren konnte. »Die Männer, die wir befreit haben, werden uns in Zukunft hilfreich sein.« Sie krauste die Stirn. »Nur der englische Pilot war ein Idiot. Beschwert sich über das Essen und darüber, dass es in unserem sicheren Haus nicht komfortabel genug sei. Als hätten wir für diesen Mistkerl nicht unser Leben riskiert.«
Henri erinnerte sich an die Frauen, mit denen seine Schwester ihn hatte verheiraten wollen – schöne, elegante und fügsame Französinnen, die gewiss immer an seiner Seite geblieben wären und ihm jeden Wunsch von den Augen abgelesen hätten. Doch im Vergleich zu Nancy verblasste jede von ihnen. Nancys Leidenschaft, ihr loses Mundwerk, ihre Weigerung, sich von irgendetwas einschüchtern zu lassen, und stete Bereitschaft, es mit der ganzen Welt aufzunehmen, wenn es sein musste – all das verwirrte ihm die Sinne. Lächelnd betrachtete er die junge Frau im blauen Kleid, die ihn mit festem Blick ansah.
»Du bist keine weiße Maus«, sagte er. »Du bist eine Löwin.« Er griff nach seiner Smokingjacke. »Sollen wir heiraten gehen?«
Nancy zupfte seine Fliege zurecht, und er roch den zarten Chanel-Duft, der von ihr ausging. »Ich bitte darum, Monsieur Fiocca.«
* * *
Die Hochzeitsfeier im Grand Hôtel war ein Riesenerfolg, an dem auch die säuerlichen Mienen von Henris Familie nichts ändern konnten. Und falls es unter den Gästen noch jemanden gab, der sich fragte, wie die frischgebackene Madame Fiocca es geschafft hatte, in diese Welt des Luxus zu geraten, behielt er es für sich und überließ sich dem Vergnügen.
Nancy war glücklich. Ihre Hochzeitsfeier war das Stadtgespräch und Henri stolz auf sie. Demnach hatte sich jede Minute, die sie mit ihrer Schneiderin, dem Hotelkoch und der Floristin debattiert hatte, gelohnt. Sie ließ ihren Blick über die verschwenderische Pracht des Ballsaals wandern, an dessen Stirnseite die Hochzeitstafel aufgebaut war, und griff unter dem Tisch nach der Hand ihres Manns. Er unterhielt sich mit einem der Geschäftsführer seiner Fabrik und saß halb von ihr abgewandt, doch er drückte ihre Hand und rieb mit dem Daumen über ihren Handteller. Nancy überlief ein wohliger Schauder.
»Nancy«, murmelte jemand. Nancy drehte sich um. Bernard, der Direktor des Hotels und einer ihrer engsten Freunde, bedachte sie mit einem vielsagenden Blick, bevor er zurücktrat.
Ein Kellner rollte einen Ständer mit einem Champagnerkühler heran, ein zweiter stellte frische Gläser vor Nancy und Henri. Bernard hob die Flasche Krug aus dem Eis und zeigte dem Brautpaar das Etikett. Nancy nickte. Unter Bernards geübten Griffen löste sich der Korken mit einem Seufzer.
Henri sah zu, wie Bernard den Champagner einschenkte. Dann neigte er sich zu seiner Frau hinüber und flüsterte: »Wo um alles in der Welt hast du einen Krug aufgetrieben?«
Nancy zwinkerte ihm zu. »Deshalb musste ich heute fort.«
Henri betrachtete sie kopfschüttelnd.
Nancy stand auf und klopfte mit einer Gabel an ihr Champagnerglas. Es war alles andere als üblich, dass die Braut sich erhob, um einen Toast auszusprechen, weshalb Henris griesgrämige Schwester und sein ebenso übellaunig aussehender Vater sich augenblicklich versteiften.
Doch Nancy interessierte sich nicht die Bohne für Benimmregeln. »Alle mal herhören!«, rief sie. Dann drehte sie sich zu dem kleinen Orchester um. »Ruhe jetzt!«
Die Musik brach ab. Die letzten Gespräche verstummten. Hier und da war noch ein unterdrücktes Kichern zu vernehmen.
Nancy hob ihr Glas. »Liebe Hochzeitsgäste, ich danke euch, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Mein Vater kann heute leider nicht bei uns sein, doch er wünscht Henri und mir aus der Ferne alles Gute.«
Nancys Vater lebte in Sydney, dass er ihnen von dort alles Gute wünschte, war eher fraglich. Als Nancy ihn das letzte Mal gesehen hatte, war sie fünf Jahre alt gewesen.
»Meine Mutter haben wir nicht eingeladen. Wenn ihr sie kennen würdet, wüsstet ihr, dass ihr mir dafür dankbar sein müsst.« Für einen Moment sah Nancy die ärmliche Wohnung ihrer Kindheit vor sich und das verkniffene Gesicht ihrer Mutter. Mit der Bibel in der einen und dem Knüppel in der anderen Hand hatte sie Nancy großgezogen. »Ich bin also die Einzige meiner Familie, die nun ein paar angemessene Worte sprechen kann.« Sie wandte sich zu ihrem Mann um. »Auf dich, Henri – « Sie wartete, bis der Beifall verklungen war. »Mit einem achtundzwanziger Krug stoße ich auf den Mann an, der diesen Champagner an unserem ersten Abend mit mir getrunken hat. Damals war Frankreich noch ein freies Land. Doch auch wenn wir jetzt Krieg haben und die Nazis durch unsere Straßen marschieren, möchte ich euch daran erinnern, dass Frankreich frei bleiben wird, solange wir in unseren Herzen frei sind.« Sie legte eine Hand auf Henris Schulter. »Geliebter Henri, ich weiß, dass ich eine kostspielige, schwierige und nervtötende Ehefrau sein werde, aber du bist mein Fels in der Brandung, und gemeinsam werden wir ein Leben führen, das sich dieses Champagners als würdig erweist.«
Henri stand auf und stieß mit ihr an. Als sich ihre Blicke trafen, versank die Welt für sie.
»Auf dich, Madame Fiocca«, sagte Henri leise.
Einige Gäste seufzten.
Nancy spürte, dass Tränen in ihren Augen brannten. Sie zwinkerte sie fort. An diesem Abend wollte sie nur fröhlich sein.
»Ich pfeife auf die guten Sitten«, flüsterte sie und trank ihr Glas in großen Zügen leer. Dann leckte sie sich über die Lippen und schenkte ihren Gästen ein breites, unwiderstehliches Lächeln.
Applaus und Beifallsrufe wurden laut. Das Orchester stimmte eine schmissige Version von »When The Saints Go Marching In« an. Die Kellner trugen die Reste des Hochzeitsmahls ab und schoben die Tafel zur Seite, um die Tanzfläche zu vergrößern. Einige von Nancys halbseidenen Freunden versuchten, mit betrunkenen Gesten zu helfen.
Henri schloss Nancy in die Arme und küsste sie. Aus dem Augenwinkel nahm Nancy die versteinerte Miene seiner Schwester wahr. Daraufhin presste sie sich an Henri und erwiderte seinen Kuss hemmungslos.
Wegen des Hochzeitstrubels dauerte es eine Weile, bis Nancy eine Gelegenheit fand, ihren Freunden Philippe und Antoine von dem Zwischenfall in der Altstadt zu berichten.
Antoine, schlank und drahtig, zählte zu den erfahrensten Fluchthelfern Südfrankreichs. Neben Nancy arbeitete er mit einem Schotten namens Garrow, dem sie noch nie begegnet war, und einem berühmt-berüchtigten belgischen Widerstandskämpfer, der Pat O’Leary genannt wurde. Sie brachten Flüchtlinge in sichere Häuser und organisierten Führer, die sie über die Pyrenäen ins halbwegs sichere Spanien schafften.
Philippe war ein kleiner gedrungener Mann mit gebräuntem, kantigem Gesicht, der selbst in Abendgarderobe aussah, als käme er gerade von der Feldarbeit. Er war ein begnadeter Fälscher, in dessen Kellerwerkstatt täglich täuschend echte Pässe, Aufenthalts- und Reisegenehmigungen ausgestellt wurden. Mit Philippes Dokumenten schaffte man es per Bahn oder Bus zu verschwiegenen Orten auf dem Land und von dort aus weiter nach Spanien und Portugal oder von einem sicheren Haus zum anderen und schließlich über den Ärmelkanal nach England.
»Sie haben ihn einfach abgeknallt«, sagte Nancy. »Mitten auf der Straße. Einen Grund scheinen sie nicht mehr zu brauchen.« In Gedanken hörte sie wieder den Schuss, sah das Blut spritzen, und nahm hastig einen Schluck Champagner.
Als hinter ihnen ein Champagnerkorken knallte, fuhr Antoine herum und griff nach der Waffe in seiner Jackentasche – dann grinste er verlegen und zuckte mit den Schultern.
Keiner der beiden äußerte sich zu dem, was Nancy erzählt hatte. Sie waren zu erschöpft, hatten zu viel gesehen, um von einem weiteren Toten betroffen zu sein, ging es Nancy durch den Sinn. Doch für sie würde ein Mord nie zu etwas Alltäglichem werden.
Ein Kellner füllte ihr Glas wieder auf. Sie hörte den Champagner aufschäumen und sah den toten Jungen in der Gasse liegen. Die grauen Pflastersteine, das rote Blut und darüber den blauen Himmel. Nichts davon würde sie jemals vergessen.
»Ich mache mir Sorgen«, sagte Antoine. »Es gab zuletzt immer mehr Kontrollen, auch in den Pyrenäen. Im letzten Monat mussten wir drei Mal umkehren und die Leute zurückführen. Vielleicht sollten wir erst mal abtauchen. Es langsamer angehen lassen oder unsere Aktivitäten eine Zeit lang einstellen. Einer von uns muss geredet haben. Oder nachlässig geworden sein.«
»Mich brauchst du dabei nicht anzusehen«, entgegnete Nancy. »Ich werde noch nicht einmal verraten, woher das Fleisch kommt, das wir unseren Gästen servieren.« Sie blickte Antoine über den Rand ihres Champagnerglases hinweg an. »Ich bin der Inbegriff der Diskretion.«
Philippe hielt sein Champagnerglas in der Faust und nahm einen Schluck. »Antoine hat recht. Es ist ein neuer Agentenjäger für die Gestapo nach Marseille gekommen. Ein Mann namens Böhm. Er hat nur ein paar Wochen gebraucht, um unser Netzwerk in Paris zu zerschlagen, was unser bestes war. Kaum jemand ist ihm entkommen. Vorher war er irgendwo in Osteuropa, aber jetzt ist er der Weißen Maus auf der Spur, Nancy. Er ist deinetwegen hier. Wir müssen vorsichtig sein.«
Vorsichtig, dachte Nancy. Jeder wollte, dass sie vorsichtig war. Vielleicht sollte sie auch noch höflich und sittsam werden, beim Sitzen Knie und Knöchel geschlossen halten und den Blick gesenkt. Da konnten sie lange warten.
»Ihr übertreibt«, sagte sie. »Ich bin eine Frau mit teurem Geschmack und reichem Ehemann. Niemand, der mich durch die Gegend flanieren sieht, kommt auf die Idee, dass ich die Weiße Maus sein könnte. Auch der neue Agentenjäger wird das nicht denken.«
»Nimm das nicht auf die leichte Schulter«, erwiderte Antoine. »Was wir tun, ist kein Spiel. Vielleicht fällt auf dich kein Verdacht, aber was ist mit den Menschen in deiner Umgebung? Glaubst du, es wird nie jemand dahinterkommen, dass Henri uns mit Geld versorgt?«
Für einen Moment geriet Nancy aus dem Tritt. Doch dann sagte sie sich, dass Henri ein erwachsener Mann war, der wusste, was er tat. Aber auch er riet ihr stets zur Vorsicht, sie war diejenige, die ihn immer wieder drängte, Risiken einzugehen.
»Wenn dir jemand Angst machen will, gib ihm eins aufs Maul«, sagte Nancy mit einem gefährlichen Funkeln in den Augen. »Das habe ich schon als Kind gelernt.« Dann spürte sie eine Hand auf der Schulter und wandte sich um. Hinter ihr stand Henri, der trotz der Unmengen an Champagner, die sie getrunken hatten, noch immer einen tadellosen Eindruck machte. Die anderen Männer im Raum hatten längst gerötete Gesichter und wirkten mitgenommen. Liebevoll betrachtete Nancy ihren eleganten Ehemann.
»Nancy«, sagte er mit leisem Vorwurf in der Stimme. »Hattest du mir nicht versprochen, dich heute Abend nicht um diese Dinge zu kümmern?«
Antoine und Philippe sahen ihn betreten an. »Wir haben Ihre Frau nur gebeten, vorsichtig zu sein«, antwortete Antoine.
Henri lachte. »Hoffentlich haben Sie damit mehr Glück als ich.« Er reichte Nancy seinen Arm. »Darf ich um den nächsten Tanz bitten, Madame?«
Nancy nickte ihren beiden Freunden zu und ließ sich von ihrem Mann zur Tanzfläche führen. Sie liebte Henri über alles, doch in ihrem Kampf gegen die Nazis würde sie niemals nachlassen, das wusste sie ohne jeden Zweifel, und auf die Vorsicht würde sie auch künftig pfeifen.
Die Tänzer traten zurück und überließen dem Brautpaar die Tanzfläche für den Hochzeitswalzer. Henri war ein großartiger Tänzer, Nancy musste nichts anderes tun, als sich von ihm über das glänzende Parkett führen zu lassen. Sie lehnte sich in seinem Arm zurück und hatte das Gefühl zu schweben. Dann traf sie auf Henris ernsten Blick und krauste die Stirn.
»Willst du etwa mit mir schimpfen?«
»Richtig.« Henris Griff um ihre Hand verstärkte sich. »Musstest du zu unserer Hochzeit Widerstandskämpfer einladen? Und dein Leben für eine Flasche Krug aufs Spiel setzen?«
Nancy studierte seine Miene. Noch las sie darin etwas Spielerisches, noch war er der weise Ehemann, der den Kopf über seine törichte junge Frau schüttelte.
»Antoine und Philippe sind meine Freunde, Henri, und den Krug habe ich besorgt, um dir eine Freude zu machen.«
»Ich brauche keinen Champagner, Nancy.« Das Spielerische war verschwunden. »Ich brauche dich.« Er drückte sie an sich.
Draußen war ein Zischen zu hören, dann folgte das Krachen einer Granate, die nicht weit entfernt einschlug. Die Kronleuchter an der Decke des Ballsaals schaukelten, an einer Stelle rieselte Putz herab.
»Mehr Champagner für unsere Freunde, Bernard.« Henri reckte eine Faust in die Luft. »Vive la France!«
Die Hochzeitsgäste atmeten auf, Hochrufe wurden laut. Das Orchester stimmte einen übermütigen Song an, und die Tanzfläche füllte sich wieder. Nancy legte den Kopf in den Nacken, lachte ausgelassen und ließ sich von Henri herumwirbeln.
* * *
Obwohl Henri stundenlang getanzt hatte, ließ er nicht mit sich reden und bestand darauf, Nancy über die Schwelle ihres Schlafzimmers zu tragen und ihre Füße sanft auf dem weichen Teppich abzusetzen.
Nancy legte eine Hand auf seine Brust. »Es gibt etwas, bei dem ich deine Hilfe brauche. Etwas sehr Wichtiges.«
Henri runzelte die Stirn. Seine Frau hatte wirklich ein unglaubliches Gespür für den passenden Moment. Was würde sie diesmal erbitten? Mehr Geld? Sollte er ihr Haus in den Bergen Flüchtlingen zur Verfügung stellen? Sollten mithilfe seines Unternehmens noch mehr Waffen geschmuggelt, sollte noch mehr Menschen zur Flucht verholfen werden?
Nancy sah förmlich, wie sich in Henris Kopf die Rädchen drehten. Mit einer lasziven Bewegung kehrte sie ihm den Rücken zu. »Könntest du bitte meinen Reißverschluss aufziehen?«
Mit leisem Lachen öffnete Henri den feinen Haken des Kleids in Nancys Nacken. Langsam zog er den Reißverschluss auf, fuhr mit dem Fingerknöchel über ihren Rücken, küsste ihren Nacken.
Nancy lehnte sich an ihn. »Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich bin, wie ich bin. Du wusstest, wen du heiratest.«
»Das würde ich auch nie verlangen«, antwortete Henri, die Stimme heiser vor Lust. Er legte die Arme um Nancys Taille und zog sie an sich.
Nancy spürte das Ziehen der Begierde in ihrem Unterleib.
»Es tut mir leid, Henri, aber selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht wie andere Frauen werden. Ich möchte dir nicht wehtun, aber ich kann nicht zulassen, dass diese deutschen Bastarde gewinnen. Das darf einfach nicht geschehen.«
Henri seufzte und drehte sie zu sich um. »Versprich mir nur, vorsichtig zu sein.« Er strich über Nancys Wange. »Wirst du das für mich tun?«
Nancy nickte und schmiegte ihre Wange in seine Hand.
Er führte sie zu dem kleinen Zweiersofa am Fenster und ließ sich darauf nieder.
Nancy raffte ihren Rock und setzte sich rittlings auf ihn. Dann öffnete sie die mit Brillanten besetzte Spange in ihrem Nacken, schüttelte ihr Haar aus und streifte das Oberteil des Kleids von ihren Schultern.
»Verdammt, Henri Fiocca, ich liebe dich.«
Er vergrub seine Hände in ihrem Haar, zog sie zu sich und küsste sie hingebungsvoll.
Major Markus Friedrich Böhm legte den Telefonhörer auf und lächelte zufrieden. Die Altstadt von Marseille war erfolgreich geräumt worden, der abschließende Bericht würde am Morgen in der Rue Paradis, dem Hauptsitz der Gestapo, auf ihn warten.
Die Altstadt war ein Rattennest gewesen, vor seiner Ankunft hatten sie dort jeden Tag Männer verloren. Folgte man einem Verdächtigen in das Gewirr der kleinen Gassen, kehrte man mit leeren Händen zurück – sofern man es überhaupt hinausschaffte. Mit Fäkalien waren sie beworfen und von den Einheimischen ausgelacht worden. Er hatte die Berichte gelesen, sich die Beschwerden seiner Männer und die Entschuldigungen der französischen Behörden angehört. Dann hatte er den Befehl zur Räumung gegeben.
Auf Anschlägen hatten sie die Bewohner der Altstadt aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Hälfte hatte ihre Habseligkeiten zusammengerafft und war verschwunden. Den Rest hatten sie festgenommen und in die Arbeitslager geschafft. Diejenigen, die versucht hatten zu fliehen, waren erschossen worden. Böhm erinnerte sich an die hohe Anzahl Juden, die sie bei dieser Aktion entdeckt hatten, ein weiterer Beweis für die Nachlässigkeit, mit der die Franzosen die Rassengesetze auslegten. Plötzlich kam ihm Herkules in den Sinn, der die Aufgabe gehabt hatte, die Rinderställe des Augias auszumisten. Böhm wusste nicht, wie lange der griechische Held dazu gebraucht hatte, ihm jedoch war die Säuberung in drei Tagen gelungen.
Leise stand er auf und öffnete die Tür zum Zimmer seiner Tochter. Das Telefonat hatte sie nicht geweckt, Sonja schlief mit rosigen Wangen und ihrem Kuscheltier im Arm. Böhm betrachtete sie liebevoll und fragte sich, ob sie gerade träumte. Sie wirkte so konzentriert. Genauso sah sie aus, wenn sie am Esstisch saß und mit großen ungelenken Buchstaben kleine Briefe an ihre Freundinnen in Berlin schrieb. Böhm küsste seine Tochter sanft auf die Stirn.
Leise zog er sich zurück und durchquerte sein Arbeitszimmer zum Salon. An der Wohnung, die man ihnen in Marseille zur Verfügung gestellt hatte, war nichts auszusetzen. Sie lag nicht weit von der Rue Paradis entfernt, bestand aus fünf großen, geschmackvoll eingerichteten Zimmern – eine Wohltat nach dem, was man ihm in Polen zugemutet hatte. Doch diese Belohnung stand ihm zu. Schließlich hatte er in Polen die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei auf Vordermann gebracht und in Paris anschließend ein großes Agentennetzwerk zerschlagen. Gut, die Kontakte seiner Frau bis in die höchsten Parteispitzen dürften ihm auch nicht geschadet haben.
Eva saß im Salon am Kamin mit einer Stickarbeit in den Händen, eine zarte Person, beinah kindlich wirkend. Sie stand auf und schenkte ihm ein Glas Cognac ein. Böhm ließ sich in dem Sessel an ihrer Seite nieder.
»Heller war am Telefon und hat sich für den späten Anruf entschuldigt. Er hofft, dass er uns nicht gestört hat.«
Sie reichte ihm den Cognac. »Er scheint ein wohlerzogener Mensch zu sein.«
Ihre Stimme war das Erste gewesen, in das Böhm sich verliebt hatte. Sie war klangvoll und fest, ohne jemals laut zu werden. Er griff nach Evas Hand und küsste ihre Fingerspitzen.
»Du wirkst gut aufgelegt.« Sie widmete sich wieder ihrer Stickerei. »Gibt es dazu einen Grund?«
»Ich danke der Vorsehung für die Hilfe, die mir zuteilwird, weiter nichts.« Böhm nahm einen Schluck Cognac. Den Geschmack an Hochprozentigem hatte er während seines Studiums in Cambridge gefunden. Beinahe mit Wehmut dachte er an die vom Alkohol befeuerten, nächtlichen Diskussionen im Kreis gebildeter Menschen zurück.
»Meinst du mich oder Heller?« Seine Frau sah ihn von unten herauf an.
»Diesmal meine ich dich.« Er prostete ihr zu.
Sie lächelte. Dann wurde sie wieder ernst. »Aber als dein Stellvertreter ist Heller nicht schlecht, oder?«
Böhm ließ sich die Frage durch den Kopf gehen. Er sah den jungen Mann vor sich, die runde Nickelbrille auf dem glatten Gesicht. Er hatte ihn erst in Marseille kennengelernt, doch bisher hatte Heller einen äußerst fähigen Eindruck gemacht. Soweit Böhm wusste, hatte Heller in Grenoble Jura studiert und sprach fließend Französisch. Dennoch war er der deutschen Sache treu ergeben. Ein unnachgiebiger Verhörspezialist war er ebenfalls, was man ihm auf den ersten Blick gar nicht zutraute. Doch hinter dem harmlosen Äußeren verbarg sich ein Quell der Gewalt. Die Nickelbrille und das jungenhafte Gesicht hatten mehr als einen Gefangenen getäuscht.
»Heller ist ein ausgezeichneter Stellvertreter«, antwortete er schließlich.
Eva schnitt einen Faden ab und schüttelte die Decke aus, an der sie gestickt hatte. Das Motiv stellte eine ländliche Idylle dar, mit einem kleinen Bauernhof, Hühnern und Bäumen vor einem grünen Hang. Es erinnerte Böhm an seine schwäbische Heimat.