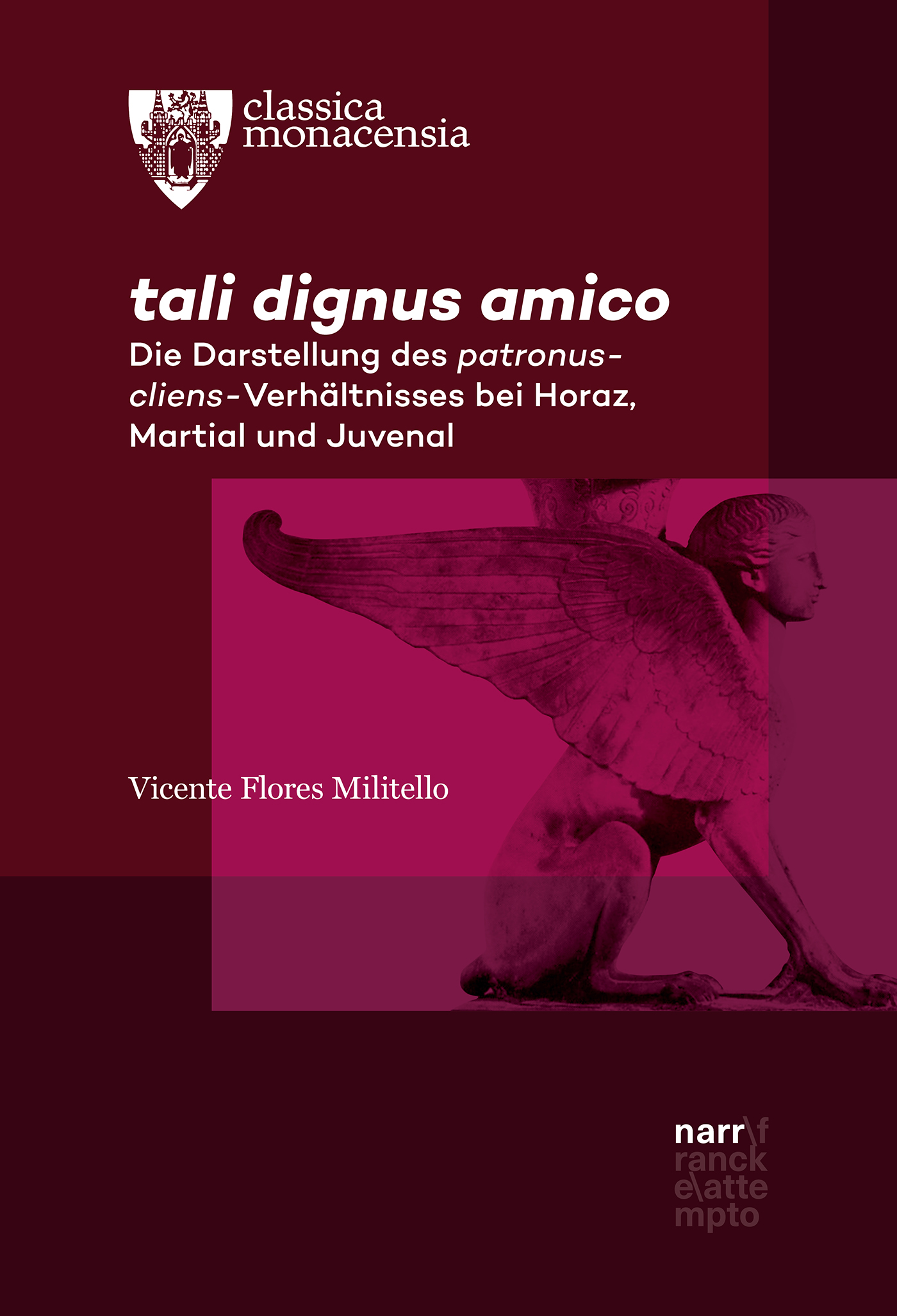
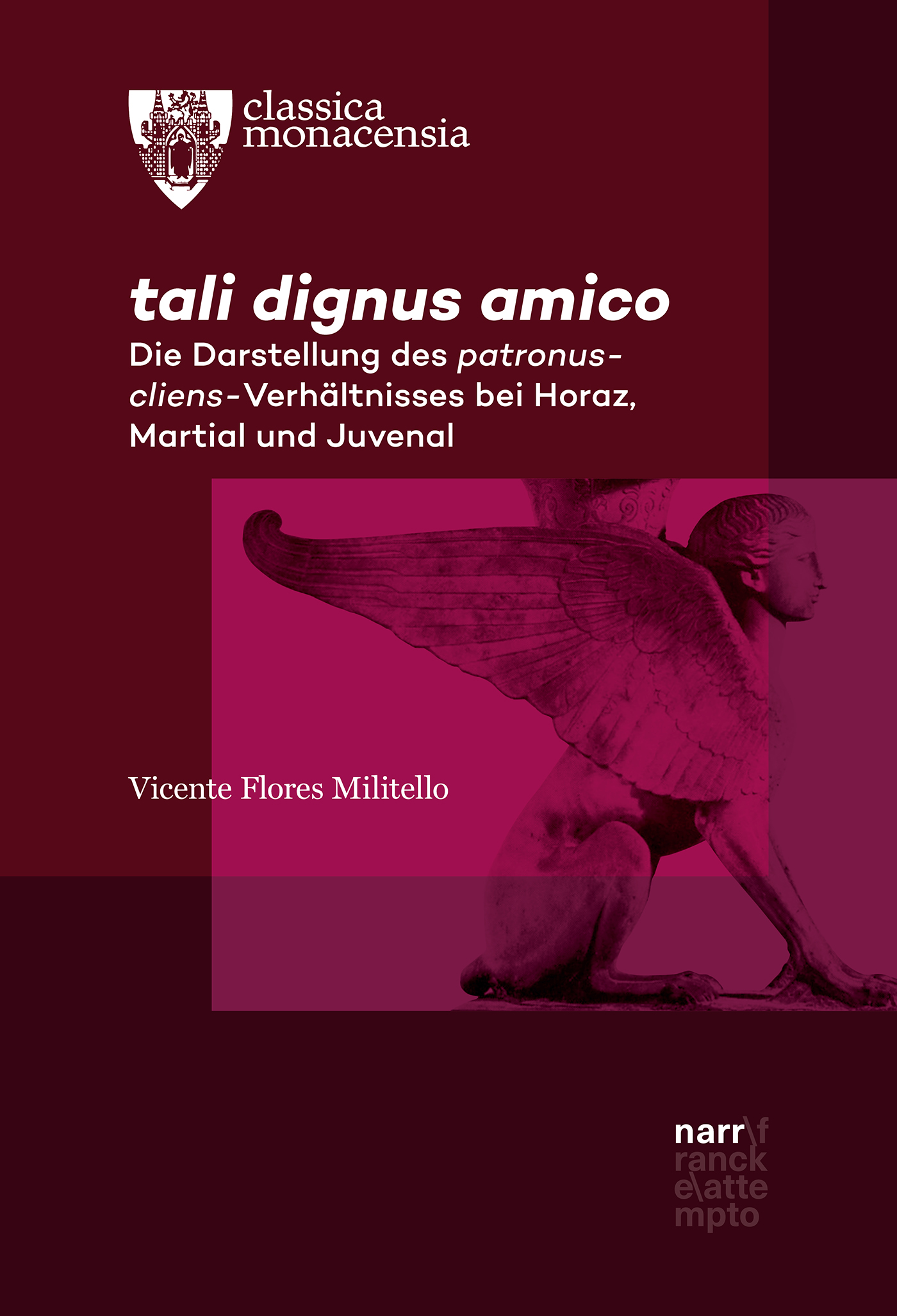
Vicente Flores Militello
tali dignus amico
Die Darstellung des patronus-cliens-Verhältnisses bei Horaz, Martial und Juvenal
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
Für das Korrekturlesen des Manuskripts möchte ich mich auch herzlich bei Dr. Anna Thomas, Maximilian Hauer, Björn Sigurjónsson und Raphael Steinbacher bedanken.
Dass die Figur des Dichter-Klienten und diejenige des üblichen Klienten unter denselben Aspekten betrachtet werden dürfen, ist seit White 1978, 76–78; 92 überzeugend bewiesen worden; vgl. auch Nauta 2002, 26. Dazu s.u.
Etwa schon Eisenstadt/Roniger 1984; Garnsey/Saller 1987 und Wallace-Hadrill 1989. In den letzten Jahren dagegen: Nicols 2014 und v.a. Ganter 2015. Zu konkreten Aspekten bzw. Bestandteilen des Verhältnisses vgl. etwa Vössing 2010; Goldbeck 2010; Lavan 2013; Jehne/Pina Polo 2015. Dazu s.u. Einleitung.
Vgl. vor allem White 1975; 1978; 1993; 2007; Saller 1982; 1989; Gold 1987; Konstan 1995; 1997; Bowditch 2001; 2010; Verboven 2002; Nauta 2002; 2005; Winterling 2008; Williams 2012; Rollinger 2014. Dazu s.u. Einleitung.
Zu den einzelnen Kommentaren und Studien sei auf die jeweiligen Kapitel verwiesen.
Die m.E. stark vereinfachte Betrachtung bei Damon (1995 und v.a. 1997), dass die gesamte römische Literatur hindurch die Parasiten der Komödie römische Klienten darstellten, ist vorsichtig zu revidieren.
Unter Patronat (in der englischsprachigen Literatur als patronage vorzufinden) verstehe ich für diese Arbeit natürlich nicht eine moderne Bedeutung des Terminus (vgl. dazu White 1978, 79), sondern das römische Verhältnis zwischen clientes und patroni. Einen guten Überblick gibt neben den Artikeln zu cliens und patronus im Neuen Pauly (Lintott 1997/9 und Lintott/Schiemann 2000) der von Wallace-Hadrill 1989 herausgegebene Sammelband. Zur Vertiefung der Patronats- bzw. Klientel-Terminologie kann auf das Einleitungskapitel in Nauta 2002 (sowie Nauta 2005, 214), auf William (2012, 45ff.) sowie auf das Kapitel „Patrons and Protectors – The language of clientela“ in Lavan 2013 verwiesen werden. Bei Nicol 2014 ist eine interessante und die bisherige Problematik der patronus-cliens-Beziehung zusammenfassende Einleitung zu den Charakteristiken des Verhältnisses zu finden. Ganter 2015 bietet die gründlichste Gesamtdarstellung des patronus-cliens-Verhältnisses in der römischen Welt: In dieser demonstriert sie, wie das „Bindungswesen“ die römische Gesellschaft tatsächlich „zusammenhielt“. Zum literarischen Patronat bzw. zur Patronage und dessen Parallele zum ‚gewöhnlichen‘ vgl. Gold 1987 und wiederum Nauta 2002.
Dass die Termini patronatus und clientela beinahe als Synonyme verwendet werden, zeigt Leberl 2004, 113. Wenn man eine differenziertere Begrifflichkeit benutzen möchte, die anders als der Ausdruck „Klientelwesen“ nicht konnotativ belastet wird, wie Ganter (2015, 5ff.) bemerkt, findet man im deutschsprachigen Raum auch schon seit Gelzer (1912(=1962)) Begriffe wie „Nah- und Treueverhältnisse“ oder seit Meier (1966) „Bindungswesen“.
Dazu vgl. Ganter 2015 sowie 2015b.
Vgl. Garnsey/Saller 1987, 152f.: „A reciprocal exchange relationship between men of unequal status and resources.“
Soziale Asymmetrie zwischen beiden Mitgliedern spielt jedoch auch eine grundlegende Rolle in der patronus-cliens-Beziehung; dazu vgl. Saller 1982, 1 (Erläuterungen dazu auch bei Nauta 2002, 20f.).
Hierzu muss gesagt werden, dass die römische Welt nicht nur die hier präsentierte Rolle als patronus kennt (im englischen Sprachraum: personal patronage, im deutschen: Patronat), sondern auch den ehemaligen Herrn eines Freigelassenen (libertus), den Anwalt im Bezug zu seinen Klienten (vor allem während der ausgehenden Republik) sowie schließlich den Stadtpatron, wenn der Patron eine Gemeinde unter Schutz nimmt (im englischen Sprachraum: civic patronage). Letzterer war schon in Caesars Bellum civile häufig vorzufinden, doch v.a. ab der augusteischen Zeit wurde es zum politisch verbreiteten Phänomen; vgl. dazu Nicols 2014, 3, und Jehne 2015, 297–319; vgl. auch Levi 1994, 378f. In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich vor allem mit dem ersten Fall des Patronats, selbst wenn die Rolle der clientes eines Anwalts nicht immer leicht davon zu trennen ist.
Vgl. Serv. ad Aen. 6,609: si enim clientes quasi colentes sunt, patroni quasi patres, tantundem est clientem, quantum filium fallere. Dionysios von Halikarnass beschreibt die Pflichten der patroni den clientes gegenüber als ὅσα περὶ παίδων πράττουσι πατέρες (ant. 2,10,1); dazu s.u.
Vgl. Torelli 1988, 243ff.; dazu s.u.
Daher die phraseologische Redewendung esse in fide et clientela alicuius (Cic. Rosc. Am. 33,93). Zu den möglichen Folgen solcher und ähnlicher Bezeichnungen vgl. Torelli 1988, 243ff., Freyburger 1986, 151ff. und Lavan 2013, 186ff. Bei Plutarch (Rom. 13,4) ist sogar der latinisierende Begriff πατρωνεία als προστασία wiedergegeben. Bei Dionysios von Halikarnass (ant. 2,9,3) wird die πατρωνεία sogar als τῶν πενήτων καὶ ταπεινῶν προστασία expliziter definiert; dazu s.u. Anm. 26
Serv. ad Aen. 6,609. Zur rechtlich-religiösen Bedeutung des Begriffes homo sacer vgl. Fest. s.v. Sacer Mons 424 Lindsay: homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; s.u. Anm. 22. Zur Formel sacer esto und die rechtlich-religiösen Folgen der sog. ‚Sazertät‘ in der röm. Strafrechtsgeschichte vgl. neben Agamben 1995; Fiori 1996, 22ff. und Garofalo 2005, 225ff. sowie 2013.
Daher Gellius’ Prämisse de officiorum gradu atque ordine moribus populi Romani observato (5,13,2): Conveniebat autem facile constabatque ex moribus primum iuxta parentes locum tenere pupillos debere fidei tutelaeque nostrae creditos; secundum eos proximum locum clientes habere, qui sese itidem in fidem patrociniumque nostrum dediderunt; tum in tertio loco esse hospites; postea esse cognatos adfinesque; dazu s.u. im Abschnitt b).
Vgl. Saller 1982, 1.
Für einen vertieften Überblick über die Charakteristika des Verhältnisses vgl. Ganter 2015, 6–15.
Vgl. Levi 1994, 377, Nicols 2014, 2. Vorsichtiger formulieren es Eisenstadt/Roniger 1984, 58: „Clients had no legal claims in law.“
Nicols 2014, 2.
Zum religiösen Wesen des römischen ius v.a. in der archaischen Weltanschauung Roms, wo die clientela entstanden sein soll, vgl. Schiavone 2005.
Wird im Lateinischen patronus etymologisch auf pater zurückgeführt, cliens nach Servius (ad Aen. 6,609) auf das Verb colere, so wird im Griechischen der patronus dagegen als Beschützer bzw. Vorstand interpretiert (προστάτης), doch cliens wird parallel zum Lateinischen abgeleitet (πελάτης < πελάζω = colere). Dieselbe Erklärung findet man auch bei Plutarch (Rom. 13,7): [ὁ Ῥωμύλος] ἑτέροις δὲ τοὺς δυνατοὺς ἀπὸ τῶν πολλῶν διῄρει, πάτρωνας ὀνομάζων, ὅπερ ἐστὶ προστάτας, ἐκείνους δὲ κλίεντας, ὅπερ ἐστὶ πελάτας; vgl. dazu Nauta 2002, 13. Dass cliens eher vom clueo abzuleiten sei, ist nach Linke (1995, 88f.) wahrscheinlicher.
Dion. Hal. ant. 2,9,2: ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὑπεροπτικῶς ἐχρῶντο τοῖς πελάταις ἔργα τε ἐπιτάττοντες οὐ προσήκοντα ἐλευθέροις, καὶ ὁπότε μὴ πράξειάν τι τῶν κελευομένων, πληγὰς ἐντείνοντες καὶ τἆλλα ὥσπερ ἀργυρωνήτοις παραχρώμενοι. Wie sich die Parallelisierung zwischen clientela und servitus im Diskurs der römischen Satire, etwa bei Martial und Juvenal, weiterentwickeln wird, wird noch unten gezeigt werden.
Trotzdem wird von Dionysios selber impliziert, dass die finanziellen Möglichkeiten der clientes weit größer sein können als diejenigen der adligen patroni; s.u.
Eine ähnliche Beschreibung findet sich bei Plutarch auch (Rom. 13,7); dazu s.u.
Dion. Hal. ant. 2,10,3: κοινῇ δ’ἀμφοτέροις οὔτε ὅσιον οὔτε θέμις ἦν κατηγορεῖν ἀλλήλων ἐπὶ δίκαις ἢ καταμαρτυρεῖν ἢ ψῆφον ἐναντίαν ἐπιφέρειν ἢ μετὰ τῶν ἐχθρῶν ἐξετάζεσθαι. Auch Plutarch spricht von dieser Regelung (Rom. 13,7): καταμαρτυρεῖν τε πελάτου προστάτην ἢ προστάτου πελάτην οὔτε νόμος οὐδεὶς οὔτ’ ἄρχων ἠνάγκαζεν.
Dion. Hal. ant. 2,10,3: εἰ δέ τις ἐξελεγχθείη τούτων τι διαπραττόμενος ἔνοχος ἦν τῷ νόμῳ τῆς προδοσίας, ὃν ἐκύρωσεν ὁ Ῥωμύλος, τὸν δὲ ἁλόντα τῷ βουλομένῳ κτείνειν ὅσιον ἦν ὡς θῦμα τοῦ καταχθονίου Διός. Dies knüpft wieder an die Formel sacer esto des zitierten Zwölftafelgesetzes an und stellt den Kernpunkt der sog. Sazertät dar; s.o. Anm. 10.
Dion. Hal. ant. 2,10,4: τοιγάρτοι διέμειναν ἐν πολλαῖς γενεαῖς οὐδὲν διαφέρουσαι συγγενικῶν ἀναγκαιοτήτων αἱ τῶν πελατῶν τε καὶ προστατῶν συζυγίαι παισὶ παίδων συνιστάμεναι.
Dion. Hal. ant. 2,10,4: τῶν μὲν πελατῶν ἅπαντα τοῖς προστάταις ἀξιούντων ὡς δυνάμεως εἶχον ὑπηρετεῖν, τῶν δὲ πατρικίων ἥκιστα βουλομένων τοῖς πελάταις ἐνοχλεῖν χρηματικήν τε οὐδεμίαν δωρεὰν προσιεμένων.
Dion. Hal. ant. 2,75,3: πρῶτος ἀνθρώπων [sc. ὁ Νόμας] ἱερὸν ἱδρύσατο Πίστεως δημοσίας καὶ θυσίας αὐτῇ κατεστήσατο, καθάπερ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς, δημοτελεῖς.
Vgl. dazu Freyburger 1986, 149ff.; s. auch o. Anm. 9. Zum Einfluss des Fides-Kults auf die Lex XII tab. vgl. Torelli 1988, 245.
Dion. Hal. ant. 2,10,4: οὕτως ἐγκρατὴς ὁ βίος ἦν αὐτοῖς ἁπάσης ἡδονῆς καὶ τὸ μακαρίον ἀρετῇ μετρῶν, οὐ τύχῃ. Diese Ansicht teilt auch Plutarch (Rom. 13,7): πρὸς ἀλλήλους θαυμαστὴν εὔνοιαν αὐτοῖς καὶ μεγάλων δικαίων ὑπάρξουσαν ἐνεποίησεν (sc. ὁ Ῥώμυλος).
Vgl. Drummond 1989, 90f., v.a. aber Wiater 2014, 39–45: Er warnt richtig davor, Dionysios’ römische Geschichte als historische Quelle für die Anfangszeit Roms naiv zu lesen, sondern vielmehr als kulturgeschichtliches Dokument dessen, „was Römer und Griechen im ersten vorchristlichen Jahrhundert (…) über die Ursprünge der Römer zu wissen glaubten“ (44f.).
Dazu Nauta 2002, 13: „There was another type of relationship between a patronus and his clientes, which was neither exclusive nor hereditary, and is well-attested from the Late Republic and the Early Empire. It is this type of patronage which figures largely in the epigrams of Martial and the satires of Juvenal.“ Goldbeck (2010, 11ff.) widmet sich den salutationes der Klienten gegenüber den Patronen und kommt zum Schluss, dass die Morgenbegrüßungen „keine ‚uralte‘ römische Praxis waren, wie die Forschung gewöhnlich annimmt, sondern in wesentlichen Punkten ihre Ausprägung erst gegen Ende des zweiten Jahrhunderts v.Chr. erfuhr und sich seit Beginn der Kaiserzeit erneut wandelte“. Ganter (2015 passim) dagegen sieht in seinem Gesamtüberblick über das patronus-cliens-Verhältnis dieses als eine fundamentale Grundlage der römischen Gesellschaft aus einer althistorischen Perspektive von der frühen Republik bis zum dritten Jahrhundert n.Chr.
Vgl. Damon 1997, 2: „That Dionysius is creating (or reproducing) an ideal past for a contemporary phenomenon is often noted but the positive light in which he bathes this piece of the ‘past’ is still perceptible in modern descriptions of the Roman patron/client relationship.“
In der Epigraphik ist die Situation anders, dazu vgl. Saller 1989, 54ff.; dagegen wenden sich z.T. White 1993, 32 und Nauta 2002, 14.
Dazu Saller 1982: 11: „In contrast to the words patronus and cliens, the language of amicitia did not carry any inherent notions of differential social status, since the word amicus was sufficiently ambiguous to encompass both social equals and unequals. This ambiguity was exploited and there was a tendency to call men amici rather than the demeaning clientes as a mark of consideration“; vgl. auch White 1978, 79ff. und 1993, 13f. sowie Nauta 2002, 14ff. Zur Betonung der sozialen Ungleichheit v.a. beim Terminus cliens vgl. Cic. off. 2,69; Sen. ben. 2,23,3.
Man halte sich die klare Kategorisierung der amici im klientelären Diskurs vor Augen, wo Unterschiede zwischen primi und secundi amici (Sen. ben. 6,33,4–34,2) oder tenues (Laus Pis. 118), minores und maiores (Plin. epist. 2,6) deutlich gemacht werden; vgl. dazu White 1978, 81; Saller 1982, 11f.; Nauta 2002, 15f. Siehe auch unten im Martial- und Juvenal-Kapitel.
Vgl. dazu neben Saller 1982 und White 1978; 1993 auch Konstan 1995; 1997; Kleijwegt 1998, 259ff.; Verboven 2002, 41ff.; Winterling 2008; Williams 2012, 44ff.; Rollinger 2014, 70ff.; Ganter 2015, 10ff.; vgl. auch Hafner 2017, 38f.
Man halte sich schon die Anmerkung Porphyrios ad epod. 1,2 vor Augen, in der die Anrede des Horaz-Sprechers an seinen amice … Maecenas (2–4) als ein lediglich klienteläres Verhältnis rezipiert wird: Non videtur verecundiae Horati convenire, ut amicum se Maecenatis dicat, cum clientem debeat dicere.
Für amicitia als „the standard idiom in which relationships between writers and the elite were described“ vgl. White 2007, 196.
Vgl. Cic. Lael. 6,20: (…) ipsa virtus amicitiam et gignit et continet, nec sine virtute amicitia esse ullo pacto potest. Auch ebd. 18,65: amicitiam nisi inter bonos esse non posse.
Vgl. Arist. EN 1156b: τελεία δ’ἐστὶν ἡ τῶν ἀγαθῶν φιλία καὶ κατ’ἀρετὴν ὁμοίων.
Trotzdem sollte man auch die aristotelische Definition einer διὰ τὸ χρήσιμον φιλία in Betracht ziehen, d.h. gewisse Nutzbarkeitserwägungen, die in der Freundschaft impliziert werden, wie etwa politische oder soziale Interessen: Schon Aristoteles (EN 1156a) unterscheidet zwischen zwei Arten von parallelen Freundschaftsbeziehungen (φιλίαι): einerseits die διὰ τὸ χρήσιμον und andererseits die δι’ἡδονήν; sie seien nur analog als Freundschaft anzunehmen, d.h. sie werden nur ‚aus Ähnlichkeit‘ (καθ’ὁμοιότητα: 1157a) der φιλία gleichgestellt. Man vgl. auch Ciceros Betrachtung der utilitas in der amicitia im epikureischen Sinne in fin. 1,69 und 2,78f. (dazu s.u. im Horaz-Kapitel, Anm. 189). Dabei ist allerdings mit Ganter (2015, 11) darauf zu achten, dass amicitia im Allgemeinen weder als rein politisches und utilitaristisches Verhältnis noch als rein affektive Bindung verstanden werden darf, wie es Konstan (1995 und 1997) tut, sondern sich als eine zum Teil untrennbare Mischung von beidem erweist; s. dazu noch u. im jeweiligen Horaz- und Martial-Kapitel.
Vgl. Kleijwegt 1998; dazu s.u. im jeweiligen Martial- und Juvenal-Kapitel.
White 1993, 31: „An exchange that was badly balanced over time might also work to clientize a friend. And so it is not possible to draw a clear distinction in every case.“
Williams 2012, 46: „Concrete benefit of various kinds was a real possibility in connection with another type of interpersonal relationship which, alongside and often overlapping with amicitia, is equally structural to Roman society and pervading the textual tradition. In English traditionally called ‘patronage’, this relationship joined two men of openly divergent economic, social, or political status in a mutually beneficial connection in which the higher-status man could be called a patronus, his dependant his cliens.“
Für Konstan 1995 deutet die literarische Gleichsetzung beider Termini (amicitia und clientela) auf spezifische ironische bzw. satirische Absichten eines bestimmten Autors hin, wie es z.B. bei Juvenal der Fall ist; vgl. aber auch Ganter (2015, 11), die überzeugend zur Vorsicht rät.
White 1978, 81: „Whatever words they used, the two parties to a Roman friendship were acutely conscious of every nuance that put one person in the shadow of the other. Amici rarely could be and rarely considered themselves as peers. When it became necessary to press the distinction, there existed ways of indicating with whom the advantage or the disadvantage lay. One might speak of amici minores (Pliny, Epist. 2. 6. 1), or, less con-descendingly, of amici pauperes (Pliny, Epist. 9. 30), or of tenuiores amici (Cicero, Mur. 70), or of humiles amici (Seneca, Epist. 47. 1), or of a mediocris (Cicero, Fin. 2. 85) or modicus amicus (Juvenal 5. 108).“
Nauta 2002, 15: „The word amicus and the corresponding noun amicitia were used for a wide variety of relationships, whether between equals or unequals, whether marked by deeply felt affection or by mere urbane politeness, whether founded on selfless devotion or on the interested exchange of goods and services.“
Zur Entwicklung des παράσιτος v.a. in der griechischen Komödie vgl. Nesselrath 1985, 99–121; vgl. auch Antonsen-Resch 2012, 3–19.
Vgl. Damon 1995, und v.a. 1997.
Damon 1997, 8.
Ebd.
Zu den einzelnen Parasitenfiguren sowie ihrer Charakterzeichnung und dramatischen Funktion bei Plautus und Terenz vgl. Flaucher 2002.
Bei Plautus kommt das Wort cliens 11 Mal vor: dreimal als weiblich, als famula verstanden, vgl. TLL 3,1346,72 s.v. clienta (1), öfter im erweiterten Sinne als Günstling (Miles 789; Most. 407–8, 746;), als Anhänger einer Gottheit (Poen. 1180) oder als Terminus technicus für befreite meretrices (Rud. 893). Aber der Klient in unserem Sinne kommt in Plautus’ Komödien dreimal vor: in der Asinaria (871), in den Captivi (335) und in den Menaechmi. Für die vorliegende Arbeit ist die letzte Stelle am wichtigsten, da die Klientenfigur dort wiederholt thematisiert wird (s. dazu im nächsten Kapitel).
Vgl. Preisendaz in RLW s.v. Humor: „Heute oft unterschiedslos auf alles (…), was Lachen erregt.“ Selbst wenn die eigentliche Definition von Humor eher ein „ästhetischer Grundbegriff der Neuzeit“ ist, der darüber hinaus auf die „tiefgreifende Wandlung der Bedeutung von humour“ um das 18. Jh. in England zurückzuführen ist (damals wurde nämlich „die humoristische Exzentrizität positiviert“, und der „,sense of humour‘ zum persönlichen und zwischenmenschlichen Wert erhoben“ als Zeugnis der „Vielfältigkeit der menschlichen Natur und der Weltbetrachtung“), kann man doch m.E. sensu latu von einem allgemein ‚humorvollen Ton‘ auch bei den antiken Autoren sprechen, wenn man darunter den Lachen erregenden „Modus der Kommunikation und Darstellung“ bzw. „Diskursmodus“ als Ziel versteht, und zwar am besten ohne „implizit oder explizit eine neuzeitliche Ästhetik und Subjektphilosophie“ vorauszusetzen.
Hierzu sei vor allem auf Seeck 1991 (s. dazu u. Anm. 57) sowie auf Schmitz 2000, 1–10 verwiesen.
Etwa bei der Darstellung des malus cliens, die Menaechmus in seinem Monolog macht, oder wie Horaz das Gespräch mit der Nervensäge in sat. 1,9 gestaltet; auch wie der Ton in der Beschreibung verschiedener Situationen in den Epigrammen Martials wirkt oder schließlich der Kontrast in Naevolus’ Ausdrucksweise und dem Inhalt seiner Behauptungen durch etwa Parodie gebaut wird (dazu s.u. die jeweiligen Kapitel).
Vgl. Simon in RLW s.v. Witz: „Der Witzerzählung wird eine Erwartung aufgebaut, die in der Pointe mit einem zweiten Bedeutungsfeld konfrontiert wird, das eine weitgehende semantische oder phonetische Homologie mit der Erzählung besitzt, aber in der Pointe eine Differenz (Kontextsprung, Bruch von Isotopien) markiert. Der scherzhafte Doppelsinn eröffnet die spielerische Lizenz für Tabubrüche und Normverstöße;“ z.B. öfters bei Horaz (etwa der Wucherer Alfius, der sich erst am Ende als Sprecher in der zweiten Epode zu erkennen gibt und damit die Zuverlässigkeit der gesamten Aussagen der Epode in Frage stellt, weil er evident nach einem anderen Wertesystem lebt), oder v.a. in Martials Epigrammen; dazu s.u. in den die jeweiligen Kapiteln.
Vgl. Largier in RLW s.v. Zynismus (für Sarkasmus): „bittere[r] Spott aus Verzweiflung.“
Zu Satire generell als „Angriffsliteratur mit einem Spektrum vom scherzhaften Spott bis zur pathetischen Schärfes“, die in ihrer Gattungstradition zu verstehen ist, vgl. Brummack in LRW s.v. Satire; vgl. darüber hinaus auch Seeck 1991, 20: Nach seiner Definition ist (römische) Satire „ein literarischer Diskreditierungsversuch, bei dem Indignation und/oder Spott und Art und Form der Darstellung als suggestive Mittel eingesetzt werden, um die unbewusste Zustimmung des Lesers zu erreichen“. Zu Ironie (und zur sokratischen Figur des εἴρων) vgl. Müller in LRW s.v. Ironie, wo als „Aspekt ironischer Sprechakte“ die „Art der praktizierten Verstellung“ betont wird: „Ein Lügner will seine Verstellung nicht durchschaut sehen und seine wahre Meinung nicht erkannt wissen. Im Falle der Ironie ist die Substitution des für richtig gehaltenen Sachverhalts durch sein Gegenteil durchsichtig und die eigentliche Bedeutung rekonstruierbar“. Zur Rolle des Lesers als Hörer bzw. dritte Person, dank der die Ironie zustande kommt („das triadische Ironie-Modell“), vgl. Stempels und Warnings Aufsätze „Ironie als Sprechhandlung“ bzw. „Ironiesignale und ironische Solidarisierung“ in Preisendanz/Warning 1976, 205–236 bzw. 416–422.
Vgl. Verweyen und Witting in RLW s.v. Parodie: „Ein in unterschiedlichen Medien vorkommendes Verfahren distanzierender Imitation von Merkmalen eines Einzelwerkes, einer Werkgruppe oder ihres Stils. (…). Im literarischen Bereich bildet das Parodieren eine intertextuell ausgerichtete Schreibweise, bei der konstitutive Merkmale der Ausdrucksebene eines Einzeltextes, mehrerer Texte oder charakteristische Merkmale eines Stils übernommen werden, um die jeweils gewählte(n) Vorlage(n) durch Komisierungs-Strategien wie Untererfüllung und/oder Übererfüllung herabzusetzen.“
Natürlich ist Kristevas (1967, 440f.) berühmte Bemerkung zutreffend („tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte“: J. Kristeva, „Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman“, in: Critique 23, Nr. 239, 1967, 438–465), doch scheinen für mein Vorhaben Broich/Pfister (1985, 31) hier einen fruchtbareren Zugang zu bieten, indem sie von einem Konzept der Intertextualität ausgehen, bei dem „ein Autor bei der Abfassung seines Textes sich nicht nur der Verwendung anderer Texte bewußt ist, sondern auch vom Rezipienten erwartet, daß er diese Beziehung zwischen seinem Text und anderen Texten als vom Autor intendiert und als wichtig für das Verständnis seines Textes erkennt. Intertextualität in diesem engeren Sinn setzt also das Gelingen eines ganz bestimmten Kommunikationsprozesses voraus, bei dem nicht nur Autor und Leser sich der Intertextualität eines Textes bewußt sind, sondern bei dem jeder der beiden Partner des Kommunikationsvorgangs darüber hinaus auch das Intertextualitätsbewußtsein seines Partners miteinkalkuliert“ (Kristevas Zitat bei Broich/Pfister ebd.).
Broich/Pfister greifen dabei auf Warnings Begriffe (in Preisendanz/Warning 1976, 420ff.) der „Signalschwelle“ zurück und warnen davor, dass „die Erkennbarkeit der Markierung auch in mehrfacher Hinsicht rezipientenabhängig“ sei: „So wird für einen sehr belesenen Leser die »Signalschwelle« bei Markierungen von Intertextualität viel niedriger liegen als bei Gelegenheitslesern. Andererseits liegt die »Signalschwelle« mit wachsendem zeitlichem Abstand zum Text bzw. Prätext bei vielen späteren Rezipienten wieder höher, wenn der zeitgenössische Kontext nicht mehr unmittelbar präsent ist“ (Broich/Pfister 1986, 33).
Vgl. etwa die Darstellung von Naevolus’ Tirade in Juv. 9; dazu s.u. im Juvenal-Kapitel.
Vor allem seit Damon 1995 und 1997, aber auch Ganter 2015b. S.o. in Einleitung, c), ii)
Dazu vgl. Nesselrath 1985, 99–121. Einen Forschungsüberblick bietet Antonsen-Resch 2012, 3f.
Zwar erst bei Cato (agr. 5,4) belegt, doch in Dichtung bei Lucilius (27,717) und Naevius (60 Rib.: Gymnasticus) jeweils einmal zu finden; am häufigsten natürlich bei Plautus und Terenz. Dazu sei auf Damon 1997; Flaucher 2002 und Antonsen-Resch 2012 verwiesen. Doch siehe auch noch unten.
Dazu vgl. Fraenkel 1960, 152ff.
Neben Fraenkel ebd., siehe v.a. Stärk 1989.
Dazu vgl. auch Gratwick 1993, 193.
Ich folge dem Wortlaut bei De Melo 2011. Für die Überlieferung des Textes vgl. Leo 1895, Lindsay 1980 (= 1904), Gratwick 1993 sowie De Melo 2011.
Ich folge hierbei De Melos Aufgliederung 2011, 193ff. Fraenkel (1960, 337f.) unterzieht die Monodie einer metrischen Analyse und zieht eine Zweiteilung für das canticum in Betracht: Er setzt den sentenziösen Monolog in bakcheisches Versmaß (seinerseits in zwei Abschnitte geteilt: 571–587 und 588–595), den letzten Teil in jambische Dimeter (ab Vers 596).
Dass „wir“ (vgl. utimur) auch als „wir Römer“ zu verstehen ist, hat Fraenkel 1960, 152 überzeugend dargelegt.
Zur fides der Klienten gegenüber den Patronen vgl. Freyburger 1986, 152ff. Dazu s.o. in der Einleitung Anm. 26.
Man denke an den bereits zitierten Satz Catos: testmonium adversus clientem nemo dicit (bei Gell. 5,13,4).
Zur Bedeutung der Belauschung eines plautinischen Monologs vgl. Stürner 2011, vgl. unten Anm. 32.
Dazu vgl. Fraenkel 1960, 152.
Dazu Fraenkel 1960, 153f.: „[sc. Plautus] trasforma la lamentela generica sulla πολυπραγμοσύνη di coloro che si lasciano intralciare nelle loro faccende più intime da liti altrui, in un’invettiva contro un determinato difetto che vizia le classi più ragguardevoli della società romana, cioè la caccia senza scrupoli alla clientela.“
D.h., dies wird durch für die römische Welt typische Elementen (wie hier eben die clientela-Problematik) angereichert, die im Gegensatz zu Elementen stehen, die typisch für einen eher griechischen Plot wären. Vgl. Gratwick 1993, 196. Doch vgl. schon Fraenkel 1960, 153.
Vgl. Fraenkel 1960, 150–53. Stärk (1989, 12) sieht sogar „nicht die große schriftliche Tradition der griechischen Komödie“ hinter den Kompositionsstrategien der Menaechmi als Stück, „sondern die schwerer faßbare, aber nicht weniger mächtige Tradition des schriftlich nicht fixierten italischen Schauspiels“, wodurch der italische Charakter der von Fraenkel erkannten plautinischen Inventionen bestätigt würde – dagegen Antonsen-Resch 2012, 101ff., die den griechischen Charakter des Stücks unterstreicht.
Vgl. Fraenkel 1922, 161.
Vgl. Ganter 2015, 91.
Vgl. De Melo 1993, 195.
Dion. Hal. ant. 2,10,1: δίκας τε ὑπὲρ τῶν πελατῶν ἀδικουμένων λαγχάνειν, εἴ τις βλάπτοιτο περὶ τὰ συμβόλαια, καὶ τοῖς ἐγκαλοῦσιν ὑπέχειν.
Zur plautinischen Umarbeitung der möglichen (griechischen) Urfigur, entweder eines Verwandten oder eines Freundes des Menaechmus, in einen römischen cliens vgl. Fraenkel 1960, 152ff. Vgl. auch Gratwick 1993, 196 (er schlägt weniger überzeugend vor, in der griechischen Vorlage sei es Peniculus selbst, der Hilfe brauche) und Damon 1997, 64 (die das widerlegt). Siehe auch unten Anm. 43.
Ganter (2015b, 50) zeigt sich von einer solchen fehlenden Übereinstimmung überrascht: „The reciprocity of Plautine patron-clients relationships is motivated by profit-seeking. Certainly, this scenario contradicts in almost every aspect the picture painted by Dionysios“. Dabei scheint sie allerdings das humoristische Ziel der Passage zu übersehen.
Vgl. De Melo 2011, 196: „The audience will have savoured the irony that Men. himself is about to be convicted of blatant theft in the sequel.“ Dass Menaechmus nichts gegen seinen Klienten sagen darf, ist offensichtlich. Man denke an das oben genannte Fragment Catos (testimonium adversus clientem nemo dicit, bei Gell. 5,13,4).
Dies knüpft wiederum an die utopische Beschreibung des Dionysios an (μέγας ἔπαινος ἦν τοῖς ἐκ τῶν ἐπιφανῶν οἴκων (sc. den Patronen) ὡς πλείστους πελάτας ἔχειν, ant. 2,10,4). Dieses für das Klientenwesen des frühen Roms typische Motiv wirkt dann topisch bis in die Kaiserzeit: Man denke z.B. an Sen. epist. 59,15 oder 76,12 oder an Mart. 1,54 oder 11,35. Dazu s.u. im Martial-Kapitel.
Zur stilistischen Analyse der μεγαλοπρέπεια in diesen Versen im Gegensatz zur ἀσφάλεια des letzten Teiles der Monodie vgl. Fraenkel 1960, 337f.
Der arme, aber gut geartete cliens (hau’ malus), welcher von seinem Patron verachtet und daher gedemütigt wird, steht im Mittelpunkt der Satiren Juvenals (etwa Umbricius oder Trebius); bei Plautus bleibt er eher noch eine Randerscheinung. Hauptziel hier sind vielmehr die hinterlistigen, aber reichen clientes, die durch ihr unaufrichtiges Verhalten die rechtliche Hilfe der Patrone benötigen und dabei nur Zeitverlust verursachen. Dazu s. im Juvenal-Kapitel.
Zu den undeklinierbaren Adjektiven nequam und frugi als topischem Oxymoron vgl. etwa Plaut. Pseud. 468.
Ganter (2015b, 49) betrachtet Menaechmus dagegen zu streng: „Menaechmus ridicules republican values (…). Even worse (…). By denying the attitudes, the values and the image cultivation of the optumi, he overtly argues for selfishness in contrast to the proclaimed altruism of an elite, who claim to give their lives to the res publica“.
Plaut. Men. 77–78: iuventus nomen fecit Peniculo mihi, | ideo quia mensam quando edo detergeo.
Es entsteht damit eine Parallelisierung zwischen Freiheitsverlust und freiwilliger Abhängigkeit, was in späteren Texten wieder aufgegriffen wird. Eine Parallele zur Sklaverei sieht an dieser Stelle Flaucher 2002, 37: „Damit ist die selbst gewählte, die eigene Existenz erhaltende Abhängigkeit des Parasiten von seinem Brotherrn viel enger und drückender als die juristische eines Sklaven von seinem Herrn.“ Zu adservare als Freiheitsverlust implizierend vgl. TLL s.v. adservo 2,872,15–71.
Dazu Flaucher 2002, 42f.: „Er [sc. Peniculus] sieht die Beziehung zwischen Gönner und Parasit sozusagen als einen ungeschriebenen gegenseitigen Vertrag, der von beiden Seiten ein gewisses, genau festgelegtes Verhalten fordert. Als er sich von Menaechmus um das Essen betrogen fühlt, glaubt Peniculus, auch seinen Teil nicht mehr erfüllen zu müssen und ein Recht auf Rache zu haben.“
Dass Menaechmus’ Ehefrau sowie Peniculus das Ganze belauschen, ist von theatralischer Bedeutung. Dazu vgl. Stürner 2011, 88: Dadurch, dass Menaechmus von seiner Ehefrau sowie seinem Parasiten belauscht wird, bringe Plautus dem Zuschauer in Erinnerung, „dass Menaechmus nicht nur selbst ein Mann von höchst fragwürdiger Integrität ist, sondern auch bereits persönlich die Vorzüge des Klientelsystems in der von ihm kritisierten Weise auszunutzen bereit war“. Dies sei vor allem deswegen der Fall, weil er Peniculus schon durch eine Mahlzeit dafür bestochen hatte, ihm beim Betrug der Ehefrau zu helfen. Einzige Schwierigkeit bei Stürner ist m.E. die Gleichsetzung von Peniculus als Menaechmus’ cliens. Dazu s.u.
Gratwick 1993, 196.
Damon 1997, 65.
Ebd.
Vgl. Ganter 2015, 95.
Damon 1997, 65.
Wenig überzeugend finde ich es, Peniculus als römischen Klienten zu sehen (Damon 1997, 60ff.). Er stellt eindeutig die typische Figur des griechischen Komödienparasiten dar: Wie hier gezeigt, wird er von keinerlei Elementen charakterisiert, die ihn als cliens einordnen. Ganter (2015b, 50) folgt auch Damons Interpretation: „Patrons are motivated not by altruism, but by instrumentalism; not by virtue, but by profit. And the patrons are not alone. The clients are also depicted as profit-hungry individuals, most prominently the parasites.“
Juv. 1,139; 5,145. Dazu s.u. im Juvenal-Kapitel.
Man denke an die Selius-Gruppe im zweiten Epigrammenbuch: 2,14; 2,27; 2,69. Dazu s.u. im Martial-Kapitel.
Dazu vgl. überzeugend White 1993, 29: Das Wort parasitus in der römischen Literatur behalte seine Assoziationen zum Theater bei und der Typus des Schmeichlers und Schmarotzers bleibe mit dem Komödienplot verbunden.
Dazu auch Flaucher 2002, 44, der ebenso die Bedeutung des unterhaltsamen Zieles des Parasiten betont.
Dass Menaechmus als patronus aktiv ist, hat zwar strukturell insoweit für das Stück Bedeutung, als damit seine Verspätung motiviert ist und die Verwechslungskomödie in Gang kommt, doch hätte jede andere Tätigkeit (sein Zwillingsbruder ist ja Kaufmann) eine ähnliche Funktion erfüllen können, ähnliches gilt auch für den cliens, dazu s.o. Anm. 21: Der cliens hätte einfach die Urfigur eines Verwandten oder Freundes des Protagonisten ersetzen können (so Fraenkel), der Hilfe brauchte. Es ist damit m.E. ersichtlich, wie die ‚romanisierende‘ Charakterisierung von Menaechmus sowie von dessen Klienten dazu eingesetzt wird, eine Nähe zum römischen Publikum zu schaffen.
Vor allem wurde es als solches rezipiert: Dies wird nicht nur in Porphyrios Anmerkung zu epod. 1,2 deutlich (dazu s.o. Einleitung, Anm. 35), sondern auch in manchen Darstellungen Martials und Juvenals, die die Natur des Verhältnisses zwischen Horaz und eben Maecenas als Inbegriff der literarischen Patronage betrachten (dazu s.u.). White (1978, 76–78; 92) und Nauta (2002, 26) haben übrigens überzeugend bewiesen, dass die Figur des Dichters und diejenige des üblichen Klienten gleich betrachtet werden dürfen. Einen tiefen Einblick in den Forschungsstand bietet Ganter 2015, 145f. (Anm. 9).
Dass dabei eine Differenzierung zwischen der Abhängigkeitsrolle des Horaz-Sprechers und derjenigen des archaisierend wirkenden cliens stark betont wird, ist trotz N./H. 1978 bei einer aufmerksamen Lektüre der Ode evident, dazu s.u. Abschnitt zur Ode 2,18.
Für einen Überblick über das Verhältnis zwischen Horaz und Maecenas als Inszenierung der dort bestehenden literarischen Patronage vgl. Gold 1987, 115–141.
Vgl. Hor. sat. 1,6,50; 53; 62; 70. Dazu s.u.
Die Problematik des Abhängigkeitsverhältnisses zu Maecenas, das zwischen clientela und amicitia oszilliert, kennzeichnet beide Satirenbücher, wie schon Holzberg (2009, v.a. 62ff.) bemerkte. Insbesondere gilt dies für Buch 1, in dem das sprechende Ich des Horaz im Zentrum der Darstellung steht: Während er sich in den ersten drei Satiren ethischen Problemen widmet und sich in der vierten als Lucilius-Nachfolger in der Gattung der Satire positioniert, profiliert er sich in den letzten fünf Satiren als Klient und vor allem als Freund des Maecenas. Dabei handeln die Satiren 7–9 von den „Lebenserfahrungen von der Zeit kurz vor den Kämpfen bei Philippi bis zu seiner gegenwärtigen Situation als Mitglied des Maecenaskreises“ und nur die letzte Satire von der poetologischen Beziehung zu Lucilius. Dagegen erfolgt im zweiten Satirenbuch durch Dialoge mit (unglaubwürdigen) Gesprächspartnern eher die Thematisierung moralphilosophischer Probleme. Dazu s.u. Anm. 35.
Zur Einordung der Satiren im ersten Buch, v.a. der Reihe 1,4; 1,5 und 1,6 als chronologische Verweise auf das Verhältnis zu Maecenas s. Ehlers 1985, 80: „In Beziehung zu Maecenas lässt sich die zweite Triade des ersten Buchs mit den Adverbien noch nicht (1,4), gerade eben (1,5) und schon lange (1,6) charakterisieren, wobei 1,6 auf die Situation des Novizen in 1,5 zurückblickt und 1,4 sozusagen den Inhalt dessen bildet, wovon Vergil und Varius in 1,6 Maecenas unterrichten (…).Weil feststeht, daß Horaz die Satiren ohne Rücksicht auf ihre Entstehungszeit für die Edition des ersten Satirenbuches neugeordnet hat, können wir davon ausgehen, daß die ‚Reise nach Brindisi‘ bewußt in die Buchmitte gestellt wurde, absichtlich zwischen 1,4 und 1,6 eingereiht wurde.“
Dazu schon K./H. 2, ad loc.; vgl. auch Gowers 2012, 183–185. Schmitzer (2009, 115) betrachtet die Satire allerdings als „harmonisierende Sozialutopie“. Ähnliches betont Ehlers 1985: Dabei seien nicht nur die poetologischen Anspielungen auf Homer und Lucilius von Bedeutung (74f.), sondern auch (und vor allem) „die Deutung des ‚Iter Brundisinum‘ als Selbstdarstellung und Ortsbestimmung des Individuums Horaz“ (83). Zu einer ausgeglicheneren Betrachtung der Satire vgl. Ganter 2015, 149 (Anm. 19): „Dabei müssen beide Ansätze sich keineswegs ausschließen.“
Hor. sat. 1,5,40–43: Plotius et Varius Sinuessae Vergiliusque | occurrunt, animae, qualis neque candidiores | terra tulit neque quis me sit devinctior alter.
Zu Maecenas optimus „als überlegene[r] politische[r] Persönlichkeit“ und Horaz „als eine[m] unter mehreren Mitreisenden“ s. Ganter 2015, 149. Vgl. auch sat. 1,5,48. Über diese Gruppe findet der Leser in sat. 1,10,81ff. eine ähnliche Beschreibung, da der Horaz-Sprecher dort die docti… et amici aufzählt, auf deren poetisches Urteil er Wert legt.
Zur politischen Einstellung des Horaz-Sprechers an der Stelle vgl. Ehlers 1985, 79: „Ich glaube, daß die Ahnungslosigkeit des Horaz in politicis gespielt ist“, sowie Ganter 2015, 150: „Auch die Abkehr von der Politik, wie sie Horaz durch seine personae suggeriert, kommt einer politischen Stellungnahme gleich.“ Sie bietet außerdem einen tieferen Forschungsüberblick (ebd. Anm. 150).
Zu den Anspielungen auf Maecenas und Oktavian in der Satire im Hinblick auf „das polybianische Loblied auf Scipio“ (Polyb. 31,24,11) s. Ganter 2015, 153f.
Für rodo als lästiges und neidisches Klatschen über jemanden vgl. Cic. Balb. 26,57; bei Horaz auch: sat. 1,4,81. Für das invidere und invidia-Motiv s.u. Anm 57.
Schon Reckford (1959, 200) sah im Ausdruck in amicorum numero einen klaren Hinweis auf clientela: „This phrase, which implies a certain equality, should not obscure the fact that Horace became a client of Maecenas.“ Für Lefèvre (1981, 1994–1996) deutet der Ausdruck auf „ein eindeutiges Abhängigkeitsverhältnis“ hin. Er stuft daher solche amici/convictores mit den konventionellen clientes, die bestimmte Aufgaben hätten, auf einem ähnlichen (doch nicht gleichen) Niveau ein (1995) und sieht damit den „Beginn einer convictio, nicht eines Freundschaftsbunds geschildert.“ Doch dazu s.u.
Lefèvre (1981, 1988) sieht in convictor eine Stufe in der Entwicklung „zu einem gleichberechtigten Partner“ in der Beziehung zu Maecenas: „Im Grunde genommen ist (…) die Darstellung dieses Verhältnisses durch Horaz der Ausdruck einer stetigen Emanzipation von seiner Stellung eines convictor bei Maecenas nicht aufgrund wachsender wirtschaftlicher Unabhängigkeit, sondern aus einer andersgearteten Lebensweise und Lebensauffassung heraus.“ Doch dagegen s.u.
In der Dichtung erst bei Horaz (sat. 1,4,93 und hier, dazu s.u.). Vgl. die (para-)etymologische Anspielung in Hor. sat. 1,4,80f.: quis… eorum, | vixi cum quibus (dazu s.u.). Siehe auch TLL 4,875,14ff. s.v. convīctor sowie auch s.v. convīctus (TLL 4,875,30) und convīctio(2) (TLL 4,875,5).
Dazu vgl. Shackleton Bailey 1977, ad 337 (XVI.21) sowie 2001b III 129 (wo er den Terminus allgemein positiv als „he is the best company“ für Bruttius und „my friends and daily associates“ für Cratippus und seine Leute übersetzt).
Serv. ad Aen. 1,214: VICTV cibo, unde et convictores dicimus, ut Horatius “nunc quia sim tibi Maecenas convictor”; nam convivae a convivio dicuntur.
Dazu vgl. Shackleton Bailey 1977, ad 217 (IX.10), wo er Ciceros ‚playful‘ Ton hervorhebt, sowie 1980, 196, wo συμβιωτής neutraler als ‚companion‘ interpretiert wird. In 2001b II, 289 wird συμβιωτής auch neutral als „our charming little mate“ übersetzt.
Damon (1997, 129) hält convictor an dieser Stelle nur deswegen für nicht beleidigend, weil der Klient über sich selbst spricht („In this passage convictor is a term applied by a cliens to himself, so it is not here an uncomplimentary label“). Hierbei geht es m.E. nicht nur um „an uncomplimentary label“, das neutralisiert wird, indem der Sprecher es für sich selbst nutzt.
Dass honestum und turpe als Neutrum oder Maskulinum verstanden werden können, stellt m.E. eine gewollte Amphibolie dar (so auch De Vecchi 2013, 258). Dagegen verstehen Gowers (2012, 236) und K./H. (1, 118) sie nur als Maskulina. In jedem Fall wird deutlich, dass hier die Bedeutung von turpis (‚geldgierig‘) und honestus (‚aufrichtig‘) von zentraler Relevanz ist.
Stein-Hölkeskamp 2003 betont, dass die Vorliebe für intellektuelle Tätigkeiten erst im Prinzipat auch von der Elite allmählich gesellschaftlich anerkannt wurde. Gowers 2012 spricht von einer „quasi-aristocratic ease“ (244) und von „the advantages of an unpolitical life“ (247). Sie bemerkt den Gegensatz zwischen dem vom Horaz beschriebenen Leben und dem eines üblichen Klienten: „Behind this laid-back account lies an invisible alternative: the routine of the scurrying parasite or client, lobbying and paying respectful calls in return for his keep.“ (218). Zu einer ähnlich positiven Beschreibung der vita urbana als Flanieren vgl. Mart. 5,20,8–10, dazu s.u. im Martial-Kapitel.
Als consolatio-Strategie bezeichnet Horaz abschließend seine Überlegungen, die den Mangel an berühmten Vorfahren (131) kompensieren: Das scheinbare Defizit ist vielmehr der Vorteil, der suavius vivere (130) ermöglicht.
Gowers 2012, 218.
Zwar wird diese Figur als notus mihi quidam (3) oder einfach ille (6) eingeführt „ohne jegliches interpretatorisches Präjudiz“ – so Melters (2011, 327, Anm. 29), der ihn folglich nur quidam nennt. Doch dass sein Handeln durch garrire (13) beschrieben wird, muss betont werden: Daher passt er sehr wohl in die deutlich negativ wirkende Rolle des garrulus bzw. Schwätzers, vgl. auch in Vers 33, wo die Rede von der Figur des garrulus und der loquaces ist.
V.a. Damon 1997; Melters 2011 und Gowers 2012, dazu s.u.
Vgl. Damon 1997, 123: „In this Satire the figure of the parasite has been adapted to serve as a caricature for the ambitious cliens in first-century BC Rome.“ Zum garrulus als Figur in epist. 1,18 s.u. Melters 2011 geht noch weiter, indem er zu Recht die Figuren der neunten Satire als „Repräsentanten satirischer Themen“ betrachtet, die im Laufe des Satirenbuches vom Horaz-Sprecher behandelt werden: „In ihnen verdichten und konkretisieren sich bisherige zentrale ethische und ästhetische Motive des Satirenbuches.“
Dazu vgl. Melters 2011, der davon ausgehend die kompositorische Rolle dieser Satire (und des quidam) im Kontext des Satirenbuches betrachtet, dazu s.u.
Dazu vgl. Gold 1987, 117: „Maecenas is mentioned only once [in sat. 1,9], but his presence dominates the satire.“
Schon Porphyrio ad sat. 1,9,1 schreibt der Satire einen dramaticus character zu (vgl. Rudd 1966, 75). Zur Komödien-Sprache in dieser Satire im Allgemeinen vgl. auch Fedeli 1994, 484–507 sowie Melters 2011, 323f. (Anm. 15).
Richtig erkannt von Damon (1997, 123): „The pest is not simply a comic parasite transplanted: no comic parasite has legal business of his own to attend to, and parasites do not bribe slaves for admittance.“
Hor. sat. 1,6,60: quod eram narro. Dazu vgl. De Vecchi 2013, 278.