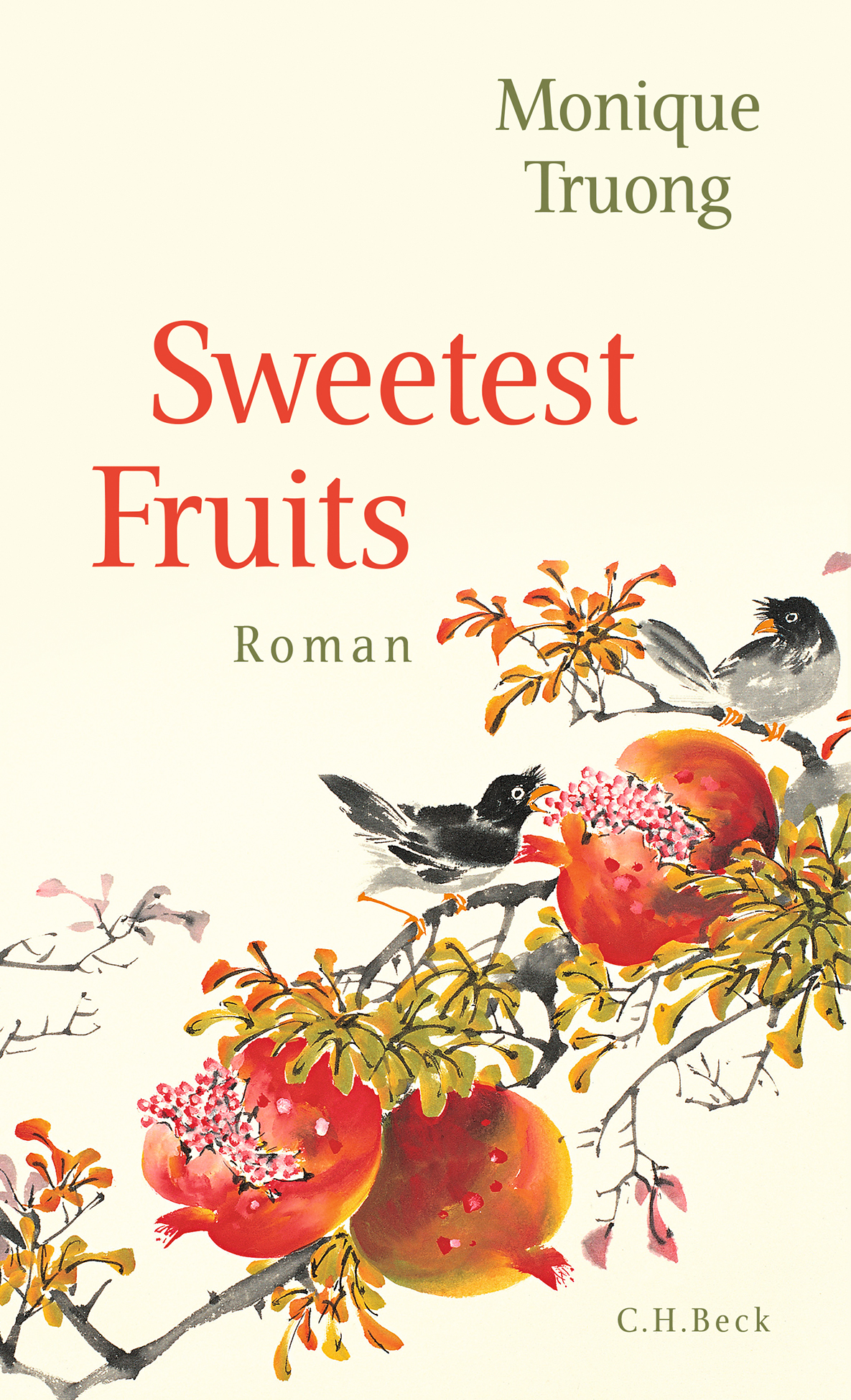
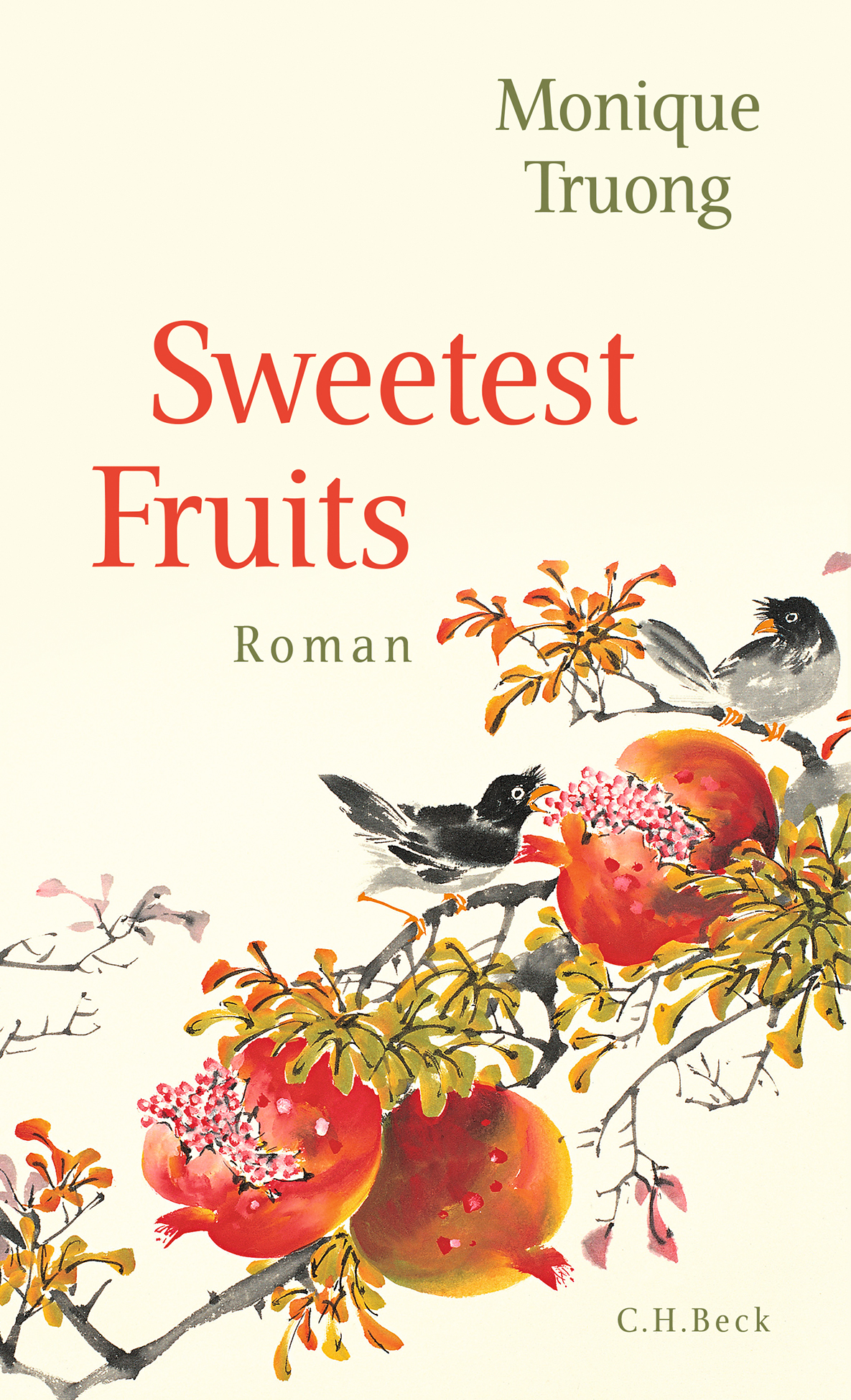
MONIQUE TRUONG
Sweetest Fruits
Roman
Aus dem Englischen
von Claudia Wenner
C.H.BECK
Drei starke, außergewöhnliche Frauen lässt Monique Truong in ihrem Roman ihre Geschichten erzählen, die ihres eigenen Lebens, und zugleich ersteht in den Stimmen dieser drei mutigen Frauen, jede auf ihre Art eine begnadete Erzählerin, das spannende Leben von Lafcadio Hearn (1850–1904) vor uns. Ein abenteuerliches, kurzes und zugleich reiches Dasein – das Leben eines schillernden literarischen Gestaltwandlers.
Eine Griechin erzählt, wie sie, um dem abgeschiedenen und beengten Leben auf ihrer Insel Lefkas zu entkommen, einen irischen Offizier heiratet und mit ihm und ihrem zweijährigen Sohn nach Irland geht. Aber die Ehe scheitert und sie lässt den Jungen zurück.
Eine ehemalige afroamerikanische Sklavin aus Kentucky erzählt, wie sie als Köchin in einer Pension in Cincinnati einen Zeitungsreporter kennenlernt und heiratet, der einst mittellos nach Amerika geschickt worden ist.
Und eine Japanerin, Tochter eines Samurai, erzählt, wie sie in Matsue den gerade eingetroffenen Englischlehrer, einen geschiedenen Schriftsteller und Journalisten, kennenlernt und heiratet, der fortan einen japanischen Namen tragen wird: Immer derselbe Mann!
Die drei Frauen haben dabei alle versucht, ein Leben jenseits der Einschränkungen durch Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft und Normen zu führen. Monique Truongs sinnliche und präzise Sprache, ihre hohe Erzählkunst und Sensibilität zieht uns in den Bann dieser mutigen und immer noch zeitgemäßen Lebensentwürfe auf der Suche nach Liebe und Zugehörigkeit.
Monique Truong, geboren 1968 in Saigon, veröffentlichte u.a. die Romane «Das Buch vom Salz» (C.H.Beck 2004) und «Bitter im Mund» (C.H.Beck 2010) sowie als Herausgeberin eine Sammlung großer Reportagen von Lafcadio Hearn «Vom Lasterleben am Kai» (C.H.Beck 2017). Sie hat zahlreiche Literaturpreise erhalten und lebt in New York.
Claudia Wenner lebt als Autorin, Publizistin und Übersetzerin in Frankfurt und Pondicherry, übersetzte u.a. Werke von Virginia Woolf und für C.H.Beck u.a. «Das verbotene Glück der anderen» von Manu Joseph (2010) und «Golden Boy» von Aravind Adiga (2016).
ELIZABETH BISLAND – (1861–1929)
NEW YORK, 1906
ROSA ANTONIA CASSIMATI – (1823–1882)
IRISCHE SEE, 1854
ELIZABETH BISLAND – (1861–1929)
NEW YORK, 1906
ALETHEA FOLEY – (1853–1913)
CINCINNATI, 1906
ELIZABETH BISLAND – (1861–1929)
NEW YORK, 1906
KOIZUMI SETSU – (1868–1932)
TOKIO, 1909
ELIZABETH BISLAND – (1861–1929)
NEW YORK, 1906
DANKSAGUNG
für Damijan
Sag Wahrheit ganz, doch sag sie schief –
EMILY DICKINSON
(1861–1929)
· · · ·
Lafcadio Hearn kam am siebenundzwanzigsten Juni im Jahre 1850 zur Welt. Seine Heimat waren die Ionischen Inseln, denn geboren wurde er auf der Insel Santa Maura, die auf Neugriechisch meist Levkas genannt wird oder Lefkada, eine Verballhornung des alten Namens Leukadia, dem Ort, der berühmt wurde, weil Sappho dort Selbstmord begangen haben soll … Bis heute wächst auf der spärlich besiedelten Insel dichter Wald, und an den steilen Berghängen über dem blauen Ionischen Meer kleben ein paar wenige Weinberge und Olivenhaine … Vor dieser wilden, steilen Kulisse, die im fast tropischen griechischen Meeres- und Himmelsblau schwebt, nahm der Junge die ersten verschwommenen Umrisse seines eigenen Bewusstseins wahr. Und es ist, als tauche diese Kulisse hinter all seinen späteren Erinnerungen und Voreingenommenheiten wieder auf, als habe er selbst an den dunkelsten und schmutzigsten Schauplätzen seiner Wanderschaft immer voller Sehnsucht von dieser hoch aufragenden Silhouette und dem Blau geträumt …
Elizabeth Bisland, The Life and Letters of Lafcadio Hearn,
Band 1 und 2 (1906)
(1823–1882)
· · · ·


Patricio Lafcadio Hearn war von Geburt an hungrig. Das sah ich an der Art, wie er trank. Von dem Moment, da er die Brustwarze zum ersten Mal gefunden hatte, war er nicht mehr gewillt, sie wieder loszulassen, und starrte mich mit offenen Augen warnend an, falls ich ihm die Brust entziehen sollte.
Alle Babys werden mit leerem Magen geboren, aber nicht alle haben einen so bedürftigen Blick.
Seinen älteren Bruder Giorgio, meinen seligen Erstgeborenen, musste ich locken und überlisten. Das Erste, was er in seinen Rosenknospenmund nahm, war mein mit Honig benetzter kleiner Finger, mit dem ich ihn dann geduldig zu meiner Brust lotste, wo sich Honig und Milch vermischten. Das beruhigte ihn, genügte jedoch nicht, um ihn zu behalten. Nicht einmal zwei Monate lang teilte sich Giorgio meine Milch mit Patricio.
Bitte nenn die beiden nicht ‹George› und ‹Patrick›. So heißen sie nämlich nicht. Die Sprache ihres Vaters ist nicht meine Sprache.
Noch bevor ich mir gewiss war, dass ich ein zweites Mal gesegnet worden war, hatte ich seine Esslust, die zunehmend stärker wurde. Patricio verlangte nach Kleinigkeiten vom Meer. Wellhornschnecken, die man nicht zu kaufen bekam, weil die Leute auf Santa Maura genau wie diejenigen auf Cerigo, der Insel, auf der ich geboren wurde, nichts kauften, was sie wie Kiesel am Strand selbst sammeln konnten. Morgens ließ ich meinen Erstgeborenen bei der alten Iota, der einzigen Frau in unserer Gasse, die keine Kinder hatte, und beugte mich über den nassen Sand, bis mir schwindelig wurde oder mein Korb voll war. Patricio wollte gekochte Wellhornschnecken, deren Fleischspiralen jeweils herausgelöst werden mussten. Er hatte nichts gegen Olivenöl und Zitronensaft, verbat sich jedoch Essig.
Als es keinen Zweifel mehr gab und mir das Wellhornschneckensammeln zu große Mühe bereitete, wollte Patricio unbedingt Herzmuscheln, die man kaufen konnte, weil sie fern der Küste auf Sandbänken zu finden waren, zu denen die Flut kam wie Gottes Hand.
Bloß wegen Herzmuscheln ums Leben zu kommen ist ein Fluch, der so alt ist wie das Meer. Mögest du vor ihm bewahrt bleiben.
Patricio mochte keinen Knoblauch, genau wie sein Vater. Er wusch mich von allen Nahrungsmitteln rein, die nach Knoblauch schmeckten, selbst wenn es sich um die in seiner Gunst stehenden Herzmuscheln handelte. Ich konnte ihm noch so sehr zuflüstern, dass diese Zehen die Perlen des Landes seien, und sie dicht an meinen dicken Bauch halten, damit er sich an den Geruch gewöhnen konnte, er ließ sich dennoch nicht überzeugen. Er entleerte mich immer wieder, bis ich ganz ausgehungert war. So begrub ich die Hoffnung auf Knoblauch und dämpfte die Herzmuscheln stattdessen mit einem Stückchen Schalotte. Patricio konnte von diesen salzigen Geschöpfen gar nicht genug bekommen. Um satt zu werden, brauchten wir ganze Eimer davon.
Während der letzten Monate, in denen wir eins waren, beschränkte uns Patricio auf Seeigel, deren Eigelbkörper mit Brotstücken ausgeschaufelt wurden. Damit wir genug Seeigel hatten, heuerte die alte Iota jeden Tag vier Jungen an, die bei Ebbe durch die seichten Stellen wateten, wo diese Stachelgestirne das flache Wasser verdunkelten wie die Schatten der darüber hinwegfliegenden Möwen. Tagein, tagaus von dieser Kost gemästet, nahm ich so zu, dass ich nur noch ein paar Schritte ums Bett herum tun konnte, ein Tier, das man an einen Pflock gebunden hatte.
Damals war Charles – der Vater von Giorgio, Patricio und, so Gott wollte, meinem gesegneten Dritten – bereits auf einer anderen Insel, in Gewässern, die so weit weg waren, dass ich die Entfernung zwischen uns nicht begriff. Bevor sein Schiff auslief, hatte Charles mir gesagt, wie viele Seemeilen es genau zwischen den Inseln von Santa Maura und Dominica waren, doch mit einer so langen Zahlenfolge konnte ich genauso wenig anfangen wie mit den Buchstaben des Alphabets.
Wenn ich den Mund aufmache, habe ich die Wahl zwischen zwei Sprachen: dem Venezianischen und dem Neugriechischen. Keine von beiden kann ich auf Papier entziffern. In jungen Jahren wollte ich unbedingt dabei sein, wenn meine älteren Brüder ihren täglichen Unterricht erhielten, doch mein Vater schlug mir meine Bitte ab. Er sagte, wenn ich je sein Haus verließe, dann um das Haus Gottes zu betreten oder dasjenige meines Ehemannes. In beiden Gebäuden gebe es einen Mann, der mir sagen könne, was geschrieben stehe und was wichtig sei.
Als mein Vater mir mein Los verkündete, dachte er nicht an einen Mann namens Charles Bush Hearn von der Insel Irland. Mein Vater hatte keine originellen Gedanken. Er wiederholte, was aus dem Mund anderer Männer kam, vorwiegend Adeliger, die ebenso unbedeutend waren wie er selbst. Dies lehrte er auch meine beiden Brüder. Sie glaubten allesamt, diese Nachäfferei mache sie klug und viel klüger als mich.
Eine Tochter zu sein war noch ein Fluch, der so alt ist wie das Meer, und er drang bei meiner Geburt an mein Ohr.
Als Charles uns in der Stadt Lefkada auf der Insel Santa Maura in der Obhut der alten Iota ließ, war Giorgio schon sechs Monate auf der Welt und Patricio fünf Monate in mir. Dass die alte Iota eigentlich gar nicht alt war, sah ich bei unserer ersten Begegnung. Ich erkannte sie als die Frau wieder, die ein paar Türen weiter in derselben Straße wie ich gewohnt hatte. Wir hatten noch nie ein Wort gewechselt. Um vor Gott die Wahrheit zu sagen, wechselte ich mit keiner Frau unserer Gasse ein Wort, nicht bevor Giorgio, mein Erstgeborener, diese Gasse in Myrtenblätter gehüllt verlassen hatte. Als mein heiliger Junge, mein Schatten von einem Kind, vor der Vollendung seines ersten Lebensjahres dahinschied, wollte ich Gott die Schuld geben und Ihm all die frevelhaften Flüche entgegenschleudern, die meine Brüder gegen Charles und mich ausstießen, hielt mich aber zurück. Ich brauchte Ihn noch für Patricio.
Wegen meiner Sünden wurde Giorgio das Sakrament der heiligen Taufe verweigert. Als er mir geboren ward, wollte die orthodoxe Kirche seine Seele nicht, und als er mir genommen wurde, wollte die orthodoxe Kirche seine Seele nicht. Einen Trauergottesdienst mit Ikonen, Weihrauch und Bienenwachskerzen konnte es für Giorgio nicht geben. Kein dreimal wiederholtes «Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser». Kein «Selig, deren Weg ohne Tadel ist», eine so treffende Beschreibung meines seligen Erstgeborenen. Kein «Mit Den [sic] Heiligen, Christe, lass ruhen, die Seelen Deiner Knechte, da wo kein Schmerz ist, kein Leid, kein Seufzen, sondern Leben ohne Ende».
An jenem Morgen voller Sonnenschein und Regen, als ich Giorgio nicht aus dem Schlaf wecken konnte, brach, was ich getan hatte, mit ganzer Wucht über mich herein und zerschmetterte mich. Ich wollte meine wertlosen Scherben aufs Kopfsteinpflaster werfen und von den Absätzen der Passanten zu Staub zerstampfen lassen, doch für Patricio musste ich sie wieder auflesen. Ich konnte nicht zwei Söhne im Stich lassen. Damals wusste ich noch nicht, dass ein gesegnetes drittes Kind unterwegs war, das, so Gott wollte, wieder ein Sohn sein würde.
Am Grab hielt ich Patricios schlafenden Körper so fest, dass die alte Iota mir die Arme auseinanderziehen musste, damit er nicht erstickte. An diesem Nachmittag atmeten wir zu dritt. Der Bauer, der die kleine Mulde unter seinen Quittenbäumen gegraben hatte und einen unverschämten Preis dafür verlangt hatte, weil er wusste, dass sonst nur noch das Meer infrage kam, weigerte sich, dabei zu sein, so als bliebe Gott seine Gier verborgen, wenn er sich im Haus versteckte. Während das Sonnenlicht auf uns herabfiel, wusste ich in meinem Herzen, dass nicht Gott meinen Sohn abgewiesen hatte, sondern dass es die Menschen gewesen waren. Vielleicht war dieser Gedanke auch eine Sünde. Vielleicht verlängerte ich meine Sündenliste noch, indem ich dreimal «Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher sei uns gnädig» sagte.
Als die alte Iota diese Worte aus meinem Mund dringen hörte, holte sie geräuschvoll Atem. Beide wussten wir, dass sie am Grab in den Mund eines Priesters gehörten. Doch was hätte ich in Anbetracht der Abwesenheit und Stille tun sollen? Giorgio war mein Kind und er war ein Kind Gottes. Ich wusste, dass beides stimmte. An jenem Tag hörte ich auf mein Herz, das eine vor Zorn hämmernde Faust war. Mein Herz öffnete mir den Mund. Auch wenn es nichts nützen sollte, verwendete sich mein Mund für meinen gesegneten Giorgio.
Patricio schlief, in meine Arme geschmiegt. Er musste gespürt haben, wie ich zitterte, als der Bauer endlich aus seinem Haus auftauchte und Erde, die sauberer war als er selbst, auf mein gesegnetes Kind schaufelte. Patricio muss gehört haben, wie die Sommererde auf die Myrtenblätter herunterbröselte und dann auf das Holzkästchen traf. Es hörte sich an wie ein plötzlicher Regenguss, sodass ich zum Himmel hinaufblickte. Den 17. August 1850, den Tag, an dem Giorgio entschlief, habe ich mir eingeprägt, doch das Herabregnen der Erde, als mein Gesegneter von mir genommen wurde und der Abstand zwischen seinem und meinem Körper endlos wurde, hinterließ tiefe Spuren. Worte und Zahlen vermochten nichts dergleichen.
Die Mütter in unserer Gasse – die zuvor so verschlossen gewesen waren und sich in ihre Verurteilungen gehüllt hatten – hatten Mitleid mit mir. Zu zweit und zu dritt kamen sie an meine Haustür und brachten mir ganze Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln, die in Lefkada zur Vergebung der Sünden gerade Verstorbener offeriert wurden. Ich kannte den Brauch, nicht jedoch, was sie mir offerierten. Abend für Abend warf ich die Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln mit den Gemüseabfällen fort. Jeden Morgen las die alte Iota sie wieder heraus, wischte die harten Schalen sauber und hob sie in einem sauberen Stoffbeutel auf. Nach nur einer Woche hatte sie genügend, um monatelange zu backen. Sie hatte eine Ader fürs Praktische, die sich bei mir noch nicht entwickelt hatte.
Ich fragte die alte Iota, ob sie wisse, was diese Mütter – ich sagte nicht ‹Mütter›, sondern ‹Hexen› – über sie sagten, wenn sie nicht dabei war.
Ohne den Blick von den Auberginenschalen und Tomatenkernen zu wenden, die sie mit den Fingern durchsuchte, fragte mich die alte Iota, ob ich wisse, dass die Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln nicht für Giorgios Sünden seien, sondern für meine. «Auf der Insel Santa Maura», sagte sie, «bringen die Hexen Zuckermandeln, wenn ein Baby stirbt.»
Die Frauen hatten mir eine Geschichte zugeraunt – so als kenne die alte Iota die Details ihres eigenen Lebens nicht und höre zufällig mit und erfahre etwas Neues –, die mit Iona, wie sie damals hieß, im Alter von sechzehn begann, der einzigen Tochter eines Witwers, der sie an den ältesten Sohn einer Bauernfamilie verheiratete, die einen Maultierritt entfernt vom Städtchen Lefkada lebte.
Iona begegnete ihrem Ehemann zum ersten Mal, als sie das Ehesakrament empfing. In einem Haus, das von einem Olivenmeer umgeben war, gebar Iona innerhalb von sechs Jahren fünf Jungen, doch alle hatten sie Herzen, die nicht länger schlugen als vier Wochen – das des letzten Sohnes schlug nicht einmal einen Tag lang.
Wie viele Schüsseln Zuckermandeln warf Iona fort, bis sie verstand, dass noch mehr kommen würden? Die Mütter in den Nachbarbauernhäusern boten sie ihr weiterhin dar, so war es Brauch in der orthodoxen Kirche, ein tief verwurzelter älterer Brauch, der eine praktische Seite hatte. Diese Mütter mit ihren abgearbeiteten Händen halfen Iona sanft auf den Rücken, sodass sie wieder eine von ihnen wurde. Sie hießen sie, die Hälfte der Zuckermandeln zu essen, damit sich deren Süße auf ihrer Zunge ausbreiten konnte, und dann die übrigen Mandeln ihrem Mann mit den Fingern in den Mund zu stecken. Bei diesen Worten errötete Iona. «Bald wird dich ein weiteres Baby beehren», sagten die Mütter. Um den tierischen Akt zu verbergen, den sie ihr wünschten, benutzten sie das Wort ‹beehren›. Iona tat, wie ihr geheißen wurde.
Ionas Letztgeborener starb, kaum dass er die Augen geöffnet hatte, und tat den letzten Atemzug, bevor er getauft worden war. Ionas Mann verließ sie und den Leichnam des Babys, das nun für immer allein im Fegefeuer sein würde, während seine vier älteren Brüder einander im Himmelreich Gesellschaft leisteten, vor der Eingangstür ihres Vaterhauses. Zu der Zeit begegnete Iona zum ersten Mal dem Quittenbauern, zwischen dessen Bäumen die kleinen Gräber versteckt waren.
Im Alter von zweiundzwanzig Jahren besaß Iona nichts. Als sie nach Lefkada zurückkehrte, gaben die Nachbarn ihr einen neuen Namen und ein neues Alter. Ihre Wangen wurden hohl. Sie bekam Hängebrüste und weiße Haarsträhnen. Die schwarzen Witwenkleider wurden ihr zur Gewohnheit und fortan hieß sie die alte Iota.
Als Charles die alte Iota einstellte, war sie achtundzwanzig und ich war sechsundzwanzig.
Wenn ich sie mitunter anstarrte, musste ich immer an die sechzehnjährige Iona denken. Dann inspizierte ich ihre Stirn, die wie ein Betttuch war, in dem jemand geschlafen hatte, sowie ihre knotigen, knochigen Hände, und fragte mich, ob sie sich von ihrem Mann jemals beehrt gefühlt hatte, ob die Süße je von Ionas Zunge in ihren übrigen Körper gelangt war. Immer wenn ich an das Tier dachte, das sie einst gewesen war, merkte ich, dass ich Charles vermisste, aber nicht mit dem Herzen.
Ich konnte meinem Mann nichts von meinen Gedanken über ihn schreiben, deshalb hob ich sie für die heilige Beichte in der Kirche von Santa Paraskevi auf, bei der der ehrwürdige Vater meinen Worten lauschte und ein Stöhnen unterdrückte.
Danach sprach ich das Bußgebet. Die letzte Zeile, «Lehre mich begehren und tun, was allein Dir gefällt», war eine ehrliche Bitte. Danach schloss ich die Augen und wartete. Der Körper, den ich im Dunkel sah, war nicht der von Charles und gewiss nicht derjenige des Ehrwürdigen Vaters, dessen langer Bart als Lätzchen für Zwiebackkrumen und Rotweintröpflein diente. Ich sah den Sohn Gottes, der vergoldete Glieder hatte, der langhaarig war und fraulich und seine Wunden ohne Scham zur Schau stellte. Seit ich ein kleines Mädchen gewesen war, hatte ich zu Seinen mit Nägeln durchbohrten Füßen gebetet, und Sein Körper war der erste Männerkörper, den ich zu Gesicht bekommen hatte. Wie hätte ich ohne das Bild von der Kreuzigung gewusst, dass ein Mann muskulöse Schenkel hat, einen straffen Unterleib und unter dem Tuch ein Geheimnis?
Elesa, bei ‹Unterleib› hast du gestockt. Hat deine Mutter – möge sie in Frieden ruhen – dir dieses Wort nie auf Venezianisch beigebracht? Du kannst es, wenn nötig, auf Englisch notieren. Patricio wird eines Tages wissen, was es bedeutet. Patricio wird es lesen, ohne rot zu werden. Auch Gott wird nicht rot werden. Meinst du, Er wird mir das Himmelreich verwehren? Du hast erst den Anfang meiner Geschichte gehört. Meine Liebe, wenn Gott mich abweisen will, dann aus anderen Gründen.
Nimm den Stift zur Hand. Um es dir anders zu überlegen, sind wir jetzt schon zu weit in der Irischen See. Eine Abmachung ist eine Abmachung.
Bist du sicher, dass du all die Schreibfedern und Tintenfässer parat hast, um die ich dich gebeten hatte? Es ist wichtig, dass du jedes Wort aufschreibst. Patricio wird mich eines Tages finden wollen, das weiß ich, und ich möchte, dass er weiß, wo er anfangen muss.
Zwei Monate nach Giorgios Geburt empfingen Charles und ich in dem fensterlosen Kirchlein Santa Paraskevi das Sakrament der Ehe. Dort zündeten wir unsere Hochzeitskerzen an. Dort band der Ehrwürdige Vater unsere rechten Hände zusammen. Er setzte uns Kränze aus frischen Myrtenblättern auf. Der Ehrwürdige Vater war ein Gottesmann, der klein von Gestalt war, sodass Charles sich niederknien musste, um den Kranz entgegenzunehmen. Darüber musste ich lächeln. Unser Vermieter und ein Metzger waren unsere Trauzeugen.
Das Städtchen Lefkada war mit Kirchen gesegnet. Ich hatte mir die Kirche Agios Spyridon erhofft, mit ihren hohen, runden Fenstern, die auf den großen Platz hinausgehen, oder die Kirche Pantokratoras mit ihren Rankengewächsen und anderen grazilen, schmiedeeisernen Verzierungen an jedem Fenster, doch Charles wählte Santa Paraskevi aus, weil der dortige Ehrwürdige Vater der einzige war, der eingewilligt hatte. Ein Einwand, den der Ehrwürdige Vater ignorierte, war Charles’ Glaube – die Kirche von Irland, die auch die deines Vaters ist, Elesa –, Gott habe ihn selig; Giorgio, der zu Hause in den Armen der alten Iota schlief; und mein gesegneter Zweiter, der ohne mein Wissen an jenem Nachmittag mit uns in der Kirche war. Patricio, du musst in mir gewesen sein, denn schon zu diesem Zeitpunkt hatte ich Heißhunger auf Meeresfrüchte.
Dieser Ehrwürdige Vater muss schwerhörig oder blind sein, hatte ich zu Charles gesagt, als er mir von der Abmachung erzählte. Charles erwiderte, das Einzige, was den Ehrwürdigen Vater plage, seien Armut und die Liebe zum heiligen Kommunionswein. Charles hatte ihm ein Fass Kephaliako zukommen lassen, einen Rotwein, der, weil er nicht gepanscht war, als der beste Wein von Santa Maura galt – und dann noch ein Fass und noch eines, bis der Ehrwürdige Vater ‹ja› gesagt hatte.
Nach einem frühen Abendessen – bei dem die alte Iota, die für uns kochte, einen Stifado ohne die übliche Knoblauchzwiebel zubereitet hatte, der mehr Rindfleisch enthielt als gewöhnlich, ein Hochzeitsgeschenk des Metzgers – ging Charles wie jeden Abend zurück in die Offiziersunterkunft. Das Haus hatte er nur für Giorgio und mich gemietet. Als mein Gesegneter in jener Nacht aufwachte, stillte ich ihn unter Schmerzen. Ich ging mit ihm in die Küche und sah die zwei Myrtenkränze, deren grüne Blätter sich bereits einrollten. Ich setzte mir beide auf. «Ich bin mit mir selbst vermählt», sagte ich laut – und war erschrocken über meine eigene Stimme. Und noch mehr über diesen meinen Gedanken. Noch nie hatte ich jemanden so etwas sagen hören, doch für mich klang es wahr. Zum zweiten Mal an diesem Tag musste ich lächeln.
Giorgio war wieder eingeschlafen, die Brustwarze noch im Mund, aber nur lose, wie am Ende eines Kusses. Der Schmerz verging nicht, was eigentlich bedeutete, dass meine Tage der blühenden Rosen kurz bevorstanden. Doch es sollte nicht sein, denn du, Patricio, solltest sein.
«Blühende Rosen» war ein Ausdruck der alten Iota. Als ich ihn das erste Mal von ihr geflüstert hörte, musste ich lachen. Ein Ehemann, fünf Söhne – mögen ihre Babys in Frieden ruhen – und immer noch redete sie, als sei sie Jungfrau.
Du siehst wie eine Pflaume aus, Elesa. Ist dir nicht gut?
Setz dich wieder hin, meine Liebe. Ich rate dir nicht, jetzt an Deck zu gehen. In den ersten paar Tagen einer Seereise rutschst du dort auf Erbrochenem aus. Mach nicht den gleichen Fehler wie alle, die zum ersten Mal reisen. An Deck «Luft zu schnappen» ist die Umschreibung für «sein Dinner auf Deck auszuleeren». Du darfst gleich nach dem Steward klingeln, Elesa. Eine Kanne Tee und ein Teller Shortbread wird unsere Mägen wieder in Ordnung bringen, doch jetzt machen wir noch ein wenig weiter.
Als ich siebzehn war, kamen die Rosen das erste Mal zu mir, erklärte ich der alten Iota. Von Anfang an wurden sie von einem Nachtfalter begleitet, der in meinem Rock gefangen war und mit den Flügeln flatterte. Als ich die alte Iota fragte, ob es bei ihr auch so sei, verbarg sie ihr Gesicht in den Händen. Ich hatte keine Mutter und dachte daher, ich würde sterben. Während ich weiterlebte und weiter aufblühte, verwandelte sich die Gleichgültigkeit, die mein Vater mir gegenüber an den Tag legte, in Abscheu und Scham darüber, dass ich so wenig wusste. Dieser Wandel sollte bald mein Leben verdunkeln: Er war das Tuch über dem Vogelkäfig.
Zuerst verbot mein Vater meinen Brüdern, ihre Schulfreunde mit ins Haus zu bringen – nicht einmal den Spätnachmittagsunterricht im Schatten des Innenhofs durften sie zu Ende absolvieren. Er hielt inne und dehnte die Einschränkung sogar noch weiter aus. «Ebenso wenig dulde ich eure Freunde an den Eingangstüren zur Villa Cassimati», erklärte er. Mein Vater nannte das Haus beharrlich ‹Villa›, und um es von den Nachbarhäusern zu unterscheiden, die echte Villen waren, versah er es mit seinem Familiennamen, als sei es ein weiterer Sohn. Meine Brüder nickten unisono mit den Köpfen. Weil sie jetzt einen Grund hatten, anderswo hinzugehen, erhoben sie keinen Einspruch. Ihre Schulkameraden gehörten zu den wenigen Gästen des Hauses. Ihre Gesichter sollte ich mehr vermissen als meine Brüder.
Als Nächstes verweigerte mir mein Vater das Dämmerlicht von Mond und Sternen. Die Läden meines Schlafzimmerfensters mussten Tag und Nacht geschlossen bleiben. «Insbesondere nachts», sagte er zum zweiten Mal. Meine Brüder stießen einander in die Rippen. Dieser raue Umgang drang wie ein Dolch in mich ein. Mir kam zu Bewusstsein, dass meine Brüder Geheimnisse hatten und dass ich wieder einmal nicht eingeweiht war. Mir wurde bewusst, wie einsam ich in diesem Haus war.
Damals verbot mir mein Vater, die Villa Cassimati zu verlassen – nicht einmal die Köchin Kanella durfte ich morgens auf den Markt von Kapsali begleiten. «Aber woher soll Kanella dann wissen, was sie kaufen muss?», wandte ich ein.
«Dort gibt es nichts Neues», sagte mein Vater. Mit ‹dort› meinte er den Markt, er hätte aber ebenso gut von der gesamten Stadt Kapsali oder der ganzen Insel Cerigo sprechen können. «Kanella kauft dasselbe wie immer. Sie kocht dasselbe wie immer. Wir werden dasselbe essen wie immer», sagte mein Vater, ohne auch nur ein einziges Mal von seinem Buch aufzublicken, das immer dasselbe war, das sah sogar ich. Wenn mein Vater sich nicht als Echo gerierte, dann redete er im Kreis herum – eine Schlange, die sich in den Schwanz biss.
Die nächsten acht Jahre bekam ich von meinem Vater alles verboten – bis auf die Villa Cassimati und eine Kirche in der Fortezza. Ich hätte sie mit geschlossenen Augen gefunden, durfte aber nur an Sonntagen, kirchlichen Festtagen und am Osterfest in Begleitung meines Vaters oder meiner Brüder dorthin gehen.
Es kam so weit, dass ich das Haus, in dem ich geboren worden war, verabscheute, samt dem Innenhof mit den orangefarbenen Bougainvilleen und dem ausladenden Feigenbaum, dessen Blätter das Sonnenlicht in Goldstücke verwandelten. Am meisten ärgerte ich mich über die Vögel, die in Scharen kamen, wenn die Feigen reif waren. Die Früchte an den obersten Ästen waren die dicksten, weil sie am meisten Sonne bekamen, doch Kanella gab sich nicht mit ihnen ab. «Wir haben genug», beharrte sie hartnäckig und wedelte mit der Hand vor dem Gesicht hin und her. «Sollen die Vögel sie fressen», sagte sie.
Kanella kam vom Land, und dort glaubte man, dass nicht alles abgeerntet werden dürfe. Die Bauern, wie mein Vater und meine Brüder sie nannten, ließen den Vögeln immer etwas von der Ernte übrig, von den Früchten der Bäume ebenso wie von den Reben. Dafür kamen die Vögel und pickten sie auf, vor Hunger und Dankbarkeit krächzend. Diese Geschöpfe hatten den Innenhof im Nu mit ihren ausgefallenen Federn und klebrigen Fleischstücken übersät, die bei genauerem Hinsehen die von Schnäbeln und Krallen auseinandergerissenen, rosa Innereien reifer Feigen waren. Dann erhoben sich die Vögel wieder und verschwanden – ein dunkles Schultertuch, das der Wind in die Höhe hob.
Ich sah ihnen nach und weinte. Als ein Jahr vorüber war und ich verstanden hatte, dass die Vögel frei waren und ich nicht, begann ich ihre Federn zu sammeln. Wenn ich genügend davon hätte, würde ich sie mir auf die Kleider nähen und auf die Schuhe kleben. Um vom Fliegen zu träumen, war ich mit achtzehn zu dumm und zu beschränkt. Ich wollte nur mein freudloses Federkleid tragen und mich hinlegen und sterben, als Vogel, der die Schlacht um die süßesten Früchte verloren hatte.
Damals wusste ich noch nicht, dass alle Frauen bluteten.
Schreib das nicht, Elesa.
Wenn ich es mir recht überlege: Schreib es bitte doch.
Patricio soll den Körper kennen, den Gott den Frauen geschenkt hat.
Kanella wusste es, sagte mir aber nichts davon. Sie gab mir Lappen. Wenn sie durchnässt waren, gab sie sie zum Waschen fort. Immer wenn man auf der Rückseite meiner Kleider die Blumen sah, scheuchte sie mich in mein Zimmer. Auf ihren täglichen Spaziergängen sammelte sie Kamillenblüten und trocknete sie zu Kamillentee, den ich trank, wenn der Schmerz mich übermannte. Doch was ich am nötigsten gebraucht hätte, gab Kanella mir nie: Sie sagte mir nicht, dass das Haus meines Vaters nicht mein Gefängnis sei. Der Körper, den Gott mir gegeben hatte, war mein Gefängnis, und in diesem Körper lagen Schloss und Schlüssel. Kanella wusste das.
An meinem fünfundzwanzigsten Namenstag erklärte mir Kanella am Morgen, ich dürfe fortan in der Kirche der Fortezza am Gottesdienst der Tagzeiten teilnehmen. Genauer gesagt am Stundengebet der dritten Stunde, das morgens um neun Uhr begann, der Stunde, zu der Pontius Pilatus sein Urteil wider Christus verkündet hatte. Kanellas Worte verblüfften mich. Mein Vater und meine Brüder waren morgens nie zu Hause, was Kanella natürlich wusste.
«Aber wer wird mich begleiten?», fragte ich sie.
«Du kannst allein gehen», erwiderte Kanella, «dein Vater hat seine Einwilligung erteilt.»
Bei dem Gedanken, dass sich das Eingangstor meines Vaterhauses öffnen und mein Körper ganz allein hinausschlüpfen würde, stand ich mit offenem Mund vor Kanella.
Sie blickte mich mit leeren Telleraugen an.
Damals verstand ich Kanella kaum und wäre nie darauf gekommen, dass sie mich voll und ganz verstand. Kanella war keine alte Frau. Sie hatte olivenölglatte Wangen und war nicht hässlich. Jeden Tag kochte sie Gerichte, die uns und besonders meinem Vater sehr mundeten. Ich wusste allerhand über sie, jedoch nicht, was all das für mich bedeuten würde.
Wie mein Vater mir angekündigt hatte, begab ich mich auf die Reise von seinem Haus in Sein Haus. Wenn man die Villenstraße nahm, lagen beide Häuser so dicht beieinander, dass vier Apfelbisse mich von der einen Haustür zur anderen brachten – was ich jedoch auf diesen einsamen Gängen sah, roch und hörte, befreite mich von den Federn und von einem Leben, in dem ich einzig darauf wartete, dass noch mehr Federn ausfielen.
Der Duft, der am späten Vormittag wie feuchte Wäsche in der Villenstraße hing, war derselbe wie der, der aus Kanellas Küche drang: Es roch nach Zwiebeln und Olivenöl. Bis zum Mittag hatte sich die ganze Insel in einen Topf schmelzender, milder Zwiebeln verwandelt. Die Mittagsmahlzeiten aller Cerigoten basierten auf diesen beiden Zutaten. Als ich das zur alten Iota sagte, erklärte sie, ohne Zwiebeln und Öl sei Cerigo für sie nicht echt. Wenn ich ihr von der Insel erzählte, auf der ich geboren worden war, sah sie mich oft mit großen Augen an. Auch Neid lag dann in ihrem Blick. Die alte Iota fand es kühn von mir, dass ich ein Schiff bestiegen hatte und davongefahren war, weit weg von meinen Familienangehörigen und der steinigen Erde, in der sie irgendwann alle begraben werden würden. Sie wusste, warum ich aus Cerigo hatte fortgehen müssen. Trotzdem bestand sie darauf, dass ich kühn sei. Sie war nie in die Ferne gereist und wusste weder, wie leicht Abreisen sein konnte, noch, dass Feiglinge immer fortgehen.
In der Villenstraße blieben auch all die Düfte hängen, die auf Zwiebeln und Öl folgten: Thymian- und Lorbeerduft aus Kanellas Küche, Tomatenduft aus der Villa Lazaretti und der Duft nach Wein aus der Villa Venieri. Danach roch es nach Lamm, Fisch und Rindfleisch. In den Villen der Adeligen, Kleinadel und anderer, musste niemand hungern.
«Wir können unsere Blutlinie bis zur Republik Venedig zurückverfolgen», rief mein Vater meinen Brüdern jedes Mal ins Bewusstsein, wenn er hörte, dass sie sich ihre Sprache ‹verdarben›, indem sie Neugriechisch redeten, eine Sprache, die man auf dem Land sprach, im Landesinneren, die Sprache derer, die Zwiebeln und Öl rochen und wussten, dass es nichts anderes gab, was sie in ihre Töpfe hätten tun können. «Wir sprechen die Sprache unserer Vorfahren», befahl mein Vater, und meine Brüder gehorchten.
Kanella verstand Venezianisch, sprach aber meist Neugriechisch. Ich wusste nicht, dass es sich um zwei verschiedene Sprachen handelte, da ich sie beide in meinen ersten Lebensjahren gelernt hatte. Nach ihrer Entwirrung wurden sie zur Sprache der Reichen und zur Sprache der Armen. Weil Kanella meine Kinderfrau war, wuchs ich mit beiden Sprachen auf. Als meine Mutter noch lebte, war meinen Brüdern zufolge das ganze Haus voller Dienstboten gewesen, die nach und nach entlassen wurden, bis nur noch Kanella übrig war. Mein Vater befreite die Villa Cassimati von allen Leibern, die ihn an seine junge Frau und ihren einst geschäftigen Haushalt erinnerten, und behielt nur die Köchin, seine Söhne und mich. Der Tod war für die meisten Männer Anlass zur Trauer. Meinen Vater brachte der Tod dazu, böse auf die Verstorbene und auf diejenigen zu sein, die weiterlebten. Wenn meine Brüder grausam gestimmt waren, sagten sie zu mir, ein Fieber habe dem Leben unserer Mutter ein Ende gesetzt, meine Geburt jedoch habe sie zuvor geschwächt.
Als meine Brüder noch ins Bett machten, redeten sie manchmal über unsere Mutter. Sie sprachen prahlerisch und hochmütig vor mir, auf dieselbe Art, wie sie später einander in meiner Anwesenheit vorlasen, in dem Wissen, dass ich nicht mitmachen konnte. Sie sagten Folgendes über unsere Mutter – mit ‹unsere› meinten sie sich. Sie habe langes schwarzes Haar gehabt. Sie sei schön gewesen. Und traurig. Sie habe sie oft umarmt, sie aber auch manchmal heftig und ohne Grund geschlagen. Sie habe ihnen jeden Abend dasselbe Wiegenlied vorgesungen, bis sie eingeschlafen seien, behaupteten aber, sich weder an die Melodie noch an den Text des Liedes erinnern zu können. Soviel ich weiß, erzählten sich meine Brüder Lügengeschichten.
Ich hätte wirklich gerne gewusst, wie das Haar meiner Mutter gerochen hatte. Ich hoffte, nach Lavendelwasser, denn das tat mir wohl an den Schläfen, wenn sie pochten. Ich wollte ihre Augenfarbe wissen und hoffte auf Dunkelbraun mit einem grünen Ring, so wie meine Augen. Ich wollte ihre Stimme hören und ich wollte sie ausatmen hören.
Was wird mein gesegneter Zweiter von mir in Erinnerung behalten?
Patricio, wenn du das hier liest, musst du ein Vogel sein.
Wenn mein gesegneter Dritter ein Junge wird – bitte, lieber Gott, bring ihn nicht auf den Wassern der Meere zu mir, sondern lass ihn warten, bis wir in Santa Maura sind, der Insel, auf der seine Brüder geboren wurden –, dann muss er ebenfalls ein Vogel sein. Für die beiden muss ich mir das Fliegen vorstellen.
Während meiner Jahre im Haus hatte ich mir nichts vorgestellt – ich wachte auf, aß und schlief –, und meine Wörter wurden stumpf und fad. Als ich sie wiederfand, war mir, als verstünde ich zum ersten Mal ihre Bedeutung. Es gab die Freude am ‹Sonnenlicht›, dem keine Blätter und Blüten im Weg standen. Die Strahlen, die zwischen das Haus meines Vaters und die Kirche in Fortezza fielen, waren scharfe Nadeln, die sich in den Stoff meines Kleids und ins Stroh meiner Haube bohrten. Es gab die Freude am eigenen ‹Atem›, an meinen eigenen ‹Schritten›, meinem ‹Körper›. Da war die Freude an den ‹Glocken›, wenn die Kirchenglocken zu läuten anfingen und kurze Zeit später der Klang der Glocken von Kapsali sich hinzugesellte. Die dicken Mauern meines Vaterhauses hatten selbst diese Glocken gedämpft. Mit meinem ganzen Körper spürte ich jetzt wieder ihr Läuten, und es fühlte sich so an, als sei ich von einem hin und her wogenden Meer umgeben.
Als ich ganz klein gewesen war, hatten mich zwei Hände ins Ionische Meer getaucht, mich losgelassen und dann wieder herausgezogen. Ich erinnere mich an diese Bewegungen, die sich immer wiederholten und möglicherweise viele Male stattgefunden hatten. Ich erinnere mich auch, dass man mich auf die Felsen zutreiben ließ. Ich weiß noch, dass ich immer nur eine Armlänge entfernt war. Man brachte mir Schwimmen bei, sage ich mir. Ich war nicht ans Meer gewöhnt. In Wahrheit sind mir nur der Sog der Meeresströmung und die dagegenhaltende Kraft der Hände im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, dass es sich um eine Erinnerung meiner Mutter handelt. Ich habe meinen Brüdern nie davon erzählt, weil sie mir meine Erinnerung sofort weggenommen hätten. Weil die Hände stärker waren als das Meer, halte ich diese Erinnerung für echt.
Patricio, ich wünschte, ich hätte dir das Ionische Meer geschenkt. Als Giorgio zu Gott ging, hatte ich daran gedacht, dich, meinen gesegneten zweiten Sohn, an die Küste hinunterzubringen, doch die alte Iota war besorgt. Sie fand, ich sei noch zu schwach. «Deine trauernden Arme gegen die Meeresströmung?», spottete sie.
Sie hatte recht. Ich war schwach. Ich konnte dich ja kaum von meiner Brustwarze lösen.
Was geschehen ist, kann ich nicht ungeschehen machen, und ich kann auch nicht tun, was nie getan worden ist. Das Meer, das du nie berührt hast, wird ebenso auf dich warten wie du auf das Meer, Patricio.
Wenn ich so etwas sage, klinge ich wie mein Vater. Vielleicht bin ja jetzt ich die Schlange, die sich in den Schwanz beißt.
Als ich in die Kirche in der Fortezza zur Messe der dritten Stunde gehen durfte, war ich fünfundzwanzig Jahre alt, doch ebenso unwissend wie mit siebzehn, als man mich zum ersten Mal einsperrte.
Du brauchst nicht die Stirn zu runzeln, Elesa. Ich weiß, wie alt du bist, aber mit deinen siebzehn Jahren bist du nicht unwissend. Du kannst lesen und schreiben. Trotz allem, was sich kürzlich ereignet hat, bist du gesegnet. Mit der Kenntnis des Alphabets hast du Federn und kannst fliegen. Ja, lächle ruhig. Der Gedanke verdient ein Lächeln.
Ich war ungebildet, hatte mich aber verändert.
Mein Körper hatte die Nähte meiner Mädchenkleider aufplatzen lassen. Die Rocksäume wurden heruntergelassen, Abnäher und Smockstickereien wurden aufgetrennt und Stofffetzen und Bänder angenäht, um die Ärmel länger und den Ausschnitt weiter zu machen. Ohne Kanella wäre es mit diesen provisorischen Änderungen immer so weitergegangen. Sie erklärte mir, mein Vater sei einverstanden, dass meine Garderobe ergänzt würde. Obwohl sie es nicht sagte, war mir klar, dass ich für Gott eingekleidet wurde. Näherinnen kamen in die Villa Cassimati und nahmen Maß für drei Tageskleider und ein viertes mit einem blassgrauen hochgeschlossenen Spitzenausschnitt, das für kirchliche Festtage und für das Osterfest gedacht war. Ich bekam auch ein Korsett, sechs Unterröcke und fünf Damenhemden. Auch eine Strohhaube wurde der Bestellung hinzugefügt.
Die erste Näherin, die ins Haus kam, schluchzte, als sie mich sah. Kanella war über den Ausbruch der Frau ebenso überrascht wie ich. «Sióreta Cassimati sieht aus wie … sieht aus wie … eine Zwillingsschwester ihrer Mutter», brachte die Näherin schließlich keuchend und schluckend hervor. Ich hörte, wie Kanella die Frau zum Hinterausgang führte und zum Schweigen brachte. Als Kanella zurückkam, sah sie mich im Hof unter dem Feigenbaum liegen, um dessen Stamm gekrümmt wie eine Made. Noch nie hatte ich irgendjemanden ein Wort über unsere Mutter sagen hören, abgesehen von meinen Brüdern. Bis heute weiß ich noch nicht einmal ihren Vornamen.
Elesa, ich sehe es deinen Schultern an, die aussehen, als hätte sie jemand mit einem Seil hochgezogen. Du willst mich unterbrechen, wie die alte Iota, als ich ihr diese Geschichte erzählte.
«Wo war die Familie deiner Mutter?», wollte die alte Iota wissen. Auf alle ihre Fragen zu meiner Familie mütterlicherseits hatte ich mit ‹Malta› geantwortet. Ich wusste, dass es der Name der Insel war, auf der meine Mutter geboren worden war und auf der ihre Angehörigen immer noch wohnten. Viel mehr wusste ich nicht. Ich sagte ‹Malta›, wie andere Menschen ‹Tod› sagten. Beides bedeutete einen Bruch. Immer wenn die alte Iota ‹Malta› hörte, bekreuzigte sie sich dreimal, so als wollte sie sich vor einem Fluch schützen.
Die alte Iota vertraute mir an, dass sie sich jedes Mal, wenn ihr ein Sohn entschlief, mit dem ganzen Körper um die Bäume auf dem Bauernhof ihres Mannes geschlungen hatte. Je älter der Olivenbaum war, je knorriger sein Stamm war, je länger er in dem mageren Boden überlebt hatte, desto mehr wollte sie ihren leeren, schmächtigen Körper um den Baum schlingen.
Noch vor Ende unserer Reise werden wir Malta sehen, Elesa. Wenn wir die Irische See durchfahren haben, legen wir ein paar Tage in Liverpool an. Dann wird das Schiff die lange Fahrt südwärts nach Malta antreten, wo wir wieder anlegen werden.
Auf der Hinreise – an diese Reise wirst du dich nicht erinnern, Patricio, weil du damals erst zwei Jahre alt warst – erfuhr ich, dass wir, die Passagiere, auf der Fahrt nach Dublin keine wertvolle Fracht waren. Die Fässer mit Rotwein und getrockneten Korinthen dagegen schon. Ich weiß nicht, was für Waren aus Dublin oder Liverpool wir auf der Rückreise geladen haben. Gewehre, Sonnenschirme und Sattelseife, vermute ich.
Nach Malta ist die Insel Santa Maura je nach Windverhältnissen nur noch ein paar Tage entfernt.
Elesa, ich weiß, dass du dich nicht an Santa Maura erinnerst, aber sobald du es am Horizont siehst, wirst du es wiedererkennen. Deine Mutter ist dort geboren, deshalb ist es dir in Fleisch und Blut übergegangen, und du siehst die Konturen dieser Insel deutlicher als auf der Landkarte. Wenn Patricio je diese Reise Richtung Süden unternimmt, wird es ihm ebenso ergehen. ‹Cerigo› wird er sagen und damit ‹Mutter› meinen.
Wir sind noch wochenlang entfernt. Du kannst dich also in Ruhe vorbereiten, Elesa. Beide haben wir sehr viel Zeit.
Als Erstes werde ich die alte Iota suchen. Wenn sie sieht, dass Patricio nicht bei mir ist, wird sie weinen. Sie wird glauben, er sei zu Gott gegangen, wie sein älterer Bruder. Ich werde ihr die Kalotypie von ihm zeigen, damit sie Gewissheit hat, dass er lebt. Sie wird das Bild auf dem Blatt Papier erst nicht verstehen, genau wie ich, als Patricios Großtante es mir zum Abschied schenkte. Doch die alte Iota wird lernen, das Bild als das zu sehen, was es darstellt: einen kleinen Jungen, der die großen, runden Augen und die Raupenaugenbrauen seines Vaters hat und das dunkle, wellige Haar seiner Mutter, der mit seinen vier Jahren stämmig dasteht und starr nach vorne blickt, so als wollte er sagen: «Leben, ich warte auf dich.»
Die alte Iota zu finden wird mir nicht schwerfallen. Sie und ihre Geschichte sind in der ganzen Stadt Lefkada bekannt. Ihr Kummer ist allüberall ihr Zwilling. Er packt sie an der Hand. Er klammert sich an ihren Hals und ihren krummen Rücken. Auf diese Weise ist sie nie allein. Gefährten wie diese, die aus Kummer, Verlust, Tragödien und Scham entstehen, folgen oftmals Frauenkörpern. Die Männer werden diese Gefährten los, indem sie weit weg reisen, sie in fremden Gefilden erdrosseln oder im tiefen Wasser ertränken.
Auf dem Schiff von Cerigo nach Santa Maura brachte Charles mir das englische Wort ‹Tratsch› bei. Er sagte zu mir, in unserem gemeinsamen Leben müsse ich den Tratsch ignorieren und dürfe unter keinen Umständen mittratschen. Später verstand ich, dass er mit Tratsch die Zwillinge meinte. Die Bewohner meiner Insel und diejenigen von Santa Maura gäben sich dem Tratsch hin wie Mädchen mit einer Schwäche für Süßigkeiten. «Das Gewicht wird sie noch erdrücken», erklärte er in seinem gestelzten, oft unverständlichen Venezianisch.