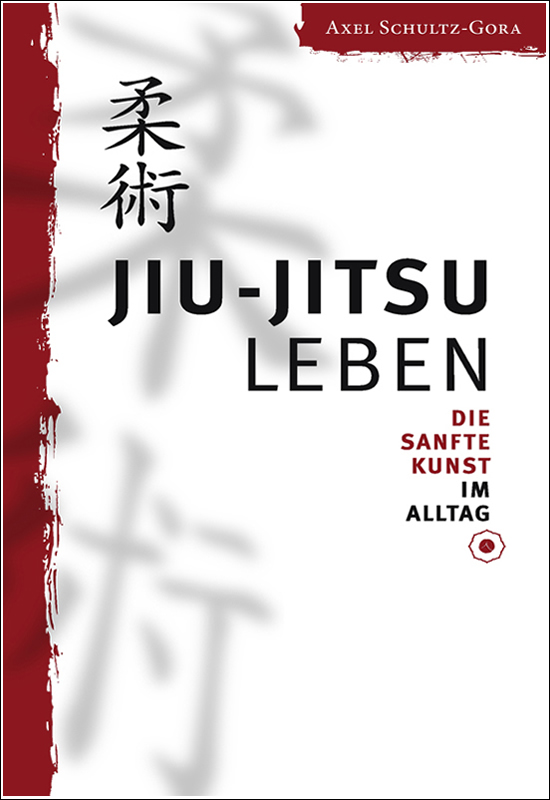
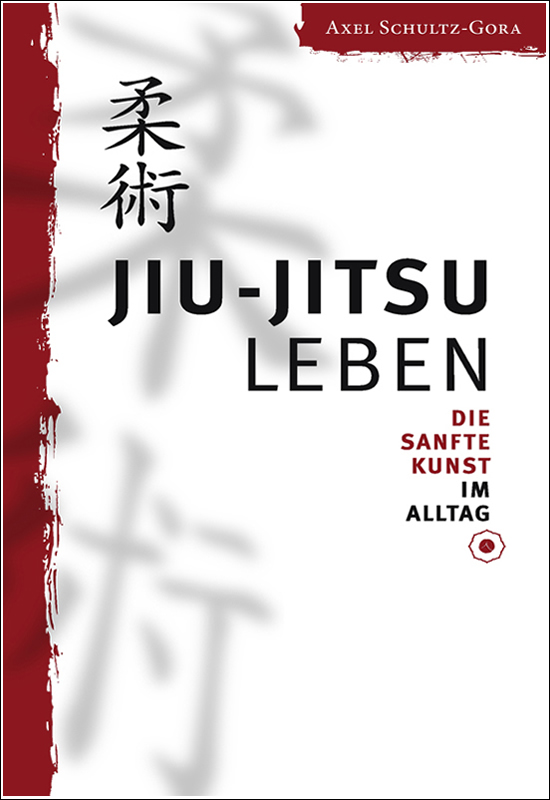
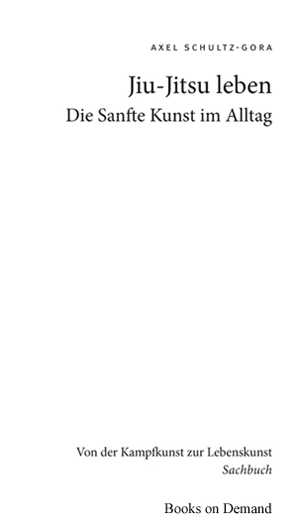
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2011 – Axel Schultz-Gora, Augsburg
Lektorat und Korrekturen: Valeska Lembke
Satz und Lay-Out: Barbara Litza
Umschlaggestaltung: Harald Sianos, designbuero7
Herstellung und Verlag: Books on Demand GmbH, Norderstedt
ISBN 978-3-8448-7512-6
IN MEMORIAM
Horst Weiland, 10. Dan Jiu-Jitsu,
Gründer der Budo-Akademie-Europa
für die Integration der europäischen
Mentalität in das Jiu-Jitsu
 |
Jede Rohheit hat ihren Ursprung |
Seneca, 1–65 n. Chr. |
|
 |
Wahre Selbstverteidigung ist nicht |
Morihei Ueshiba, 1883–1969 |
|
 |
Man glaubt, |
Horst Weiland, 1928–2007 |

EINFÜHRUNG
FÜR WEN DIESES BUCH IST
Vom passenden Titel
Shu-Ha-Ri
Ethik und Spiritualität
Ein Kreis schließt sich
Anmerkung zu den Fachbegriffen
TEIL I
JIU-JITSU ALS KAMPFKUNST
SCHLAGLICHTER AUF JIU-JITSU
Jiu-Jitsu – Die „saénfte Künst“
Sanfte Bürger gegen harte Krieger
Mutter und Stiefkind
Jiu-Jitsu in der zeitgenössischen Literatur
Verbindender Geist
Freie Entfaltung und Struktur
Seiho Jiu-Jitsu vs. Nihon Jūjutsu?
Wenn Ryū in Verruf geraten
Viele Familien
DIE SANFTE KUNST NEU INTERPRETIEREN
Siegen durch Nachgeben – eine Weisheit
Frieden und Freundschaft
Jiu-Jitsu – die Wegkunst ohne Dō
Wabi-Sabi und Imponiermuster
Die Crux der Tradition
Vom Schüler zum Meister I
Jiu-Jitsuka – Garten und Gärtner in einem
Exkurs in die farbige Gürtelwelt
Vom Schüler zum Meister II
Vom Meister zum Großmeister
Vom Großmeister zum Schüler
TEIL II
JIU-JITSU ALS LEBENSKUNST
VOM BUDŌ ZUM DŌ
Bu – Kleine Silbe mit großer Bedeutung
Feudale Marionetten
Glorifizierung der Samurai
Mechanismen der Glorifizierung
Die modernen Nachfolger der Samurai – Die Militärpolizei und die Kaiserliche Japanische Armee
Der Bushi schwarze Seele – Fünf Kriegsverbrechen
I – Marschieren oder sterben – Der Todesmarsch von Bataan
II – Der Schienenstrang des Todes
III – 105:106 Enthauptungen mit einem Katana – Das Massaker von Nanking
IV – „Im Namen der Wissenschaft“ – Die Einheit 731
V – Das Schwert im Nacken – Trostfrauen
Seppuku – Kamikaze – Karōshi – Drei Mal Bushidō
Seppuku – Tod durch Schmach
Kamikaze – Tod im Sturzflug
Karōshi – Tod durch Überarbeiten
Dō und Wortschatz
Freude und Freundschaft statt Perfektion und Kampf
Loslösen vom Kriegerischen
Dō – Entscheidung für den Frieden
JIU-JITSU IM ALLTAG LEBEN
Jiu-Jitsu und die Kunst der Energie
Weniger ist mehr
Die Lebensblüte
Die acht Lebensbereiche
Die acht Hauptenergien
Die bewusste Reduktion
Die große Werteliste
Das Wertekaro
Nachwort
ANHANG
GLOSSAR
BIBLIOGRAFIE
AUTOR
DANKSAGUNG

DER LESER ERFÄHRT, WO DER AUTOR UND SEIN BUCH STEHEN, WAS ER VON IHNEN ZU ERWARTEN HAT UND WAS SIE VON IHREM LESER ERWARTEN. ER LERNT, AUF DIE GENAUE BEDEUTUNG DER WORTE ZU ACHTEN UND WIRD EINGELADEN, SICH BEI DER SUCHE NACH SEINEM EIGENEN WEG UNTERSTÜTZEN ZU LASSEN.
Dieses Buch ist nicht, wie der Titel vermuten ließe, nur für Jiu-Jitsuka geschrieben. Sie werden zwar vorrangig angesprochen, doch die Themen sind weitreichend und im Grunde für Budōka sämtlicher Disziplinen wertvoll. Dennoch wäre der übergreifende Titel ‚Budō leben’ falsch. Die Inhalte dieses Buches lassen sich nicht uneingeschränkt auf alle Budōkünste und deren Anhänger übertragen. Sie beziehen sich auf die waffenlosen Kampfkünste, im Besonderen auf die Kampfkunst Jiu-Jitsu und bei dieser wiederum speziell auf die Stilrichtungen (Ryū), deren Wurzeln bei der sogenannten Weidenherzschule, dem Yōshin-Ryū-Jiu-Jitsu, liegen. Laut Überlieferung soll eben jene Weidenherzschule des Arztes Shirobei Yoshitoki Akiyama aus dem 17. Jahrhundert die Maxime ‚Nachgeben, um zu siegen’ wenn nicht unbedingt originär hervorgebracht, so doch primär kultiviert haben. Diese Maxime gilt heute als die Jiu-Jitsu-Maxime. Es ist zudem wesentlich, dass das Yōshin-Ryū-Jiu-Jitsu, auf dessen Nachgeben-Philosophie sich die weltweite Jiu-Jitsu-Gemeinschaft beruft, keine feudale Samuraikunst ist, sondern – und das ist ein gewichtiger Aspekt – von Bürgerlichen entwickelt wurde zum Schutz gegen die Willkür und den Machtmissbrauch der Samurai. Dieser Punkt ist vielen Jiu-Jitsuka und auch anderen Budōka nicht bekannt oder zumindest nicht bewusst. Das Kapitel „Sanfte Bürger gegen harte Krieger“ erläutert dies näher.
Budō heißt richtig übersetzt ‚Der Weg des Krieges’ und nicht wie meist fälschlich übersetzt ‚Der Weg des Kriegers’, oder im spezifischen Sinn ‚Der Weg des Samurai’.
Ist das Haarspalterei? Führt es nicht auf dasselbe hinaus? Der Weg des Kriegers ist doch der Weg des Krieges. Was macht das für einen Unterschied? Für Menschen, die wenig differenzieren können, mag es keinen Unterschied machen, doch für alle diejenigen, die etwas empfindsamer und feinfühliger mit der Sprache und dadurch mit dem Leben – denn die Sprache ist ein prägender Teil des Lebens – umgehen, macht es sehr wohl einen Unterschied. Der Titel ‚Budō leben’ würde ‚Den Weg des Krieges leben’ bedeuten. Was könnte man darunter verstehen? Welchen Weg geht der Krieg? Wie lebt man diesen?
Jeder von uns hat ein eigenes Bild vom Krieg. Der Großteil meiner Generation, die in den 1960ern groß wurde, kennt ihn lediglich aus den Erzählungen der Eltern und Großeltern, aus der Literatur, aus Dokumentar- und Spielfilmen und in neuerer Zeit aus der Berichterstattung der Medien über den Irak-Iran-Konflikt, die Krisensituationen im Jemen oder in Afghanistan. Viele von uns waren bei der Bundeswehr und haben dennoch nie einen Krieg erlebt. Anders jene, die tatsächlich in Kriegsgebieten zum Einsatz kamen. Aus zahlreichen Berichten weiß man nicht erst seit dem Vietnamkrieg, dass die meisten Soldaten, die unmittelbar mit den Gräueltaten des Krieges konfrontiert wurden und diese überlebten, traumatisiert sind.1
In jedem Menschen steckt das tiefe Bedürfnis nach Frieden. Es beginnt beim inneren Frieden mit sich selbst und reicht über den familiären und häuslichen Frieden, den Frieden in der Nachbarschaft, in der Straße, dem Wohnviertel, den Frieden in der Stadt und im Land bis zum Frieden unter den Völkern, dem Weltfrieden.
Von dem tiefen Bedürfnis nach Frieden und dessen heilsamer Wirkung ausgehend und eingedenk der Herzlosigkeit und Brutalität des Krieges an sich kann der Titel dieses Buches niemals ‚Den Weg des Krieges leben’ meinen.
Auf die übertragene und spezifische Übersetzung von Budō als ‚Der Weg des Samurai’ bezogen, würde der Titel ‚Budō leben’ bedeuten: ‚Den Weg des Samurai leben’. Dieser Titel wäre wohl für manchen Budōka reizvoll, da er sich durch seine Kampfkunst mit den Samurai identifiziert. Die Motive für Identifikationsmuster mit Samurai, Kriegern, Soldaten, überhaupt Helden aller Arten sind verschieden und komplex, sie sind aber psychologisch bereits eingehend erklärt und lassen sich vereinfachend als soziologische Grundbedürfnisse zusammenfassen. Dazu gehören etwa Persönlichkeitsbildung und Ausrichtung im Leben, das heißt die Orientierung des Ich im sozialen Wertesystem, Abgrenzung und Gleichstellung mit anderen, Anerkennung von außen durch Status und diverse Formen von Machtbedürfnissen.2 Die schmückenden Attribute wie ehrenhaft, ehrenvoll, heldenhaft, achtbar, rühmlich oder glorreich, die man den Samurai seit jeher anheftete, sind der Befriedigung dieser Grundbedürfnisse dienlich, doch dürfen sie nicht über die kriegerische Natur der Samurai und damit über deren friedensethische Verfehlungen hinwegtäuschen. Also auch bei der übertragenen Übersetzungsinterpretation wäre der Titel ‚Budō leben’ unpassend, denn dieses Buch will von den Samurai, im Besonderen von deren kriegerischer Gesinnung wegführen und nicht zu ihnen hin. Warum, wird sich dem Leser im Verlauf der Lektüre noch eingehender erschließen.
Abhandlungen über Budō und die Samurai boten und bieten bislang in der einschlägigen Kampfkunstliteratur kein ausgewogenes Bild der feudalen Kriegerkaste; angefangen von Inazō Nitobes verklärender Schrift „Bushidō – Die Seele Japans“, die erstmals 1903 in deutscher Sprache erschien, bis zu seinen zahlreichen heutigen Nachfolgern und deren Abspaltungen in der Businessliteratur. Die meisten Autoren, selbst Anhänger der Samuraigesinnung, blenden die überwiegend negativen Aspekte dieser Kriegerkultur aus oder verharmlosen sie. Schlimmstenfalls kehren sie sie ins Gegenteil und glorifizieren sie – prägnante Beispiele dafür werden im Laufe des Buches folgen. Diese einseitige Darstellung dominiert den Buchmarkt, wie die Literaturliste im Anhang deutlich macht. Um diesem Missstand entgegenzutreten, schlägt ein Teil dieses Buches den gegenläufigen Weg ein; es beleuchtet die Schattenseiten der Samurai und will dazu beitragen, ein erweitertes und durchaus kritisches Bewusstsein gegenüber Budō und den Samurai zu schaffen. Das ist aber nur ein Aspekt dieses Buches. Es will in erster Linie dem spirituell interessierten Jiu-Jitsuka Wege aufzeigen, seine Kampfkunst nicht als bloßen Mattensport auszuüben, sondern sie als festen Bestandteil in sein eigenes Leben einzufügen, eben die friedvolle und spirituelle Seele des Jiu-Jitsu zu verinnerlichen und letztlich zu leben.
Dieses Buch geht wie seine beiden Vorgänger „Arashi-Power“ und „Shi Shin“ einen eigenen Weg und vermag dem einen oder anderen Leser je nach Wissens- und Erfahrungsstand neue Impulse zu geben. Das Buch verknüpft die Philosophie einer friedlichen Kampfkunst mit dem heutigen Leben, das zunehmend komplexer wird.
Als Autor dieses Buches erhoffe ich mir als idealen Leser den Kyūund Danträger, der sich nicht nur für Techniken interessiert, sondern seinen geistig-seelischen Horizont erweitern will. Die Technik seiner Disziplin als solche, beziehungsweise deren Vervollkommnung ist ihm wichtig und er beschäftigt sich intensiv mit ihr, schließlich ist sie das Medium, mit dem er sich vordergründig ausdrückt, aber: Sie ist nicht das persönliche Nonplusultra, nicht sein Ein und Alles. Es ist nicht sein oberstes Ziel alles andere auszublenden und Anerkennung von außen einzig durch technische Perfektion zu erheischen. Der ideale Leser dieses Buches strebt nach etwas, das hinter der bloßen Technik liegt und über die Tatami hinaus reicht. Er erhofft sich von seiner Kunst und der ihr innewohnenden Philosophie, dass sie ihn nicht nur verteidigt oder ihm Spaß beim Üben bereitet, sondern dass sie ihm etwas Tieferes fürs Leben gibt. Er stellt sich dazu zwei Kernfragen:
Diese Kernfragen hängen eng zusammen mit dem Shu-Ha-Ri-Prinzip, das die Entwicklung des Kampfkunstadepten in drei Reifeebenen einteilt:
1) Die erste Ebene Shu  steht für erhalten, gehorchen und beschützen. Der Schüler steht am Anfang. Er muss vertrauensvoll aufnehmen, was der Lehrer ihm zeigt. Der Schüler steht unter dem Schutz des Lehrers. Der Lehrer ist sich seiner Aufgabe und Verantwortung bewusst.
steht für erhalten, gehorchen und beschützen. Der Schüler steht am Anfang. Er muss vertrauensvoll aufnehmen, was der Lehrer ihm zeigt. Der Schüler steht unter dem Schutz des Lehrers. Der Lehrer ist sich seiner Aufgabe und Verantwortung bewusst.
2) Die zweite Ebene Ha  bedeutet sich lösen und abweichen. Der Schüler hat die Grundlagen verinnerlicht, er wird freier in der Ausübung der Techniken. Er beginnt selbstständig zu werden und experimentiert.
bedeutet sich lösen und abweichen. Der Schüler hat die Grundlagen verinnerlicht, er wird freier in der Ausübung der Techniken. Er beginnt selbstständig zu werden und experimentiert.
3) Die dritte und höchste Ebene Ri  steht für loslassen und trennen. Der Schüler hat das technische und charakterliche Niveau erreicht, das es ihm erlaubt, sich vom Meister zu trennen und seinen eigenen Weg zu gehen. Dieser Weg sollte ihn im Idealfall auf den Weg des Lehrers führen, damit er das Erlernte weitergeben kann.
steht für loslassen und trennen. Der Schüler hat das technische und charakterliche Niveau erreicht, das es ihm erlaubt, sich vom Meister zu trennen und seinen eigenen Weg zu gehen. Dieser Weg sollte ihn im Idealfall auf den Weg des Lehrers führen, damit er das Erlernte weitergeben kann.
Das Shu-Ha-Ri-Prinzip betrifft nicht nur den Weg der Kampfkünste. Es durchdringt den ganzen Lebensweg von der Kindheit bis ins hohe Alter. Es stellt den Mechanismus des Gebens und Nehmens und der damit einhergehenden Entwicklung des Menschen dar. Dazu gilt der Grundsatz:
Die Lebenspraxis zeigt, dass das Shu-Ha-Ri-Prinzip im Alltag unterschiedlich greift, das heißt, man bewegt sich zeitgleich und parallel in den verschiedenen Lebensbereichen auf unterschiedlichen Reifeebenen. Beruflich kann man schon auf der Ri-Ebene stehen, aber als langjähriger Single in puncto Beziehungen noch auf der Shu-Ebene. Mit diesem Buch möchte ich Anregungen bieten, um die drei Entwicklungsebenen nicht nur auf der Tatami, sondern in möglichst vielen Lebensbereichen zu durchwandern.
Ethik und Spiritualität im Alltag bilden den Dreh- und Angelpunkt dieses Buches. Die Vorstellung von Ethik hat sich durch die Jahrhunderte entwickelt, ihr Begriff wurde immer weiter unterteilt und verfeinert. Die Literatur über „die Lehre vom sittlichen Wollen und Handeln des Menschen in verschiedenen Lebenssituationen“3 füllt ungezählte Bücherregale in allen großen Universitäten. Naturgemäß ist die sogenannte Individualethik, die den Menschen in seinem isolierten Handeln betrachtet, ein dominanter Faktor in unserem Leben, da wir alle Individuen sind. Wichtiger für das menschliche Zusammenleben ist jedoch die Sozialethik. Wir sind zwar Einzelwesen, die ihre Einmaligkeit und Eigenständigkeit wertschätzen und fördern, dennoch bleiben wir Gesellschaftswesen, deren Individualethik immer im direkten oder indirekten Zusammenhang mit unserem Gegenüber steht, auf der Tatami wie überall anderswo im Alltag. Die Bedeutung der Sozialethik wiegt umso schwerer, als wir zunehmend ethnisch zusammenwachsen, somit mit Fremdartigem konfrontiert werden und uns zwangsläufig damit auseinandersetzen müssen.
Spiritualität meint die geistig-seelische Entfaltung im Streben nach tiefen Erkenntnissen über sich und die Welt, in der man lebt. Spiritualität kann auch Religiosität bedeuten, muss es aber nicht. So sind viele Philosophen durchaus spirituell, aber nicht religiös. Da wir alle das ganze Leben lang dem allgegenwärtigen Prozess von Ursache und Wirkung unterliegen, ist es ein wesentlicher Anspruch der Spiritualität, die Verbindungen, Abhängigkeiten und Zusammenhänge im Leben sowohl mit dem Kopf (dem Verstand) als auch mit dem Herzen (dem Gefühl) zu erfassen und zu durchdringen. Dabei nutzen uns antike östliche und westliche Philosophien und Religionen ebenso wie moderne psychologische und soziologische Methoden und Erklärungsmodelle.
Dieses Buch ist geschrieben für offene Geister. Für neugierige und wissbegierige Seelen, denen der vielzitierte Blick über den Tellerrand etwas bedeutet. Für jene, die sich nicht scheuen, sich mit gegensätzlichen Standpunkten und Perspektiven auseinanderzusetzen, diese zu prüfen und darüber nachzudenken, um sie dann ganz oder teilweise anzunehmen oder auch abzulehnen. Es gilt im Besonderen dem Jiu-Jitsuka, der die östliche Mentalität schätzt und sich seiner eigenen europäischen Mentalität bewusst ist.
Dieses Buch ist wohl eine schlechte, bisweilen gar keine Lektüre für den dogmatisch-ambitionierten Samuraianhänger, der die isolierte Kriegerseele der Samurai, die uns im Grunde stets fremd war, ist und bleibt, glorifiziert oder gar zu imitieren versucht. Das Bestreben westlicher Budōka, japanischer sein zu wollen als die Japaner, beziehungsweise ‚samuraischer’ als die Samurai, bringt oft fragwürdige Karikaturen hervor. Diese erreichen damit meist das Gegenteil dessen, was sie wollen; sie bekommen keine Anerkennung, sondern werden im Osten wie im Westen von ‚normalen’ Budōka eher abgelehnt. Diese ablehnende Haltung ist ein sozialpsychologisches Phänomen, das immer dann zutage tritt, wenn definierte, soziale oder ethnische Gruppierungen sich durch nicht direkt Zugehörige in ihrer Besonderheit angegriffen oder gar verletzt fühlen. Für viele Japaner sind Deutsche im Hakama ebenso seltsam anmutend wie für Deutsche Japaner in Lederhosen. Wenn diese dann noch Schuhplattler tanzen, erst recht.
Es ist für jeden Jiu-Jitsuka sinnvoll, eine sozialethische Gesinnung und ein spirituelles Bewusstsein zu entwickeln. Für ihn als Wegschüler entsteht dadurch Authentizität, die ihn davor bewahrt, eine schlechte Kopie statt eines guten Originals zu sein oder gar einen zweifelhaften Kriegertypus zu idealisieren.
Das Buch „Jiu-Jitsu leben“ beschließt als Ergänzung zu den Büchern „Arashi-Power“ und „Shi Shin“ die Ost-West-Trilogie, indem es die Lücken (damals nicht aktuelle oder für die Thematik nicht relevante Themen) der beiden Vorgänger füllt und versucht, neue Ansätze zu schaffen. Während „Arashi-Power“ als Vertreter des Ratgebergenres stark auftritt, um bewusste Aktionen zur Lebensveränderung zu forcieren, setzt „Shi Shin“, der Riege der Aphorismenliteratur zugehörig, mit leisen Tönen den Akzent auf philosophisches Gedankengut. Die Herzschläge dieser Bücher (praktikables Umsetzen im Alltag bei „Arashi-Power“ und philosophische Reflexionen bei „Shi Shin“) münden hier in einen gemeinsamen Puls: die eigene spirituelle Entwicklung voranzutreiben und sein ethisches Bewusstsein zu erweitern.
In diesem Buch findet, wie bereits zu Beginn der Einleitung erwähnt, eine Abkehr von den Samurai statt. Diese Abkehr ist das Ergebnis einer natürlichen Weiterentwicklung hinsichtlich Ethik und Spiritualität. Abkehren kann man sich nur von etwas, dem man sich zuvor zugekehrt hat, mit dem man sich intensiv beschäftigt hat. Umso mehr ist ein solcher Sinneswandel authentisch, denn der Gewandelte weiß, wovon er spricht. Jeder Raucher, der es schaffte, von der Zigarette loszukommen, überzeugt anders, als einer, der nie einen Zug genommen hat.
Zwischen „Arashi-Power“ (2000) und „Shi Shin“ (2004) liegen vier Jahre. In diesem Zeitraum vollzog sich schon in großen Teilen die innere Abkehr von der japanischen Kriegerkaste, die ich bereits 1998 im Roman „Zehntausend Meilen“4 stellvertretend auf den Samurai Musashi Myamoto bezog. In diesem Roman stellte ich Musashi, dem Verfasser der „Fünf Ringe“, den unbekannten Samurai Magune, den Verfasser der „Vier Herzen“ entgegen. Sowohl Magune als auch die „Vier Herzen“ waren Fiktion. Unter anderem führten die zahlreichen Anfragen nach den „Vier Herzen“ dazu, dass ich sechs Jahre nach Erscheinen von „Zehntausend Meilen“ „Das Buch der vier Herzen“ unter dem Titel „Shi Shin“ schrieb. Als Vorlage dienten mir die einschlägigen Budō-Klassiker wie zum Beispiel das „Hagakure“. Um die geschichts-philosophische Authentizität des „Shi Shin“ zu wahren, war ich gezwungen, seinen Verfasser Magune ein – wenn auch ungewöhnliches – Kind seiner Zeit sein lassen zu müssen; sein Weltbild durfte nicht zu fortschrittlich sein. Dennoch wird in „Shi Shin“ die Abscheu Magunes gegenüber dem Schwert und gegenüber allem Kriegerischen deutlich zum Ausdruck gebracht.
Nach „Shi Shin“ sind weitere sechs Jahre bis zu diesem Buch vergangen. Das bedeutet zusammengefasst eine Dekade Leben vor, auf und hinter der Tatami. Mit Abschieden und Begegnungen. Mit Tränen der Rührung und der Freude. Mit Freundschaft und Liebe, aber auch mit Streit und Hader.
Dazu ein Zitat aus dem Alten Testament:
Meine ethische und spirituelle Weiterentwicklung versuchte ich stets zu verbinden mit einem kritischen Betrachten der Gesellschaft, mit dem bewussten Verfolgen sozialer, politischer und religiöser Prozesse. Dieses Betrachten geschah nicht aus der Perspektive des neutralen Beobachters, dann wäre es emotionslos gewesen – wie hätte so Entwicklung stattfinden können? Entwicklung ist immer emotionsgebunden.
Überdies habe ich versucht, die Beobachtungen zu verknüpfen mit dem Hinterfragen der eigenen Reaktionen darauf: Was hat mich wie stark berührt? Und warum? War mir etwas egal und wenn ja, weshalb? Habe ich bewusst verdrängt, mich unbewusst abgelenkt? Bin ich durch das Problem hindurchgegangen? Wenn ich es gelöst habe, wie bin ich vorgegangen? Hätte oder habe ich früher auch so reagiert? Wie kann es in Zukunft weitergehen? Welche Veränderungen müssen stattfinden? Wie kann man diese Veränderungen herbeiführen?
Dieses Buch spiegelt zum einen die Erfahrungen, Gedanken und Reflexionen eines Jiu-Jitsuka, der sich seit fast vier Jahrzehnten mit Budō befasst, davon über zwei Jahrzehnte hauptberuflich. Zum anderen ist es ein Dokument der aktuellen (alles fließt, wer weiß, was folgt?) Quintessenz einer inneren Neu- und Wissbegier nach dem, was uns Menschen an- und umtreibt, nach den Kernfragen unseres Wirkens und dessen Hintergründen:
Ich bin mir bewusst, dass diesem idealistischen Werk Mängel anhaften – „Es irrt der Mensch, solang er strebt“6 –, da ich als sein Verfasser mit Mängeln behaftet bin. Es ist naturgemäß subjektiv in seiner Art der Argumentation und der Darstellung, es kritisiert und wertet. Damit steht es in der Tradition der Budōklassiker wie dem „Hagakure“, dem „Buch der Fünf Ringe“ oder „Bushidō“ – ihre Verfasser Musashi, Tsunetomo, Nitobe waren alles andere als unbeeinflusst und neutral, was sich sehr leicht durch die Lektüre ihrer Schriften nachweisen lässt. Kritik zu üben ist eine Aufgabe. Wer sich dieser Aufgabe stellt, sollte gewisse Grundsätze beachten. Ein Kritiker ist in der Regel nicht objektiv (in der Philosophie wird diskutiert, ob es überhaupt Objektivität geben kann, da wir alle naturgemäß subjektive Wesen sind), dennoch muss er mit Sachverstand und größtmöglicher Klarheit die Dinge analysieren. Wer Dinge, Sachverhalte, Zustände, Erscheinungen analysieren will, muss um deren Hintergründe, deren Beschaffenheit und deren Eigenarten wissen. Dieses Wissen muss sich angeeignet werden. Der wertvollste Wissensvermittler ist die Erfahrung. Da kein Mensch alles selbst erfahren kann, muss zwangsläufig Wissen vertrauensvoll aus den Erfahrungen Dritter generiert werden. Geschichtsbücher und Biographien zum Beispiel bestehen ausschließlich aus den Erfahrungen Dritter. Autobiographien hingegen aus den eigenen Erfahrungen. Das Wissen dieses Buches besteht aus der Darlegung der Erfahrungen des Autors und den aufbereiteten Erfahrungen Dritter.