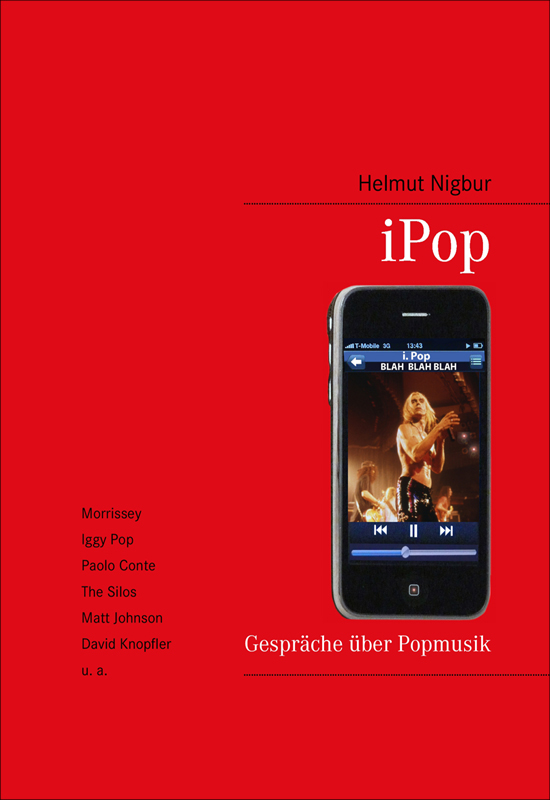
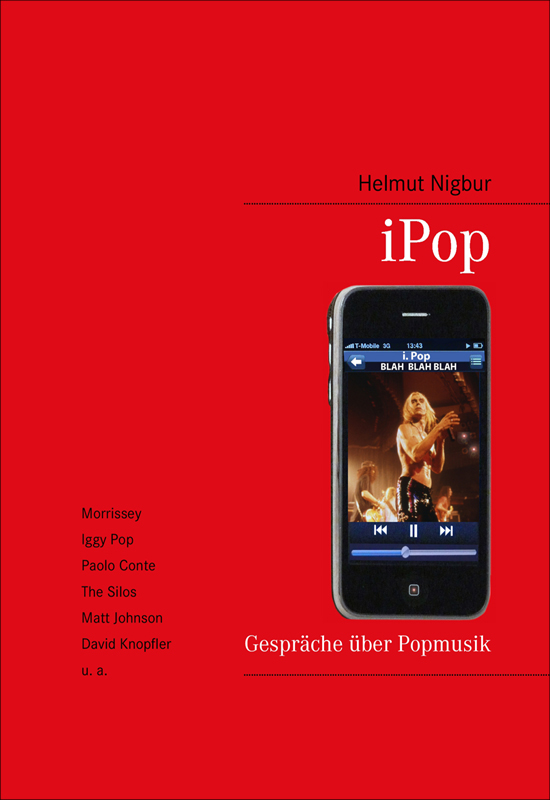

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2009 Helmut Nigbur
Satz, Umschlaggestaltung, Herstellung und Verlag:
Books on Demand GmbH, Norderstedt
Coverphoto: J. Groth/H. Nigbur/VIRGIN Rec.
ISBN: 978-3-8448-8384-8
Vorwort
Totchic
Unser Frank … und Freier Morrissey
Der Diener zweier Herren
Geschrammelte Werke
The Silos
Der Rattenfänger von Neapel
Gegen den Rest der Welt
Böse Menschen haben keine Lieder
Einer Widerspenstigen Zähmung
Waffenbrüder
Ryuichi Sakamoto – ein Porträt
Agit – Pop
Iggy Pop
Abbildungsverzeichnis
Namensregister
NIRVANA
Unplugged in New York sind Kurt Cobain (rechts),
David Grohl (Mitte) und Chris Novoselic

»Texte von Populärmusik sind nicht so leicht zugänglich wie die gesammelten Werke von Shakespeare.«
(Peter Urban in Rollende Worte, Hamburg 1977).
»Populäre Songs beschreiben als einzige Kunstform die Zeitstimmung. Etwas los ist nur im Radio und auf den Platten. Da sind die Leute. Nicht in Büchern, nicht auf der Bühne, nicht in den Galerien. All die Kunst, über die sie immer reden, bleibt nur im Regal. Sie macht niemanden glücklicher.«
(Bob Dylan in The Playboy Interview, 1965).
»It’s hard to care anymore. The ‚music industry’ is fat and satisfied. They can buy anything, and turn anyone into a spiritual eunuch. That means no balls.“
(Iggy Pop im Vorwort zu Nick Kents The Dark Stuff, London 1994)
»Das Reden über Pop ist bisweilen mehr Pop als das, worauf es gerichtet ist.«
(Roger Behrens)
Lohnt sich, gehört sich die Beschäftigung mit Pop? Mit sarkastischen Texten, einfachster musikalischer Struktur, mit Hitparadenplätzen und dem Problem der künftigen Verfügbarkeit von Plattenspielernadeln, wo man sich währenddessen anderenorts seinen und seines Nächsten Kopf zerbricht ob der Verfügbarkeit von Wasser und Brot? Dies allerdings wohl immer häufiger zu den Klängen einer irgendwo dudelnden, Gott und Granatenschlag nicht fürchtenden mp3-Datei?
Pop ist, wenn man sich’s leicht macht. Pop trägt nicht schwer an seiner Schmach, kaum etwas ernst zu nehmen, schon gar nicht die Zahl der Opfer, die ihm auf den Leim gegangen sind. Pop wird fürderhin die Welt nicht ändern, plärrt meist aber dort, wo dies geschieht, rotzfrech im Hintergrund. Seriöse Mitglieder unserer Gesellschaft mit noch nicht zur Gänze bewältigtem Karrierepensum sind nach wie vor gut beraten, bei eventuell verspürtem Hang zur Welt von Rock und Pop mit ihrer Neigung hinter dem Berg zu halten. Tony Blair zum Beispiel wurde ein ausgeprägtes Faible für die Popkultur nachgesagt, das er auch bei offiziellem Anlass nur zu gerne erkennen ließ. Den Abgeordneten des Unterhauses Leo Abse, der dort viele Jahre für die Labour-Partei hockte, veranlasste dies in seinem Buch »The Man Behind The Smile: Tony Blair And The Politics Of Perversion« zur Frage: »Warum mischt sich Blair in diese Welt der Verpflichtungslosigkeit, der geschlechtlichen Desorientierung, der sexuellen Nomaden und der Rolling Stones, die schon in ihrem ruhelosen Namen das Wesen der Angelegenheit auf den Punkt bringen?« Vorsicht scheint geboten. Wie viele Kokainkonsumenten darf ein Kanzlerkandidat kennen, bis es Stimmen kostet? Wenn sich’s mal wirklich zuspitzt, verzeiht man wohl eher den bauernschlauen Raub der Parteikasse als einen Hang zum Pop, den Tönen »der Verständigung zwischen prekären Existenzen, der Musik zur Stimulanz von desorientierten Einzelnen.« (Diedrich Diederichsen, Süddeutsche Zeitung vom 30.01.2009)
Seit jeher hat die Popkultur allenfalls beschäftigt, was aus ihr selbst wird. Möglicherweise liegt hier der Grund ihres Überlebens. Einzig Pop hat den Massenmarathon vergleichbarer Trends bis heute unbeschadet durchgestanden. Walter Vogt, 1988 verstorbener Schweizer Arzt und Schriftsteller (Gesamtwerk; Nagel & Kimche, Zürich 1992), wusste: »Selbstverständlich und cool setzt die Popkultur Versatzstücke nebeneinander, aller Zeiten und Weltgegenden samt dem Noch-nie-Dagewesenen.«
Pop hat den sechsten Sinn, sich auf der Stelle einzuverleiben, was nach schnoddrigem Überlebenswillen unter ungünstigen Bedingungen riecht, nach Lust an Sarkasmen zu schönen Tönen.
So waren »underground« und »independent« alsbald Pop, zum Unwillen von Bannerträgern wie Nick Cave, Bob Mould oder Mark Smith. Bald darauf war »Techno« an der Reihe, Pop zu werden, was einerseits dröhnende Dumpfheit, zum anderen aber auch Kassenträchtigkeit kostete.
Was kümmert es die Popkultur? Wie längst über die Sorge »Schickt sich das?« lässt sie ihr stinkender Zynismus zunehmend auch über die Not »Lässt sich das verkaufen?« die Nase rümpfen. Wenn ein Stück Pop, das ausnahmslos nach seinem eigenen rücksichtslosen Regelwerk entstanden ist, sich trotzdem gut vermarkten lässt, ist Missverständnis oder Betrug im Spiel.
»Die Wirtschaft selbst ist inzwischen zur Popkultur verkommen«, wusste Daniel Bell (»Die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus«, 1976) bereits vor 30 Jahren und traute dieser bedenkenfreien Kunst mit ihrem imperativen »anything goes« zu, alle Dämme zu brechen. »Marketing rangiert über dem Produkt, Innovation über Solidität, Hedonismus über Verantwortlichkeit und Konsum über Arbeit und Disziplin.«
John Fogerty, der bekanntlich um einen großen Teil des Verdienstes an seiner Arbeit mit CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL geprellt wurde, sagte sicher nicht nur, um sich selbst zu trösten: »Wenn du ein Lied schreibst, wird das erst dann hörenswert, wenn du einem aufrichtigen, uneigennützigen Kodex gefolgt bist. Wenn jemand so viel Kohle rüberschieben kann, dass du sein Logo an deine Bühne kleisterst, verdienst du nicht, dass man dir zuhört. Denn dann wird klar, dass auch du zu kaufen bist.«
In diesem Sinne waren NIRVANA oder THE FALL zum Beispiel Pop, PINK FLOYD und GENESIS dagegen lange bevor man Autos nach ihnen benannte schon nicht mehr. Es gilt, das derb-verrotzte, doch aufrichtige Engagement des Augenblicks davor zu schützen, windige Langzeitstrategie zu werden.
Nur im Licht des Charismas eines Jim Morrison, der Verzweiflung eines Kurt Cobain ist die Beschäftigung mit Pop mehr als ein »eskapistisches Vergnügen«. Auch ohne von ihr Korrektur gesellschaftlichen Missstands zu erwarten. Obwohl sich sogar daran die eine oder andere Hoffnung knüpft.
In der Essaysammlung SCHREIBEN ALS KRANKHEIT UND ALS THERAPIE von Walter Vogt (Band 10 der Werkausgabe) heißt es, Künstler seien wohl »heute eher zu skeptisch in Bezug auf eine Wirkung ihrer Werke überhaupt. Vermutlich kennen wir einfach die kommunikativen Strukturen, die eine derartige Wirkung ermöglichen, aber auch kanalisieren und konditionieren, zu wenig. Es geht nicht um die Alternative, entweder die Welt zu beschreiben oder sie zu verändern, wer sie beschreibt, verändert sie gleichzeitig«.
Befassen wir uns, so ermuntert, also mit Protagonisten des Pop. Versuchen wir uns mit ihnen an der Beschreibung eines Phänomens, dem bei aller Skepsis das Verdienst zukommt, gleich zwei fragwürdige, jedoch erschreckend weitverbreitete Attituden unseres Alltags gering zu schätzen: das Krämergebaren und die Schicklichkeit. Lassen wir vor allem die Schöpfer von Pop selbst zu Wort kommen; sei es über die Unsitte, in Anwesenheit von Vegetariern Wurstbrötchen zu verzehren, sei es über weniger Wichtiges.
Helmut Nigbur, September 2009
Gottfried Benn
Vom »Irrgarten der Alkaloide« in die Schulbücher

O NACHT! ICH NAHM SCHON KOKAIN, UND BLUTVERTEILUNG
IST IM GANGE,
DAS HAAR WIRD GRAU, DIE JAHRE FLIEHN, ICH MUSS, ICH MUSS
IM ÜBERSCHWANGE
NOCH EINMAL VORM VERGÄNGNIS BLÜHN.
(G. BENN)
Von Kokain, Pop und Kultur
Gottfried Benn war Arzt, als er dem weißen Stoff verfiel. »Der Belladonna-Parzival mit Silberlöffel« hieß er bei denen, die sympathisch große Pupillen zu deuten wussten, und Werner Rübe schreibt in PROVOZIERTES LEBEN (Klett-Cotta, Stuttgart 1993) über den Oberarzt an einem belgischen Krankenhaus: »In jener Zeit, einer ‚großen Phase visionärer Kreativität’ nahm Benn Kokain, wie Trakl und Ernst Jünger. Kokain, die zerebrale Droge, das Alkaloid der Licht- und Tasthalluzinationen. Benn war … im besetzten Brüssel … in geselligen Kreisen also, in die, von New York, von Paris her angeweht, der »weiße Schnee« auf die europäischen Metropolen fiel.«
Sigmund Freud hat himmelschreiend lange gebraucht, bis er die Höllenmacht des Pulvers wenigstens erahnte. Der generös und besten Willens mit Kokain versorgte Freund Ernst Fleischl war da schon tot. Nun füllen Benns und Freuds Verdienste allein zu viele Schulbuchseiten, als das es möglich wäre, immer auch Gottfrieds Abstecher in den »Irrgarten der Alkaloide« (W. Rübe) und Sigmunds »Kokainepisode« (E. Jones) zu erwähnen. Und abgesehen vom Platzmangel: unseres Jahrhunderts größter Poet und Psychiater »auf Koks«: Das schickt sich nicht.
Erythroxylum nennen Pflanzenkundler und die, die etwas zu verbergen haben, den zart gebüschelten Rotholz-Strauch aus den tropischen Regionen Südamerikas, dessen Blätter eben das enthalten, was Bowie wie Benn, Fallada und Freud und darüber hinaus hier derzeit geschätzte 20.000 meist Namenlose zu Brüdern im berauschten Geiste macht: Coca.
Die chemische Isolierung vollbrachte im Jahre 1860 Herr Niemann.
Dem hat in der Folge wohl manch ein Beglückter redselig, orthografisch großzügig und mit tief wie nie empfundener Dankbarkeit die Ausnahme von der Regel NOMEN EST OMEN gewünscht. Allein, Niemann nennt heute kaum ein Lexikon.
Ganz anders erging es seinem geistigen Spross. Auf der Stelle startete der Muntermacher los zu einer bislang ungebremsten, hin und wieder mörderischen Spritztour durch Salons und Tanzpaläste, Studierstuben, Fixerbuden, Disco-Klos und Latrinen von anderthalb Jahrhunderten. Von seinem Zauber hat das Rauschmittel dabei kaum etwas eingebüßt. Auch nicht angesichts zahlloser Katastrophen und einer kompetenten Mythenbrecherfront vom reuigen Freud (»Beitrag zur Kenntnis der Cocawirkung«, 1885) über Trakl, der 27-jährig an einer hohen Dosis umkam, und Ernst Jünger, der demgegenüber 1998 kurz vor Vollendung seines 103. Lebensjahres verstarb, bis zu Konstantin Wecker, der, wie Benn, lyrische Entschlüsselung versucht (»… Seele löst sich, fliegt dahin …«, 1993).
Fesselnd, verlockend, beschönigend, doch auch aufrichtig, warnend, ekelerregend und abschreckend präsentieren sich die längst nicht mehr zu zählenden Reportagen Betroffener aus ihrem Krieg zwischen Versuchung und Vernunft. Meist jedoch resultieren nur Ansätze zum Verständnis des Kokains, dessen durchtriebene und launische Manipulation an seiner Befindlichkeit dem Menschen paradiesischen Rausch, euphorische Faszination am eigenen Verkommen wie uferlosen Horror zu bescheren vermag. Ist ausgerechnet der Popkultur zuzutrauen, Licht in das Dunkel zu bringen? Ihr Vorteil ist die Fülle von Material. Wo sonst sind »Kokaingeschichten« verbreitet wie hier? Ihr Handicap ist, dass nichts sie schert. Es bleibt in der Regel bei wiewohl oft äußerst gelungenen Darstellungen des Problems, nicht zu reden von eitler Pose noch im größten Jammer.
Erythroxylumgewächse sind wohl älter als der Mensch. Ist man der Ansicht, dass alle Natur einen gescheiten Zweck hat (bekanntlich ist das längst nicht jeder), so mag der der Coca sein, den Gebraucher drastisch Maß zu lehren. Drastischer als alle die Versuchungen, die längerfristig, oft geradezu unwahrnehmbar, Missbrauch strafen. Wer, dessen Herz gerade versagt, sieht schon den Grund im vorher täglich und gern verzehrten Eisbein?
Bevor wir uns dem zuwenden, was den Helden unserer Tage einfällt zum »Ich-Verfall, dem süßen, tief ersehnten« (Benn) alias »kleinen Tod« (Fallada), sei zweierlei hinzugefügt: getreu der nächsten Regel ALLES WAR SCHON EINMAL DA füllen beispielsweise die Kokainexzesse des Paris und Berlin der 20er- und 30er-Jahre manches Buch; so H. W. Maiers Werk von 1926 DER KOKAINISMUS (Leipzig). Zweitens sei denen, wir streiften sie bereits, die etwas zu verbergen haben, hier gern bestätigt: Gewisse Autoren sehen in der Tat den Cocagenuss in einem volkskulturellen, gar religiösen Rahmen. Doch geht es dann um Coca, nicht Kokain und nicht um Hamburgs Hansaplatz, sondern ländliche Regionen Kolumbiens und Perus. In solchem Kontext wird der Tag für Tag mit Kalk und Cocablatt erkaute Grenzzustand bedrückter Seelen dann zur Gott-Erfahrung, zum Außer-sich-und-seiner-Mühsal-Sein (Ekstase).
Leider nicht bestätigt werden kann, dass dadurch je ein Gericht der Welt zu beeindrucken gewesen wäre. Selbst nicht in Kolumbien oder Peru. »Wäre das Drogengeschäft eine Volkswirtschaft, rangierte es gleich hinter Schweden« (Nikolaus Richter in der Süddeutschen Zeitung vom 13. März 2009). Einzelstimmen, die übers Feuilleton hinaus immer einmal wieder versuchen, den internationalen Konsens der Unbeeindruckbarkeit von Justiz und Politik in ein finanzpolitisches Licht zu rücken, verstummen stets zuverlässig prompt. Todsicher.
Versteht sich doch an den neuralgischen Stellen jedweden Drogenproblems, bei Massenverteilung und Einzelkonsum, nicht der allerkleinste Spaß. Weder als ungeschöntes Bruttosozialprodukt eines Anbau- noch als schwatzhafter Wochenblattessay eines Verbraucherlandes. Sonst aber gerne. Jederzeit. Wo’s nicht blamiert und auch nichts kostet, ist das Sujet gesellschaftsfähig. Gelegentlich geradezu totchic.
Womit wir beim Thema wären. Bei der Suche nach beispielsweise David Bowies Hauptmotiv, in all den charmant bestrittenen Interviews der letzten Jahre schon ungefragt jeglichen Drogenkonsum heutzutage zu verneinen, dürfte neben besagter gesetzgeberischen Unerbittlichkeit allerdings sogar in Betracht gezogen werden, dass es der Wahrheit entspricht. Allein der vielen Löcher in Nasenscheidewand und im Gedächtnis wegen. Wird Bowie doch hierzu gerne zitiert, sich an nahezu nichts klar erinnern zu können aus der Hoch-Zeit seines Kokainkonsums Mitte der 70er-Jahre. Fachleute streiten bis heute, ob damals denn auch Bowies Kreativität ihren Zenit erreicht hatte.
Über die künstlerische Qualität der Alben HEROES und erst recht LOW (beide RCA, 1977) jedenfalls gehen die Meinungen scharf auseinander. So loben Graves und Schmidt-Joos sie als »Szenarien eines Berlin zwischen Götterdämmerung und Kristallnacht« (eine treffliche Metapher angesichts der Janusköpfigkeit des Kokaineffektes), während SOUNDS unverblümt nur »beängstigende, beunruhigende Klänge« beklagte. Weiter gestritten werden darf auch darüber, wer denn wohl wen zu ihrer gemeinsamen stürmischen Mauerstadtzeit auf Abwege geführt haben mag. Der Iggy den Bowie oder der David den Pop? Oder etwa der tückisch-verharmlosende Geist des gleichnamigen Musik- und Lebensstils gleich alle beide? Auf der Grammy-Verleihung 1975 bat Bowie einen vertrauten Assistenten, ihn Simon und Garfunkel vorzustellen, die er bewunderte und endlich persönlich kennenlernen wollte. Der Mann wies David darauf hin, dass er doch vor weniger als einer Stunde beim kollegialen Gedankenaustausch mit dem Duo sogar fotografiert worden war. Schon eine flüchtige Betrachtung des Bilddokumentes lässt uns bis heute das Ausmaß der Entrücktheit von wenigstens zwei der drei Ausgezeichneten erahnen.
Ebenfalls auf die Rechnung des weißen Gifts setzen Chronisten die Begebenheiten um einen Bowieauftritt in Cleveland/Ohio, der zu platzen drohte, weil dem Grandpiano (!) auf der Bühne gute acht Inches an der vom verschnupften Meister verlangten Größe von sechs Fuß fehlten. Oder waren es sieben Inches? An fünf Fuß? Wie auch immer – heute setzt Bowie die Akzente anders. Denn heute ist er, sagt er, clean.
Den einen mag die bei solchen Bekenntnissen zwischen den Zeilen behauptete Mühelosigkeit von Entzug und Entsagung eine Spur zu viel von Otto Waalkes legendärer Waschanleitung »Dip Dip Dip, in the Whip Whip Whip, in the water, in the water … cleeeaaan« haben; den anderen – stets auf Zeitgeisthöhe – ist Bowies heutige Sicht der Dinge Grund genug, ihn flugs in die Galerie derer zu bugsieren, die ausschließlich und ein für alle Mal kraft ihrer starken Persönlichkeit von der Droge loskamen. Und da steht David dann, wenn’s alphabetisch zugeht und Künstlernamen gestattet sind, sogar noch vor Herrn Freud.