

Zum Buch
Am Tag seines Erscheinens führte »Unorthodox« schlagartig die Bestsellerliste der New York Times an und war sofort ausverkauft. Wenige Monate später durchbrach die Auflage die Millionengrenze. In der chassidischen Satmar-Gemeinde in Williamsburg, New York, herrschen die strengsten Regeln einer ultraorthodoxen jüdischen Gruppe weltweit. Deborah Feldman erzählt, wie sie den beispiellosen Mut und die ungeheure Kraft zum Verlassen der Gemeinde findet – um ihrem Sohn ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Noch nie hat eine Autorin ihre Befreiung aus den Fesseln religiöser Extremisten so lebensnah, so ehrlich, so analytisch klug und dabei literarisch so anspruchsvoll erzählt.
Zur Autorin
DEBORAH FELDMAN, geboren 1986 in New York, wuchs in der chassidischen Satmar-Gemeinde im zu Brooklyn gehörenden Stadtteil Williamsburg, New York, auf. Ihre Muttersprache ist Jiddisch. Sie studierte am Sarah Lawrence College Literatur. Heute lebt die Autorin mit ihrem Sohn in Berlin.
Deborah Feldman
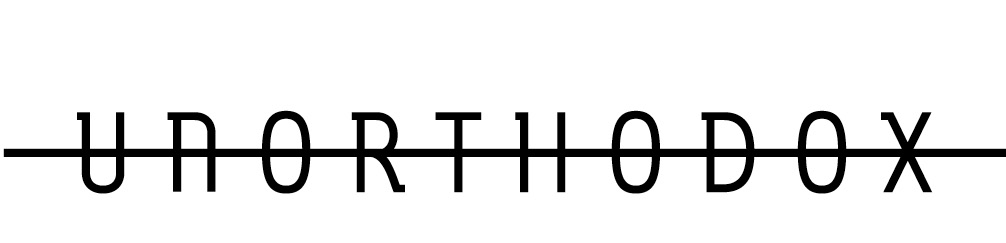
Eine autobiografische Erzählung
Aus dem Englischen
von Christian Ruzicska

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Unorthodox – The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots« bei Simon & Schuster, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2012 by Deborah Feldman
Copyright © der deutschen Ausgabe 2016
by Secession Verlag für Literatur, Zürich
Covergestaltung: semper smile, München
nach einem Entwurf von Erik Spiekermann und Robert Grund, Berlin
unter Verwendung eines Umschlagmotivs von © Erik Spiekermann
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
mr · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-26978-4
V004
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Heute vor ziemlich genau zehn Jahren saß ich auf dem Sofa in meiner Mansardenwohnung in New York, während mein dreijähriger Sohn auf dem Doppelbett, das ich in unser winziges Schlafzimmer gequetscht hatte, schlief. Ich öffnete auf meinem Laptop das Dokument, das wenige Monate später »Unorthodox« werden sollte.
Ich schrieb damals stoßweise an dem Manuskript, meistens am Abend, während meine Collegekommilitoninnen und -kommilitonen in Bars und Restaurants gingen. Weil ich keine Kinderbetreuung hatte, konnte ich sie nicht begleiten und blieb zu Hause. Ich erinnere mich heute noch daran, wie seltsam komprimiert die Zukunft sich damals anfühlte, wie ein Akkordeon, aus dem alle Luft gewichen ist. Ich konnte mir damals nicht mehr als die Woche vorstellen, die vor mir lag, höchstens noch den nächsten Monat. Ich war einsam, und ich hatte Angst. Die Tage verbrachte ich mit meinem Kind, um das ich mich kümmern musste und das mich ablenkte, aber an den leeren, sich unendlich ausdehnenden Abenden hatte ich nichts außer meinem Manuskript, das sich gleichermaßen wie ein Geschenk und ein Fluch anfühlte.
Im November 2009 hatte ich schon einiges notiert, aber der Großteil meiner Aufgabe lag noch vor mir. Ich war dreiundzwanzig Jahre alt, und hatte vorher nie ernsthaft geschrieben, nicht einmal einen Zeitungsartikel oder eine Kurzgeschichte, von einem Buch ganz zu schweigen. Mir schien es, als hätte ich mir ein unerreichbares Ziel gesetzt.
Ein Buch zu schreiben war für mich Teil eines viel größeren Plans, eine Notwendigkeit, wenn ich tatsächlich frei sein und mit meinem Sohn außerhalb der Gemeinschaft in Williamsburg ein neues Leben anfangen wollte.
Meine Anwältin hatte mir kurz vorher erklärt, dass dieses Buch die Chance für mich war, die große Öffentlichkeit zu erreichen, die ich brauchte, um mich gegen eine Gemeinde zur Wehr zu setzen, die versuchte, mich stumm und hilflos zu machen. Dieses Buch war meine Chance, der Gemeinde klar zu machen, dass es besser wäre, mich einfach los- und mich gehen zu lassen.
Natürlich war ich mir des Privilegs, in einem so jungen Alter ohne jegliche Erfahrung einen Buchvertrag zu bekommen, bewusst. Dennoch, hätte ich den Luxus gehabt zu wählen, so ging es mir immer wieder durch den Kopf, hätte ich eigentlich erst nach etwas mehr Vorbereitung Schriftstellerin werden wollen. Inzwischen weiß ich, dass es keine bessere Vorbereitung für das Schreiben gibt, als das Schreiben selbst, aber damals lasteten die pragmatischen Gründe, aus denen ich mich für das Buch entschieden hatte, schwer auf mir. Das Schreiben fühlte sich weniger wie ein Akt des kreativen Ausdrucks an, sondern mehr nach dem Bau einer Strickleiter, die mich in Sicherheit bringen sollte. Das war doch nicht echt, so schrieb man doch kein Buch, dachte ich. Wenn man wirklich schreibt, tut man das doch nicht, um sein Überleben zu sichern. Dass ich keine echte Schriftstellerin war, würden meine Leserinnen und Leser doch auf jeden Fall merken.
Und doch öffnete ich an diesem windigen Herbstabend vor zehn Jahren aus Mangel an Alternativen meinen Laptop und fing an zu tippen. Ich sagte mir einen Spruch aus meiner Kindheit vor: »Tue deinen Teil und lass Gott seinen übernehmen.« Ich habe schließlich nicht das geschrieben, was ich eigentlich ursprünglich hatte schreiben wollen, ich habe mich nicht an meinen Schreibplan oder an meine vorsichtig skizzierte Chronologie gehalten. Ich versank einfach in einer Kindheitserinnerung und schrieb, als lebte ich auf einmal wieder in diesem Moment. Dieser führte mich in eine andere Erinnerung, in die ich eintauchte, und darauf folgte wieder eine andere. Das alles fühlte sich an, als hätte mich ein Gespenst besucht, als könnte ich den Teil meiner selbst ausschalten, der sich auf Chronologie und Kapitel und Charaktere und all die anderen Dinge konzentrierte, die ich in College-Schreibworkshops gelernt hatte. Stattdessen konnte ich mich auf eine inneren Stimme verlassen, die ich längst verloren geglaubt hatte. Irgendwann, Stunden später in dieser Nacht, schaute ich von meinem Bildschirm auf, und es war Mitternacht. Die Hälfte meines Manuskripts war fertig.
Heute, so viele Jahre später, arbeite ich an meinem ersten Roman, ich schreibe ihn auf Deutsch. Und ich warte manchmal Wochen, wenn nicht Monate, darauf, dass dieses Gespenst von damals mich wieder besucht. Ich setze mich hin, um zu schreiben, und alles, was passiert, ist, dass ich mich in meinem logisch denkenden Gehirn gefangen zu fühle. Ich baue die Geschichten wieder wie Strickleitern, und dann, ganz plötzlich, kehrt das Gespenst scheinbar aus dem Nichts zu mir zurück. Meine Finger tanzen fieberhaft über die Tastatur, während sich der Rest von mir in einer Art Schwebezustand befindet. Die Zeit scheint still zu stehen, und alles um mich herum verschwindet. Ich finde meine innere Stimme. Sie ist im Laufe der Jahre immer wieder zu mir zurückgekommen, wenn auch nicht so oft, wie ich es mir gewünscht hätte. Mit der Zeit ist mir klargeworden, dass sie eigentlich immer bereit und willens ist aufzutauchen, und dass ich es bin, die ihre Anwesenheit nicht immer zulässt. Weil diese Stimme aus der Vergangenheit kommt und der Rest von mir sehr bemüht ist, in der Gegenwart zu bleiben, vertragen wir uns nicht besonders gut. Wir sind wie zwei Frauen, eine verloren und eine gefunden, die immer noch darum kämpfen, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen.
Am Ende dieses Buches, das hier vor Ihnen liegt, schreibe ich über das Gefühl, mein altes Ich umgebracht zu haben, um Platz für mein neues Ich zu schaffen, das Buch seien ihre allerletzten Worte, heißt es da. Aber vor zehn Jahren war ich weder in meiner Vergangenheit noch in meiner Gegenwart verortet. Ich befand mich in einem Schwebezustand zwischen den beiden, und »Unorthodox« ist das Buch, das es geworden ist, weil es in ebendiesem sowohl verheerenden als auch magisch schwerelosen Zwischenraum entstanden ist. Hätte ich mir die Zeit genommen, mich auf das Schreiben vorzubereiten, hätte ich damit gewartet bis – sagen wir zum Beispiel jetzt –, wäre dabei mit Sicherheit ein gutes Buch herausgekommen, aber es wäre bestimmt nicht das Buch geworden, das es hatte sein sollen. Mit dem zeitlichen Abstand wäre es sicher viel weniger intensiv geworden, hätte nicht diese besondere Erfahrung bei der Lektüre ermöglicht, von der mir so viele Leserinnen und Leser berichten. Der Grund, warum »Unorthodox« so direkt, unmittelbar und mit solcher Wucht wirkt, ist der, dass auch der Schreibprozess sich genauso angefühlt hat: wie ein ganz besonderer Zustand, der so nie wieder herstellbar ist.
Nachdem ich mich also von meinem alten Selbst befreit hatte, entdeckte ich darunter zu meiner Überraschung nicht etwa eine authentischere Version, wie ich es mir so bequem vorgestellt hatte. Wenn man sich aus dem eigenen Leben herausschneidet, bleibt einem nicht viel. Es dauert mindestens ein Jahrzehnt oder länger, um ein neues Ich und auch ein dazugehöriges Leben aufzubauen. Und hätte mir jemand gesagt, wie schwer das sein würde, hätte ich mich der Herausforderung möglicherweise gar nicht gestellt.
Trotzdem, dem Glauben, dass es einfach werden würde, war ich eigentlich nie verfallen. Ich hatte kein märchenhaftes Ende im Kopf, und ich denke, das hat mir in all den Jahren sehr geholfen. Glück hat seine eigene Art, mit einem Verstecken zu spielen, wenn man es aktiv verfolgt, aber es überrascht einen oft, wenn man es am wenigsten erwartet. Ich habe meine Version des Glücks in Berlin gefunden. Wenn mir das jemand vor zehn Jahren vorhergesagt hätte, hätte ich den Gedanken unglaublich witzig gefunden, ehrlich gesagt sogar ein bisschen wahnsinnig …
Ich lebe jetzt seit fünf Jahren in Berlin. Es gibt einige wie mich, die hier ein Zuhause gefunden haben. Berlin ist voller Geflüchteter, Aussteigerinnen und Aussteiger, darunter einige ehemalige chassidische und orthodoxe Jüdinnen und Juden. Das liegt teilweise an Berlin selbst, der Stadt, von der man scherzt, sie stünde auf Sand und Sümpfen und trüge keine tiefe Wurzeln in ihrem Boden, perfekt also für diejenigen, die sich selbst entwurzelt haben oder die gegen ihren Willen entwurzelt wurden. Aber es liegt bestimmt auch daran, dass die Vergangenheit für einen viel erträglicher wird, wenn man sie physisch hinter sich gelassen hat. In New York City zu leben ist für viele junge Menschen immer noch ein Traum, aber für mich war die Stadt viel mehr ein Hinterhof voller Skelette, ein Labyrinth vertrauter Gesichter und ein Minenfeld schlechter Erinnerungen. Was andere in New York suchen, habe ich in Berlin gefunden.
Zehn Jahre nach den Anfängen meines Schreibens in New York, fünf Jahre nach meinem Ankommen in Berlin wurde diesen Sommer eine Miniserie gedreht, die von dem Buch, das ich damals geschrieben habe, inspiriert ist. Die Serie wurde in meiner Muttersprache Jiddisch vor Berliner Kulissen von einem unglaublichen Team aus deutsch-jüdischen, amerikanisch-jüdischen und deutschen Frauen gedreht. (Und einige Männer waren auch beteiligt.) Meine Geschichte auf einer Leinwand zu sehen, ist ein Traum, der in Berlin seine Wurzeln schlug und der, da bin ich mir sicher, nur hier möglich war verwirklicht zu werden. Frauen zu finden, die in der Lage sind, so viel Weisheit und Leidenschaft in das Projekt einzubringen – und so viel Bereitschaft, Neuland zu erkunden –, hätte ich mir nicht vorstellen können, bevor ich in diese Stadt gekommen bin, an einen Ort, an dem kreativer Ausdruck kaum konventionelle Grenzen kennt.
Eine der größten Überraschungen bei der Entwicklung von »Unorthodox«, der Serie, war die magische Anziehungskraft, die sie auf so viele Männer und Frauen mit ähnlichen Hintergründen wie meinem auszuüben schien. Sie kamen als Schauspielerinnen und Statisten, als Beraterinnen und Übersetzer, so dass es sich am Set anfühlte, als würde man an einem besonders emotionalen Wiedersehen teilnehmen. Letztendlich ist die in der Serie erzählte Geschichte, obwohl sie von den Ereignissen in meinem eigenen Leben inspiriert ist, viel größer als das. Es ist die Geschichte von so vielen Menschen, eine Geschichte, die mir genauso gut wie anderen gehören könnte – sie könnte sogar Ihnen gehören. Wo kleine Details geändert wurden, bleiben die Themen Schmerz, Konflikt, Einsamkeit und Demütigung gleich. Indem ich zusah, wie »Unorthodox«, das Buch, zu »Unorthodox«, die Serie, wurde, war es für mich, als würde meine eigene Lebensgeschichte Teil einer größeren kulturellen Erzählung werden, ein Phänomen, das ich zutiefst berührend fand. Als ich jünger war, las ich Bücher über rebellische Musliminnen und Christen und schaute später auch Filme über deren Geschichten, aber es war immer schwierig, mich darin zu spiegeln. Der vielleicht größte Triumph von »Unorthodox« ist seine Fähigkeit, als Vorlage für eine Reise zu dienen, die viele bereist haben und für die es trotzdem noch keine detaillierte Karte gibt.
In den letzten zehn Jahren hat sich der Ausstieg aus der ultraorthodoxen Gemeinde von einer Anomalie zu einer Bewegung entwickelt. Früher konnte ich die Namen der Leute, die diese Reise antraten, an zwei Händen abzählen. Jetzt sind sie zu unzähligen Tausenden geworden, sie verschwinden in der Anonymität der Städte überall auf der ganzen Welt, erfinden sich nach besten Kräften neu. Einige von ihnen tauchen dann in Berlin wieder auf, um an einem Set zu arbeiten, an dem ihre Muttersprache gesprochen wird, an dem sie auf sofortiges Erkennen zählen können und wo die Geschichte, zu deren Erzählung sie jetzt beitragen, sich sehr nach ihrer eigenen anfühlt. Für den ehemaligen Rabbiner und die jugendliche Ausreißerin, den Fulbright-Gelehrten und die Spätentschlossene gibt es in den Szenen, die wir gedreht haben, eine Wahrheit, die auf eine ganz intuitive, tief in uns verwurzelte Art und Weise zu jedem von uns spricht.
Als ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal alle Folgen der Serie gesehen habe und endlich das volle Ausmaß unserer gemeinsamen Arbeit begriff, wurde mir schlagartig klar, dass »Unorthodox« jetzt nicht mehr zu mir gehört. Ich habe es losgelassen, und dabei ließ es mich ebenfalls los.
Deborah Feldman, Berlin 2020
SATU MARE, auf Jiddisch Satmar, ist eine an der Grenze von Ungarn zu Rumänien gelegene Stadt. Wie also kommt es, dass eine chassidische Sekte nach einer Stadt benannt wurde? Bei seinem Auftrag, berühmte Juden vor dem sicheren Tod während des Zweiten Weltkriegs zu schützen, rettete der jüdisch-ungarische Rechtsanwalt und Journalist Rudolf Kasztner das Leben des Rabbiners von Satu Mare. Dieser Rabbiner emigrierte später nach Amerika und versammelte eine große Gruppe weiterer Überlebender, mit denen er eine chassidische Sekte gründete, die er nach seiner Heimatstadt benannte. Andere überlebende Rabbiner folgten dem Beispiel, benannten ihre eigenen Sekten nach den Städten, aus denen sie kamen, und versuchten so, die Erinnerung an die Shtetlech und Gemeinden zu bewahren, die durch den Holocaust ausgelöscht worden waren.
Chassidische Juden in Amerika kehrten bereitwillig zurück zu einem Erbe, das an der Schwelle des Verschwindens gestanden hatte, trugen traditionelle Kleidung, sprachen, wie ihre Vorfahren auch, ausschließlich Jiddisch. Viele von ihnen lehnten die Gründung des Staates Israel bewusst ab, da sie glaubten, dass der Genozid an den Juden als Strafe für Assimilation und Zionismus über sie gekommen war. Chassidische Juden aber richteten ihr wichtigstes Augenmerk auf die Fortpflanzung und wollten die vielen, die umgekommen waren, ersetzen und ihre Reihen wieder erstarken lassen.
Bis zum heutigen Tag haben die chassidischen Gemeinden nicht aufgehört, rasant anzuwachsen, was als endgültige Rache an Hitler verstanden wird.
Die Namen und charakteristischen Identifikationsmerkmale aller Personen in diesem Buch wurden geändert. Wenngleich auch alle in diesem Buch beschriebenen Vorkommnisse wahr sind, so wurden doch bestimmte Ereignisse verkürzt, verdichtet oder neu angeordnet, um die Identität der in sie involvierten Personen zu schützen und den Fluss der Erzählung zu gewährleisten. Jeder einzelne Dialog ist, entsprechend meiner genauesten Erinnerung, eine bestmögliche Annäherung an die Form, in der er tatsächlich stattgefunden hat.
»Matilda sehnte sich danach, dass ihre Eltern gut wären und liebevoll und verständnisvoll und ehrbar und intelligent. Die Tatsache, dass sie nichts davon waren, war etwas, das sie hinzunehmen hatte …
Da sie sehr klein war und sehr jung, war die einzige Macht, die sie über jeden in ihrer Familie besaß, die Macht ihrer Intelligenz.«
Aus: Matilda,
von Roald Dahl