

Buch
Fünfzehn Jahre ist es her, dass die damals 11-jährige Rachel Cunningham ihre Mutter erschoss. Ein tragischer Unfall – so ihre Erinnerung. Seither lebt Rachel freiwillig in einer psychiatrischen Klinik, ohne ihre Schuldgefühle je überwunden zu haben. Doch Trevor Lehto, ein Bekannter und angehender Journalist, möchte für eine Reportage mehr über den damaligen Fall herausfinden. Auch in Rachel erwacht der Wunsch, sich endlich der ganzen Wahrheit zu stellen. Wild entschlossen verlässt sie die Klinik und fährt zu ihrer Tante Charlotte und ihrer Schwester Diana, die im Elternhaus von Rachel und Diana leben, einem herrschaftlichen Jagdhaus. Damit begibt sich Rachel jedoch in höchste Gefahr, denn die beiden hüten ein tödliches Geheimnis …
Autorin
Karen Dionne hat in jungen Jahren mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter ein alternatives Leben in einer Hütte auf der Upper Peninsula geführt. Ihre Erfahrungen in der Wildnis von Michigan inspirierten sie zu ihrem Psychothriller-Debüt und großen Bestseller »Die Moortochter«, dem mit »Die Rabentochter« wieder ein packender Psychothriller folgt. Heute lebt Karen Dionne mit ihrem Mann in einem Vorort von Detroit, wo sie an weiteren Spannungsromanen schreibt.
KAREN DIONNE
DIE
RABEN
TOCHTER
PSYCHOTHRILLER
Deutsch von Andreas Jäger
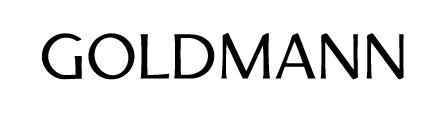
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Wicked Sister« bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © der Originalausgabe 2020 by Karen Dionne
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by arrangement with K Dionne Enterprises LLC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: Haus: Drunaa/Trevillion Images;
Sumpf: Nicola Smith/Trevillion Images
Redaktion: Eva Wagner
BH · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-20796-0
V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz









Für Jeff –
für dein unerschütterliches Vertrauen in mich und meine Schriftstellerei und dafür, dass du mit deiner Idee den Keim zu diesem Buch gelegt hast.
Die Wahrheit ist wie die Sonne. Du kannst sie eine Zeit lang ausblenden, aber verschwinden wird sie nicht.
ELVIS PRESLEY
Eins
HEUTE
Rachel
Manchmal, wenn ich die Augen schließe, halte ich ein Gewehr in den Händen. Meine Hände sind klein, meine Finger kurz und dick. Ich bin elf Jahre alt. Das Gewehr an sich ist nichts Besonderes, nichts unterscheidet es von irgendeinem anderen Remington. Außer dass es das Gewehr ist, das meine Mutter getötet hat.
In meiner Vision stehe ich vor meiner Mutter, die am Boden liegt. Das Gewehr zielt auf ihre Brust. Ihr Mund ist offen, und ihre Augen sind geschlossen. Ihre Brust ist rot.
Mein Vater kommt zur Haustür hereingestürmt. »Rachel!«, schreit er, als er mich sieht. Er fällt auf die Knie, nimmt meine Mutter in die Arme und blickt zu mir auf, seine Züge entstellt von Schock und Entsetzen.
Lange Zeit wiegt er meine Mutter in den Armen, als ob sie ein Baby wäre. Als ob sie noch lebte.
Schließlich legt er sie behutsam auf den abgetretenen Parkettboden und richtet sich langsam auf. Er nimmt das Gewehr aus meinen zitternden Händen, sieht mich an mit einem Schmerz, so groß, dass ich ihn nicht begreifen kann, und richtet das Gewehr gegen sich selbst.
Es war anders, sagt die Seidenspinne, die in der Mitte ihres Netzes sitzt, in einer Ecke des Zimmers, wo die Putzfrauen nie wischen. Dein Vater hat zuerst deine Mutter getötet und dann sich selbst.
Ich verstehe nicht, warum die Spinne lügt. Normalerweise sagen Spinnen die Wahrheit.
»Woher willst du das wissen?«, kann ich mir nicht verkneifen zu fragen. Sie war nicht dabei, als meine Eltern starben. Ich schon.
Die Spinne betrachtet mich ernsthaft mit ihren acht glänzenden Augen. Ich weiß es, sagt sie. Wir alle wissen es.
Ihre Jungen wuseln an den Rändern des Netzes umher, winzig wie Staubkörnchen, und nicken.
Ich will der Spinne sagen, dass sie sich irrt, dass ich besser als alle anderen weiß, was an dem Tag passiert ist, als meine Eltern starben, und dass ich die Konsequenzen des Verbrechens, das ich als Kind begangen habe, besser verstehe, als sie es je können wird. Denn schließlich lebe ich seit fünfzehn Jahren damit. Wer einmal einen Menschen getötet hat, ist für immer gebrochen, zerschlagen in so viele unendlich kleine Teile, dass nichts und niemand sie je wieder zusammensetzen kann. Fragen Sie irgendeinen Autofahrer, der in betrunkenem Zustand einen Fußgänger überfahren hat; fragen Sie irgendeinen Jäger, der seinen Freund oder Schwager mit einem Hirsch verwechselt und erschossen hat.
Fragen Sie irgendeine Frau, die ein geladenes Gewehr in der Hand hielt, als sie noch zu klein war, um vorherzusehen, was passieren würde.
Meine Therapeuten sagen, dass ich an komplizierter Trauer leide, und versprechen mir, dass es mir irgendwann besser gehen wird. Meine Therapeuten irren sich. Es geht mir immer schlechter.
Ich kann nicht schlafen, und wenn ich schlafe, habe ich Albträume. Ich habe häufig Kopfschmerzen und ständig Bauchschmerzen. Früher hatte ich regelmäßig Selbstmordgedanken, bis mir klar wurde, dass es eine größere Strafe ist, den Rest meines Lebens in einer psychiatrischen Klinik zu verbringen. Ich esse, ich schlafe, ich lese, ich sehe fern, ich gehe spazieren. Ich atme die warme Sommerluft ein, spüre die Sonne auf meiner Haut, lausche dem Zwitschern der Vögel und dem Summen der Insekten. Ich sehe die Blumen erblühen, die Blätter sich verfärben, den Schnee fallen – und immer ist da dieser Gedanke, der alle anderen verdrängt, diese furchtbare Wahrheit, die tief in meinem Herzen brennt: Ich bin der Grund, weshalb meine Eltern nie wieder sehen, riechen, schmecken, lachen oder lieben werden. Ich bin schuld, dass meine Eltern tot sind.
Die Polizei hat den Tod meiner Eltern als erweiterten Suizid eingestuft, begangen von meinem Vater. Alle Zeitungsberichte, die ich habe finden können, stimmen darin überein: Peter James Cunningham (45) tötete aus unbekannten Gründen seine Ehefrau, Jennifer Marie Cunningham (43), und richtete anschließend die Waffe gegen sich selbst. Manche Journalisten spekulieren, dass ich gesehen haben müsse, wie mein Vater meine Mutter erschoss, und deswegen weggelaufen sei. Andere mutmaßen, dass ich die Leichen meiner Eltern gefunden hätte und deswegen durchgedreht sei. Ich hätte ihnen gesagt, dass ich dafür verantwortlich war, wenn ich in der Lage gewesen wäre zu sprechen. Als ich drei Wochen später aus meiner Katatonie erwachte, ließ ich jeden, der es hören wollte, wissen, was ich getan hatte.
Aber bis heute will mir niemand glauben. Nicht einmal die Spinne.
Zwei
Ich lasse die Spinne mit ihrem Nachwuchs allein, und nach einem Blick auf meine Armbanduhr – ein billiges Plastikteil, das meine Tante Charlotte im Dollar Store gekauft hat, nachdem die letzte, die sie mir geschenkt hatte, gestohlen worden war – gehe ich die zwei Treppen nach unten in den Gemeinschaftsraum. Auf einem der Kabelkanäle läuft heute Nachmittag der erste Star-Trek-Kinofilm, und ich habe meinem Freund Scotty versprochen, dafür zu sorgen, dass niemand auf ein anderes Programm umschaltet. Meine Schritte hallen im leeren Treppenhaus wider. Ich trage Tennisschuhe – mit Klettverschluss, etwas anderes ist uns nicht gestattet. Die Keramik-Bodenfliesen sind gesprungen oder fehlen ganz, der Putz an den Wänden und der Decke bröselt und blättert ab. Mein Zimmer ist in einem der ältesten Gebäude, das aus der Zeit der Eröffnung der Klinik im Jahr 1895 stammt, als es noch die »Irrenanstalt Upper Peninsula« war. »Regionales Psychiatrisches Zentrum Newberry«, wie es sich heute nennt, klingt definitiv besser, aber es ist trotzdem, was es ist: eines von zwei großen psychiatrischen Krankenhäusern für Erwachsene im Staat Michigan. Dieses hier liegt auf der Upper und das andere auf der Lower Peninsula. Einrichtungen, in denen psychisch Kranke Heilung suchen, und in denen die unheilbar Geisteskranken den Rest ihrer Tage verbringen. Ich finde mich irgendwo dazwischen.
Ich trete aus dem Treppenhaus und laufe gegen eine Wand aus Lärm. Im Flur wimmelt es von Menschen. Patienten, Krankenschwestern, Patientinnen mit Schwestern, die im Gleichschritt neben ihnen her marschieren – denn nach den Mahlzeiten darf man Bulimikerinnen nicht allein lassen. Pfleger, Reinigungskräfte, ein Arzt im weißen Kittel. Ich schiebe mich dicht an der Wand entlang, den Kopf gesenkt. Ich spreche niemanden an. Niemand spricht mich an. Meine Therapeuten sagen immer, dass ich meine Zimmergenossinnen und die anderen in meiner Therapiegruppe besser kennenlernen sollte. Aber was für einen Sinn hat es, sich mit jemandem anzufreunden, der ohnehin irgendwann weg ist? Ich bahne mir meinen Weg durch den verglasten Durchgang zwischen den Schlafsälen und dem Verwaltungsgebäude, der sich an sonnigen Tagen höllisch aufheizt – unzerbrechliches Plexiglas, wie das Personal jedem Neuankömmling sogleich erklärt –, und öffne die Tür zum Gemeinschaftsraum.
Der Gemeinschaftsraum ist genauso trostlos, wie man es von einer hundert Jahre alten psychiatrischen Anstalt erwarten würde: schmutzfleckige cremefarbene Wände; abgetretene grüne Asbest-Bodenfliesen; die Fenster mit massiven Metallstreben unterteilt, damit niemand rausspringen kann; Kunstledersessel und -sofas, mit Klebeband geflickt und am Boden festgeschraubt. Auch hier ist es laut – der Ton des Fernsehers ist viel zu weit aufgedreht, um das Stimmengewirr von Besuchern und Patienten zu übertönen, die wiederum viel zu laut reden, um den Fernseher zu übertönen. Und der Geruch – ein Mix aus abgestandenen Kochdüften und Desinfektionsmittel, von dem meine Tante Charlotte sagt, dass er sie an ein Altersheim erinnert, nur überlagert von Zigarettengestank.
Hier im Krankenhaus rauchen so gut wie alle. Zigaretten sind gratis – ob das ein raffinierter Trick der Tabakkonzerne ist, um uns abhängig zu machen und lebenslang an sie zu binden, oder ob es nur ein weiteres Beruhigungsmittel im reichhaltigen Arsenal der Klinik ist, vermag ich nicht zu sagen. Nur Feuerzeuge und Streichhölzer sind uns verboten, genau wie Schnürsenkel, Kordeln, Einkaufstüten aus Plastik, Mülltüten und Dutzende andere gewöhnliche, aber potenziell tödliche Gegenstände, die Menschen außerhalb von psychiatrischen Anstalten tagtäglich benutzen.
Dennoch hat es in meiner Zeit hier zwei vollendete Selbstmorde gegeben. Ein Mädchen hat einen Pullover aufgedröselt und das Garn zu einem Strick geflochten, den sie sich um den Hals legte. Dann warf sie das andere Ende über ein Rohr unter der Decke des Badezimmers, stieg auf die Toilettenschüssel und sprang hinunter. Eine andere trank eine Flasche Abflussreiniger, die sie von einem Putzwagen gestohlen hatte, als niemand hinschaute. Die Putzfrau verlor deswegen ihren Job. Trotzdem: Wenn man bedenkt, dass mindestens die Hälfte der Patienten hier sind, weil sie entweder versucht haben, sich das Leben zu nehmen, oder damit gedroht haben, muss man die Leistung des Personals durchaus anerkennen.
»Ur-sa!«, ruft Scotty quer durch den Raum, als er mich erblickt. Er springt auf und wedelt mit den Händen.
Ich lächle und winkte zurück. Scotty ist ein Kind im Körper eines Mannes: groß und breitschultrig, mit Armen, die aussehen, als ob er einen mit einer Umarmung erdrücken könnte. Aber innen drin ist er weich wie ein Gummibärchen, mit blassblauen Augen und straßenköterblonden Haaren und geistig ungefähr auf dem Stand eines Neunjährigen. »Scotty« ist übrigens nicht sein richtiger Name – ich nenne ihn nur so wegen seines Faibles für Star Trek, so, wie er mich »Ursula« nennt wegen meiner Liebe zu Bären.
Scottys Bruder Trevor wartet ebenfalls auf dem Sofa. Mein Magen schlägt wie gewohnt Purzelbäume, als ich ihn sehe. Ich wusste natürlich, dass er hier sein würde – wir sind nach dem Film zu einem Gespräch unter vier Augen verabredet –, aber diese Wirkung hat er nun mal auf mich, da kann ich nichts machen. Trevor Lehto ist achtundzwanzig, zehn Jahre jünger als Scotty und zwei Jahre älter als ich. Heute trägt er ein Holzfällerhemd mit hochgekrempelten Ärmeln, Converse-Sneakers und Jeans, was alles gut zu seinen braunen Haaren und Augen und dem Dreitagebart passt, der irgendwie natürlich und gepflegt zugleich wirkt. Ich habe selbst braune Haare und Augen und trage Jeans und karierte Baumwollhemden, weil das praktisch die Einheitskleidung für Männer wie Frauen auf der Upper Peninsula ist. Aber Trevor steht der Look so gut, dass es den Leuten auffällt. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige hier im Krankenhaus bin, die in ihn verknallt ist.
»Lange nicht gesehen«, sage ich, während ich mich ans andere Ende des Sofas setze, mit Scotty zwischen uns. »Gut schaust du aus.«
Das ist nicht nur reine Höflichkeit. Trevor ist braun gebrannt, und – nach seinen muskulösen Unterarmen zu schließen – so durchtrainiert, wie ich ihn noch nie gesehen habe. So sieht man wohl aus, wenn man sechs Monate mit dem Rucksack durch Nordpatagonien gewandert ist.
»Danke. Bin gerade erst zurückgekommen. Und natürlich musste ich als Allererstes den Burschen hier besuchen.«
Er boxt seinen Bruder in den Arm. Scotty grinst und boxt zurück. Und auch ich muss unwillkürlich lächeln. Scottys Lächeln ist so rein und aufrichtig wie sein Herz. Es braucht nicht viel, um ihn glücklich zu machen, und das ist einer der Gründe, warum ich gerne Zeit mit ihm verbringe. Manche Leute glauben, dass ich mich nur mit Scotty angefreundet habe, um mich an Trevor ranmachen zu können, aber das stimmt nicht. Ich verstehe ja, dass unsere Freundschaft manch einem seltsam vorkommen mag, wenn man bedenkt, dass ich einen IQ von hundertzwanzig habe und Scotty vielleicht gerade mal die Hälfte. Dabei ist genau das ein wichtiger Grund, warum unsere Freundschaft funktioniert. Scotty akzeptiert mich als die, die ich bin, und er verlangt keine Gegenleistung dafür. Und was das Wichtigste ist: Er stellt keine Fragen.
»Wo hat er denn das Veilchen her?«, fragt mich Trevor. »Er will’s mir nicht sagen.«
»Keine Ahnung. Mir will er es auch nicht sagen, und alle anderen halten den Mund.«
Es ist zwar denkbar, dass Scotty die Treppe hinuntergefallen oder gegen eine Tür gelaufen ist, ohne dass jemand anders die Finger im Spiel hatte. Aber wahrscheinlicher ist es, dass einer der Pfleger ihn absichtlich geschlagen oder ihm ein Bein gestellt hat. Die meisten sind gebaut wie Footballspieler, und manche waren das auch, bevor sie wegen eines kaputten Knies oder einer anderen Verletzung den Sport aufgeben mussten und irgendwann hier landeten. Es kann eigentlich nicht gut gehen, wenn man hilflose Bewohner der Obhut von verbitterten, körperlich weit überlegenen Menschen überlässt, und Scotty ist ein leichtes Opfer. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit unerklärlichen Verletzungen und Blutergüssen daherkommt, und leider wird es auch nicht das letzte Mal sein. Trevor versucht schon seit Längerem, eine gute betreute Wohnung in der Nähe von Marquette zu finden, damit er ein Auge auf seinen Bruder haben kann, aber bislang ohne Erfolg. Es gibt nicht viele Einrichtungen, die bereit sind, einen geistig behinderten paranoiden Schizophrenen aufzunehmen.
»Pthhht!«, macht Scotty, als der Film anfängt.
Wie zu erwarten, erhebt sich ringsum genervtes Stöhnen, und alles ruft durcheinander: »Nicht schon wieder der Mist!« und »Umschalten!«
Genau deswegen habe ich heute Morgen den richtigen Sender eingestellt und mir die Fernbedienung unter den Nagel gerissen. Ich drehe den Ton laut und stecke die Fernbedienung zwischen die Sofakissen.
Der Film macht dann doch wesentlich mehr Spaß, als ich gedacht habe – hauptsächlich, weil Scotty die ganzen zwei Stunden lang gebannt auf der Sofakante hockt, vornübergebeugt und mit den Händen zwischen den Knien, während Trevor und ich uns zurücklehnen und hinter seinem Rücken Blicke tauschen und die Augen verdrehen. Dann und wann sieht eine Frau am anderen Ende des Zimmers, die verbissen vorgibt zu lesen, von ihrem Buch auf und durchbohrt Trevor und mich abwechselnd mit Blicken, was mir vielleicht ein bisschen zu viel Genugtuung verschafft.
Sobald der Abspann zu Ende ist, springt Scotty auf. »Möge die Macht mit euch sein«, sagt er feierlich.
Für jeden anderen muss Scottys Segen sich wie sinnloses Gestammel anhören: Möh-ehe-Mah-mi-öh-sah – gesprochen mit monotoner Stimme, die Silben durch quälend lange Pausen getrennt und mit großer Anstrengung hervorgestoßen. Ich kann nicht erklären, wieso ich in der Lage bin, seine Mund-voll-Murmeln-Sprechweise zu verstehen, genauso wenig, wie ich meine Fähigkeit erklären kann, die Spinne zu verstehen. Ich sage ihm nicht, dass das ein Zitat aus Star Wars ist und nicht aus Star Trek.
»Zwei Wochen!«, ruft Trevor ihm hinterher, als Scotty sich auf dem Absatz umdreht und schnurstracks auf sein Zimmer im Männerblock zusteuert. Scotty gibt keine Antwort.
Trevor steht auf und streckt sich. »Puh, das war brutal. Wollen wir gleich anfangen, oder brauchst du noch ein paar Minuten?«
»Fangen wir an.«
Ich hätte zwar nichts gegen eine Pinkelpause, bevor wir uns an die Arbeit machen, aber die öffentlichen Toiletten auf dieser Etage sind abgeschlossen, und ich habe keine Lust, in die Zentrale runterzugehen und um den Schlüssel zu betteln. Ich lasse die Fernbedienung auf dem Sofa liegen – soll sie sich nehmen, wer mag – und folge Trevor zu einem freien Tisch in größtmöglicher Entfernung zum Fernseher.
Als Trevor anrief, um zu sagen, dass er sich entschieden habe, Journalismus als Hauptstudium zu wählen, und fragte, ob er mich für einen dieser »Was-macht-XY-eigentlich-heute?«-Artikel interviewen könne, wurde mir bewusst, dass das Universum mir ein Geschenk gemacht hat. Fünfzehn Jahre lang hat niemand der These widersprochen, wonach mein Vater meine Mutter ermordet hat. Ich bin die Einzige, die weiß, dass er es nicht getan hat. Dieses Interview ist eine Chance, noch etwas Gutes aus meinem nutzlosen, vergeudeten Leben zu machen – vielleicht meine einzige Chance, denn es ist nicht so, als ob die Reporter mir die Tür eingerannt hätten.
Trotzdem bin ich nervös. Einem aufstrebenden Journalisten zu erzählen, dass ich meine Mutter getötet habe, und ihm zu erlauben, meine Wahrheit zu veröffentlichen, wird unweigerlich Konsequenzen nach sich ziehen: Skepsis und Spott, falls man mir nicht glaubt, gefolgt von noch mehr Therapien, noch mehr Albträumen, noch mehr Medikamenten. Vielleicht auch wieder Sonderbewachung wegen Selbstmordgefährdung, wenn sich herausstellt, dass ich mit dem Druck nicht klarkomme. Und das will ich auf keinen Fall, denn dann werden sie mich keine Sekunde mehr allein lassen, nicht einmal beim Pinkeln. Oder, wenn man meiner Geschichte Glauben schenkt, eine polizeiliche Ermittlung, die Rehabilitierung meines Vaters und möglicherweise eine Gefängnisstrafe für mich.
Ganz abgesehen davon, dass Trevor, wenn er erfährt, dass ich meine Mutter getötet habe, mich künftig mit anderen Augen betrachten wird. Ich habe es zu oft erlebt, dass Leute in der Gruppentherapie ihr Herz ausschütten im Glauben, dass es ihnen danach besser geht, nur um dann festzustellen, dass sie, indem sie ihre tiefsten, dunkelsten Geheimnisse preisgaben, alles noch tausendmal schlimmer gemacht haben. Wenn man einmal weiß, dass der Onkel dieser Frau dort sie missbraucht hat, während ihr Stiefvater alles filmte, damit sie die Videos im Darknet verkaufen konnten, oder dass der süße Junge, in den man mit vierzehn verknallt war, die ersten sieben Jahre seines Lebens geglaubt hat, er sei ein Mädchen, weil seine Mutter ihn so angezogen und behandelt hat, und dass er mit sechzehn immer noch Probleme mit seiner geschlechtlichen Identität hatte, oder dass die Eltern der neuen Zimmergenossin jeden Bissen überwachten, der über ihre Lippen kam, und dass sie, wenn sie auch nur ein halbes Pfund zugenommen hatte, stundenlang in einem Fitnessraum trainieren musste, der eher einer Folterkammer glich – dann kann man das nur schwerlich wieder vergessen.
Ich muss mich daran erinnern, dass ich das hier machen will. Trevor mag den Anstoß zu diesem Interview gegeben haben, aber ich bin aus freien Stücken hier.
Ich setze mich. Er setzt sich. Ich warte.
»Was dagegen, wenn ich mitschneide?« Er greift in eine Umhängetasche aus grünem Segeltuch und stellt ein Aufnahmegerät zwischen uns auf den Tisch, ohne meine Antwort abzuwarten. Die Tasche sieht neu aus.
»Äh, nein. Mach nur«, sage ich, obwohl mir bei dem Gedanken, dass er eine Aufnahme unseres Gesprächs mitnehmen wird, schon mulmig zumute ist.
Es war kein einfacher Weg von der total verängstigten Elfjährigen, die von ihrer Tat so traumatisiert war, dass sie weder sprechen noch sich bewegen konnte, bis zu dem Punkt, an dem ich heute bin, wo – nun ja, wo ich immerhin gehen und sprechen kann. Man hat mir gesagt, dass ich absolut keine Reaktionen gezeigt hätte, als ich hier ankam, weder auf verbale noch auf physische Stimuli. Ich erinnere mich, dass ich sehen und hören konnte, doch immer, wenn mir endlich etwas eingefallen war, was ich tun oder sagen wollte, schien es mir einfach nicht der Mühe wert, zu sprechen oder mich zu bewegen. Ich weiß, dass das merkwürdig klingt, aber besser kann ich es nicht beschreiben. Mir war nicht langweilig, weil ich gar kein Gefühl für das Verstreichen der Zeit hatte. Die Stunden kamen mir vor wie Minuten, die Tage wie Stunden. Die drei Wochen, die ich in einem Körper gefangen war, der den Dienst verweigerte, ernährt über eine Magensonde und entleert durch einen Katheter, schrumpften zu einem einzigen, endlosen Tag zusammen. Ich konnte mich bewegen, aber nur, wenn jemand nachhalf, und dann blieb ich in dieser Position, bis man mich wieder bewegte. Was wohl ganz praktisch war, wenn es darum ging, mich vom Rollstuhl ins Bett zu heben und umgekehrt.
Mehr als alles andere ist mir eine überwältigende Müdigkeit in Erinnerung geblieben, wie man sie keinem Kind je wünschen würde. Es gab Momente, da schien mir selbst das Atmen zu anstrengend. Ich war verloren in einem Wirbel von Gedanken und Erinnerungen, über die ich keine Kontrolle hatte: Ich bin im Waffenzimmer. Ich hebe das Gewehr an meine Schulter. Ich schieße auf den Löwen in der Halle. Ich schieße auf ein Zebra und eine Gazelle. Ich bin eine Großwildjägerin und nicht ein elfjähriges Mädchen, das alle Lebewesen gleich gern hat und keiner Fliege etwas zuleide tun würde. »Was tust du da?«, schreit meine Mutter, als sie mich sieht. »Leg das Gewehr weg!« Also lege ich es weg. Es gibt einen lauten Knall. Meine Mutter fällt hin. Sie steht nicht mehr auf. Eine Szene, die sich seit fünfzehn Jahren in einer Endlosschleife vor meinem inneren Auge abspielt, wie ein Film, immer gleich, bis ins kleinste Detail.
Trevor beginnt mit ein paar harmlosen Eröffnungsfragen, die ich leicht beantworten kann: Wie war es, meine Teenagerjahre in einer psychiatrischen Klinik zu verbringen? (So schlimm, wie es sich anhört, und schlimmer, als du es dir jemals ausmalen könntest.) Bist du zur Schule gegangen? (Ja, wir hatten Unterricht, aber ich habe die Abschlussprüfung nicht abgelegt, weil ich nicht vorhabe, die Klinik zu verlassen, wozu sollte das also gut sein? Letzteres sage ich ihm allerdings nicht.) Ob ich außer seinem Bruder noch Freunde habe? (Nein. Es sei denn, man rechnet die Spinne dazu, und unsere Beziehung eine »Freundschaft« zu nennen wäre wohl etwas übertrieben angesichts der Tatsache, dass sie mir ständig widerspricht. Ganz abgesehen davon, dass Seidenspinnen nur ungefähr ein Jahr alt werden und ich schon gar nicht mehr weiß, mit wie vielen Generationen ich mich schon angefreundet habe.) Was würde ich den Leuten gerne über mich sagen, was sie noch nicht wissen? (Die perfekte Gelegenheit, ihm zu sagen, dass ich meine Mutter getötet habe, aber dafür ist es noch ein bisschen zu früh im Interview, also zucke ich nur mit den Schultern.)
Er rutscht auf seinem Stuhl herum, ein Zeichen, dass er zu einem anderen Thema übergehen will. Ich mache mich bereit. Ich bin sehr gut im Lesen von Körpersprache. An einem Ort wie diesem muss man das sein.
»Lass uns jetzt über deine Kindheit reden. Erzähl mir, wie dein Leben war, bevor du in die Klinik kamst.«
»Was dagegen, wenn ich rauche?«, frage ich, um Zeit zu gewinnen, damit ich meine Worte in Ruhe aus dem Skript auswählen kann, das ich im Geist schon ausgearbeitet habe.
Von diesem Interview hängt so viel ab. Trevor muss verstehen, dass meine Eltern so glücklich miteinander waren, wie zwei Menschen es nur sein können, und dass mein Vater meine Mutter genauso wenig hätte töten können wie Romeo seine Julia. Wenn ich das erst einmal geklärt habe, kann ich ihm sagen, wer es wirklich getan hat. Und außerdem brauche ich wirklich eine Zigarette.
»Äh, nein. Ist schon in Ordnung.« Er wedelt mit der Hand die rauchgeschwängerte Luft weg, die das Zimmer erfüllt. »Ich sterbe wahrscheinlich sowieso an Lungenkrebs, ehe wir mit dem Interview fertig sind.«
Ich lache mit ihm und schüttle eine Zigarette aus der Schachtel. Dann halte ich sie hoch und warte, bis einer der Pfleger mich sieht und an den Tisch kommt, um mir Feuer zu geben.
»Bevor ich in die Klinik kam«, beginne ich, indem ich seine genaue Formulierung verwende – eine Gesprächstechnik, die ich von meinen Therapeuten gelernt habe, und mit der ich die unterschwellige Botschaft sende, dass er und ich auf einer Wellenlänge sind. »Bevor ich in die Klinik kam, hatte ich eine sehr glückliche Kindheit. Meine Eltern gehörten zu den Paaren, die einander wirklich lieben. Du weißt schon, was ich meine: kein Abschied am Morgen ohne einen Kuss – einen richtigen, nicht nur ein Küsschen auf die Wange. Händchenhalten auf der Straße. Beim Fernsehen nebeneinander auf der Couch sitzen, und nicht jeder an einem Ende. Meine Schwester sagt, dass unsere Eltern am Tag ihres Todes noch verliebter waren als an dem Tag, als sie sich kennenlernten, und das glaube ich gerne. Wir wurden beide zu Hause unterrichtet, deshalb haben wir viel Zeit miteinander verbracht. Wir vier wohnten zusammen mit der Schwester meiner Mutter in einem fantastischen zweigeschossigen Blockhaus, das mein Ururgroßvater damals in der Zeit der Holzbarone auf einem sechzehnhundert Hektar großen Anwesen südöstlich von Marquette erbaut hatte – aber das weißt du vermutlich schon«, füge ich hinzu und denke an die Millionen von Wörtern, die über uns schon geschrieben wurden.
»Das ist schon in Ordnung. Ich würde es gerne in deinen eigenen Worten hören.«
»Na schön.« Ich ziehe an der Zigarette, während ich überlege, wie ich das Gespräch am besten in die gewünschte Richtung lenken kann, und klopfe die Asche in einen der dünnen Aluminium-Aschenbecher, die im Raum verteilt stehen und eigentlich nur einmal verwendet werden sollen, die aber von der Klinik nie weggeworfen werden, weil wir als staatliche Einrichtung chronisch unterfinanziert sind.
»Meine Eltern waren Wildbiologen, wie du sicher auch schon weißt. Unser Land grenzte an drei Seiten an hohe Felsriegel, und an der vierten an einen großen See. Sehr isoliert, sehr unberührt. Meine Eltern pflegten zu sagen, in diesem fantastischen Ökosystem zu leben und zu arbeiten sei wie der Himmel auf Erden. Und weil das Land, auf dem meine Mutter und mein Vater forschten, den Eltern meines Vaters gehörte, und weil meine Eltern ihre Forschung selbst finanzierten, mussten sie sich gegenüber niemandem rechtfertigen, und so waren sie in der Wahl ihrer Methoden und ihrer Forschungsgegenstände vollkommen frei. Das Spezialgebiet meines Vaters waren Amphibien, während meine Mutter über Schwarzbären forschte. Sie haben immer gescherzt, dass meine Mutter doppelt so viel Testosteron haben müsse wie mein Vater – wegen ihrer Spezialisierungen, weißt du?«
Trevor lächelt und notiert sich den Scherz meiner Eltern. »Und wen hast du lieber gemocht? Die Frösche oder die Bären?«
»Ich habe alles geliebt, was sich bewegt«, antworte ich diplomatisch, obwohl die Wahrheit ist, dass ich mit Amphibien nicht viel anfangen kann, während ich von Schwarzbären mindestens so begeistert bin, wie meine Mutter es war, und es auch immer sein werde. »Ich habe meine Eltern öfter auf ihren Exkursionen begleitet. Mal watete ich durch die Tümpel und Bäche, eingehüllt in Moskitonetze und mit einer Wathose, wie sie mein Vater trug, und nahm Wasserproben und zählte Kaulquappen oder fing Frösche ein. Und am nächsten Tag kauerte ich neben meiner Mutter in ihrem Beobachtungsversteck und verfolgte aus wenigen Metern Entfernung, wie ein viereinhalb Zentner schwerer Schwarzbär an unserer Köderstation herumschnüffelte.«
»Klingt idyllisch.«
»Das war es auch.«
Ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich ernst meint, oder ob er mich dazu auffordert, es zu beweisen. Ich hoffe, dass ich meine Kindheit nicht in zu rosigen Farben male – er soll nicht glauben, dass meine Erinnerungen durch Wunschdenken und die zeitliche Distanz verfälscht sind. Dabei waren diese Jahre eher noch idyllischer, als ich sie geschildert habe, mit dem ganzen Zauber eines Märchens: eine wilde, wunderschöne Landschaft. Ein Jagdhaus, so prächtig wie ein Schloss inmitten eines geheimnisvollen, undurchdringlichen Waldes. Intelligente und liebevolle Eltern, die mich wie eine Prinzessin behandelten und mich in ihre Arbeit einbezogen, als ob ich eine Fachkollegin wäre, während sie mir gleichzeitig die Freiheit ließen, meine Welt zu erkunden, zu lernen und zu wachsen.
»Du hattest also kein Problem damit, allein durch diese Wälder zu streifen?«
»Nein, überhaupt nicht. Allein im Wald herumzustromern war für mich so natürlich, wie es für ein Stadtkind ist, sich in der U-Bahn zurechtzufinden.«
Er nickt, als ob ich etwas Bedeutendes bestätigt hätte, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, was das sein sollte. Dann zieht er seine Umhängetasche heran, kramt darin herum und nimmt eine schlichte braune Aktenmappe heraus.
»Ich möchte dir etwas zeigen. Das hier ist eine Kopie des Polizeiberichts. Ohne Fotos«, setzt er rasch hinzu. Er blättert die Mappe durch und zieht ein Blatt heraus, das er zwischen uns auf den Tisch legt. »Hier«, er tippt auf die Mitte der Seite. »Da geht es um dein Verschwinden.«
Natürlich hat er den spektakulärsten Teil meiner Geschichte herausgegriffen – wenn er auf eine Enthüllungsstory gehofft hat, kommt er allerdings exakt fünfzehn Jahre zu spät. Jeder kann meinen Namen zusammen mit »vermisstes Mädchen« googeln und haufenweise Artikel über mein Verschwinden finden, von Boulevardzeitungen bis hin zu den landesweiten Nachrichten. VERMISSTES MÄDCHEN GEFUNDEN! und KIND ÜBERLEBT WIE DURCH WUNDER ZWEI WOCHEN IN URWALDHÖLLE – SIE FAND DEN WEG ZURÜCK IN DIE ZIVILISATION, VERLOR ABER DIE SPRACHE. Und meine persönliche Lieblingsschlagzeile: MOWGLI-MÄDCHEN VON WÖLFEN GERETTET?
»In dem Bericht heißt es, als die Polizei am Tatort eintraf, seist du schon verschwunden gewesen«, hilft er nach, als ob ich die Details meiner eigenen Geschichte nicht kennen würde. »Sie haben eine Suche gestartet, aber inzwischen war die Erde so zertrampelt, dass man nicht erkennen konnte, in welche Richtung du gelaufen warst. In der Nacht schneite es dann, was jede Chance, am Morgen deine Spur aufzunehmen, zunichte machte. Trotzdem suchten sie tagelang nach dir – mit Hubschraubern, Spürhunden und allem –, doch je mehr Zeit verging, desto mehr mussten sie sich eingestehen, dass du höchstwahrscheinlich tot warst.«
»Genau. Bis mich dann zwei Wochen später ein Autofahrer am Straßenrand liegen sah«, unterbreche ich ihn im Bemühen, die Sache abzukürzen, damit wir zu dem Thema kommen können, über das ich eigentlich sprechen will.
»Am Straßenrand liegend, unfähig zu sprechen oder dich zu bewegen«, fügt er hinzu, was allerdings ein ziemlich dramatisches Detail ist. »Und dennoch – abgesehen davon und von ein paar Kratzern und Blutergüssen, warst du körperlich in erstaunlich guter Verfassung. Aber jetzt kommt die große Frage, Rachel: Ich bin auf der Upper Peninsula aufgewachsen. Ich weiß, wie das Wetter Anfang November ist. Minustemperaturen in der Nacht, und bei dem ganzen Neuschnee ist es praktisch undenkbar, dass du diese zwei Wochen ohne Hilfe überlebt hast. Und doch hast du es irgendwie geschafft. Ich weiß, dass du dich damals an nichts erinnern konntest, aber wie sieht es heute aus? Kannst du mir irgendetwas dazu sagen? Was hast du gegessen? Wie hast du dich warm gehalten? Wo hast du geschlafen?«
Er sieht so hoffnungsvoll aus, dass ich versucht bin, etwas zu erfinden, um ihn und seine künftigen Leser zufriedenzustellen. Mir kommt der Gedanke, dass ich ihm alles Mögliche erzählen könnte, ohne dass mir irgendjemand widersprechen könnte.
Doch leider sind mir jene Tage heute noch ebenso sehr ein Rätsel wie damals. Und außerdem mag ich es gar nicht, wenn jemand nicht die Wahrheit sagt.
»Nein, tut mir leid. Ich kann mich immer noch an nichts erinnern. Meine Therapeuten haben versucht, mir zu helfen, meine Erinnerungen zurückzugewinnen. Ich glaube, sie haben mich als persönliche Herausforderung betrachtet. Ich war dieses rätselhafte Mädchen, dieses Wolfskind, das plötzlich auftauchte, nachdem sie zwei Wochen lang verschwunden war, und keine Ahnung hatte, wo sie gewesen war oder was sie getan hatte. Aber irgendwann mussten wir akzeptieren, dass diese Tage für immer verloren sind.«
»Aber sind sie es wirklich? Sagt die Wissenschaft nicht, dass wir alles behalten, was wir je gesehen oder gehört haben? Diese Erinnerungen müssen doch noch irgendwo in deinem Gehirn herumfliegen.«
»Ja, schon. Im Prinzip ist das richtig. Ich meinte, dass meine Erinnerungen weg sind in dem Sinne, dass ich nicht an sie herankomme. Glaub mir, wir haben es versucht. Wenn es um Erinnerungen im Zusammenhang mit Kindheitstraumata geht, muss man berücksichtigen, dass das Gehirn so etwas anders verarbeitet als normale Erlebnisse. Manchmal sind sie so tief verschüttet, dass die Betroffenen gar keinen Zusammenhang herstellen zwischen ihren Problemen als Erwachsene und einem Ereignis, das ihnen als Kind widerfahren ist.«
Was ich ihm nicht sage, ist, dass ich mich an jene Tage gar nicht erinnern will und es auch nie wollte, was sicherlich eine große Rolle beim kollektiven Versagen meiner Therapeuten gespielt hat. Wenn das, was in dieser Zeit passiert ist, so verstörend war, dass mein Gehirn es für nötig hielt, die Erinnerung zu löschen, dann will ich es auch nicht wissen.
»Könntest du bitte einfach nur einen Blick darauf werfen? Vielleicht löst sich ja irgendeine Blockade, wenn du den Bericht liest.«
Ich nehme die Mappe, die er mir hinhält, obwohl die Beschäftigung mit den Details jenes Tages so ziemlich das Letzte ist, wonach mir im Moment zumute ist. Im Grunde will ich ihm nur entgegenkommen, weil er hundert Meilen gefahren ist, um mich zu interviewen, und wir wissen beide, dass ich ihm noch nicht viel geliefert habe.
Ich überfliege die Seiten rasch, mit gespieltem Interesse, bis ich zu einer Strichzeichnung eines Kindes neben der Abbildung eines schweren Gewehrs komme – und jetzt bin ich wirklich interessiert. Ich lese den dazugehörigen Absatz:
Nachdem die Tochter gefunden worden war, untersuchte der Rechtsmediziner das Mädchen und fand keine Spuren von Blutergüssen an ihren Gliedmaßen oder ihrem Rumpf, die durch das Abfeuern eines Winchester Magnum entstanden sein könnten. Angesichts der Größe des Gewehrs im Verhältnis zu Größe und Gewicht des Mädchens, in Verbindung mit dem Fehlen von Spuren am Körper, kam der Rechtsmediziner zu dem Schluss, dass die Tochter das Gewehr nicht abgefeuert haben kann.
Mein Herz pocht. Ich lege die Mappe vorsichtig auf den Tisch, wische mir die Hände an meiner Jeans ab und schiebe sie unter meine Oberschenkel, um sie am Zittern zu hindern. Ich verstehe das nicht. Ich habe meine Mutter erschossen. Ich habe sie getötet – ich weiß, dass ich es getan habe. Ich habe mich mit dem Gewehr in der Hand vor ihrer Leiche stehen sehen, schon so viele, viele Male.
Und doch gibt es keinen Grund anzunehmen, dass dieser Absatz irgendetwas anderes als die Tatsachen beschreibt. Wer immer diesen Bericht geschrieben hat, kann sich das nicht ausgedacht haben. Die Details sind zu spezifisch. Zu leicht zu widerlegen, wenn sie falsch wären. Selbst ich kann sehen, dass das abgebildete Gewehr – es ist nicht das Remington, das ich in meinen Visionen sehe – so groß ist, dass ich mit elf Jahren unmöglich in der Lage gewesen wäre, es zu heben.
Angesichts der Größe des Gewehrs im Verhältnis zu Größe und Gewicht des Mädchens, in Verbindung mit dem Fehlen von Spuren am Körper, kam der Rechtsmediziner zu dem Schluss, dass die Tochter das Gewehr nicht abgefeuert haben kann.
Es ist unmöglich. Und doch habe ich die Wahrheit hier direkt vor Augen, schwarz auf weiß.
Ich habe meine Mutter nicht getötet. Ich kann es nicht getan haben. Laut Polizeibericht habe ich dieses Gewehr niemals abgefeuert.