

Buch
Sizilien im 19. Jahrhundert. Als die Brüder Paolo und Ignazio Florio in Palermo ihr Glück suchen, besitzen sie nichts. Außer dem Willen, es ganz nach oben zu schaffen, und dem Mut, Neues zu wagen. Aus einem unbedeutenden Gewürzladen machen sie ein florierendes Unternehmen. Sie investieren klug und bringen es allen Anfeindungen zum Trotz zu Geld und Ansehen. Dann stirbt Paolo, und das Schicksal der Familie liegt in der Hand seines Sohnes Vincenzo. Unter ihm gedeiht die Casa Florio, in seinen Kellern wird aus dem Wein der Armen, dem Marsala, Siziliens größter Schatz. Doch immer wieder drohen Familienstreitigkeiten und Schicksalsschläge die Florios zu Fall zu bringen. Es sind nicht zuletzt starke Frauen, durch die sie dennoch zur bedeutendsten Familie der Insel aufsteigen.
Stefania Auci wurde in Trapani, Sizilien, geboren und lebt in Palermo. Nach ihrem Studium hat sie zunächst in einer Rechtsanwaltskanzlei und dann als Lehrerin gearbeitet, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Mit ihrer Familiensaga »Die Löwen von Sizilien« gelang ihr ein großer Bestseller. Der Roman war das meistverkaufte Buch Italiens 2019. Zurzeit schreibt Stefania Auci an einer Fortsetzung von »Die Löwen von Sizilien«.
Stefania Auci

Die Löwen von Sizilien
Die Geschichte einer Familie
Roman
Aus dem Italienischen
von Judith Schwaab
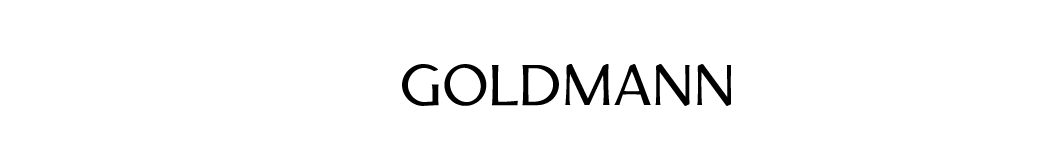
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »I leoni di Sicilia« bei Casa Editrice Nord, Gruppo editoriale Mauri Spagnol, Mailand.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2021
Copyright © der Originalausgabe by Stefania Auci, Edizione pubblicata in accordo con Donzelli Fietta Ageny s.r.l.s., © 2019 by Casa Editrice Nord s.u.r.l., Gruppo editoriale Mauri Spagnol
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Gestaltung des Umschlags und der Umschlaginnenseiten: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Zitronen, Ranken, Korb: FinePic®, München; Frau: Mark Owen/Trevillion Images; Composing-Element (Bäume): Drunaa/Trevillion Images; Haus, Landschaft: Yolande de Kort/Trevillion Images
Redaktion: Christina Neiske
BH · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-24315-9
V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz









Für Federico und Eleonora:
Für den Mut, die Unschuld, die Angst
und die Verrücktheit, die wir geteilt haben,
an verlorenen und wiedergefundenen Tagen.
Ob das Schlachtfeld auch verloren
Ist doch nicht alles hin; der Wille nicht,
Der unbesiegbar, nicht der Rache Durst,
Der ewge Hass und Muth, sich nie zu beugen,
Und was sonst noch unüberwindlich ist.
John Milton, Das verlorene Paradies
PROLOG
Bagnara Calabra, 16. Oktober 1799
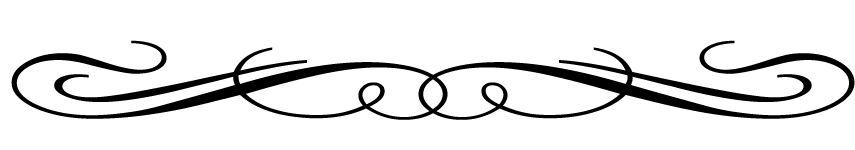
Cu nesci, arrinesci.
Wer weggeht, hat Erfolg.
Sizilianische Redensart
Das Erdbeben ist ein Grollen, das im Meer geboren wird. Es zwängt sich in die Nacht, schwillt an, wächst, verwandelt sich in ein Dröhnen, das die Stille zerreißt.
In den Häusern schlafen die Menschen. Einige von ihnen werden wach, als das Geschirr klappert; andere, als die Türen zu schlagen beginnen. Doch als die Wände beben, sind alle auf den Beinen.
Kühe muhen, Hunde bellen, es wird gebetet, geflucht. Die Berge schütteln sich, werfen Felsen und Schlamm ab, die Welt steht Kopf.
Der Erdstoß erreicht das Viertel Pietraliscia, greift nach dem Fundament eines Hauses, schüttelt es heftig.
Ignazio öffnet die Augen, aus dem Schlaf gerissen von dem Beben, das die Wände zum Wackeln bringt. Über ihm eine niedrige Decke, die jeden Moment auf ihn niederzustürzen scheint.
Es ist kein Traum. Es ist die schlimmste Wirklichkeit, die man sich vorstellen kann.
Vor ihm wogt das Kinderbett von Vittoria, seiner Nichte, zwischen der Wand und der Mitte des Zimmers. Auf der Sitzbank zittert die Metallkassette, fällt zusammen mit dem Kamm und dem Rasiermesser zu Boden.
Das Haus hallt von den Schreien einer Frau wider. »Hilfe, Hilfe! Ein Erdbeben!«
Bei diesem Schrei springt er auf. Doch Ignazio läuft noch nicht nach draußen. Zuerst muss er Vittoria in Sicherheit bringen, sie ist erst neun Jahre alt und hat fürchterliche Angst. Er zieht sie unter das Bett, wo sie vor dem herabstürzenden Putz in Sicherheit ist.
»Bleib hier, hast du verstanden?«, sagt er zu ihr. »Rühr dich nicht vom Fleck.«
Sie nickt. Ihre Angst ist so groß, dass es ihr die Sprache verschlagen hat.
Paolo. Vincenzo. Giuseppina.
Ignazio läuft aus dem Zimmer. Der Flur kommt ihm endlos vor, dabei sind es nur ein paar Schritte. Er spürt, wie die Wand unter seiner Hand weggleitet; es gelingt ihm, sie noch einmal zu berühren, doch sie bewegt sich, als wäre sie lebendig.
Er erreicht das Schlafzimmer seines Bruders Paolo. Durch die Fensterläden dringt ein Streifen Licht. Giuseppina, seine Schwägerin, ist vom Bett gesprungen. Ihr Mutterinstinkt hat sie vor einer Bedrohung Vincenzos gewarnt, ihres nur wenige Monate alten Sohnes, und sie geweckt. Sie versucht, den Säugling aus der Wiege zu nehmen, die an den Deckenbalken aufgehängt ist, doch das Weidenkörbchen ist zum Spielball der seismischen Wellen geworden. Die Frau weint vor Verzweiflung, streckt die Arme aus, während die Wiege heftig hin und her schwingt.
Der Schal, den sie trägt, fällt zu Boden, ihre Schultern sind nackt. »Figghiema! Ccà vene, Maronna mia, aiutateci! Mein Sohn! Kommt her, heilige Mutter Gottes, helft uns!«
Jetzt gelingt es Giuseppina, den Säugling zu ergreifen. Vincenzo reißt die Augen auf, fängt an zu weinen.
In dem Chaos bemerkt Ignazio einen Schatten. Sein Bruder Paolo. Er springt von der Matratze herunter, packt seine Frau, schiebt sie auf den Flur hinaus. »Raus hier!«
Ignazio macht wieder kehrt. »Warte! Vittoria!«, schreit er auf dem Weg zu seinem Zimmer. Im Dunkel unter dem Bett tastet er nach dem Mädchen und findet Vittoria. Da kauert sie, mit den Händen über dem Kopf. Er hebt sie hoch, läuft davon. Ganze Stücke Verputz lösen sich von den Wänden, das Heulen des Erdbebens geht weiter.
Er spürt, wie die Kleine bei ihm Schutz sucht, wie ihre Hände sich in sein Hemd krallen, den Stoff zerreißen. Sie kratzt ihn vor Angst.
Paolo schubst sie über die Schwelle, die Treppe hinunter. »Hierher, kommt.«
Sie laufen gerade durch den Innenhof, als die Erdstöße ihren Höhepunkt erreichen. Sie fallen einander in die Arme, ihre Köpfe berühren sich, die Augenlider geschlossen. Sie sind zu fünft. Alle sind da.
Ignazio betet und zittert, und er hofft. Es wird aufhören. Es muss aufhören.
Die Zeit zerspringt in Millionen Momente.
Dann, so plötzlich, wie es begonnen hat, nimmt das Dröhnen ab, hört schließlich ganz auf.
Einen Augenblick lang ist es einfach nur Nacht.
Doch Ignazio weiß, dass dieser Frieden trügerisch ist. Das Erdbeben ist eine Lektion, die er früh hat lernen müssen.
Er hebt den Kopf. Vittorias Panik spürt er durch sein Nachthemd hindurch, ihre Nägel, die sich in seine Haut krallen, ihr Zittern und Beben.
Er liest die Angst im Gesicht seiner Schwägerin und die Erleichterung in dem seines Bruders, er sieht, wie Giuseppina nach dem Arm ihres Mannes greift, doch dieser windet sich heraus, um sich dem Gebäude zu nähern. »Gott sei Dank, das Haus steht noch. Morgen, wenn es hell ist, schauen wir uns die Schäden an und …«
Vincenzo sucht sich ausgerechnet diesen Moment aus, um in heftiges Weinen auszubrechen. Giuseppina wiegt ihn in ihren Armen. »Ist ja gut, mein Augenstern, ist ja gut«, tröstet sie ihn und tritt auf Ignazio und Vittoria zu. Man sieht Giuseppina an, wie groß ihre Angst ist: Ignazio merkt es an ihrem hastigen Atmen, am Schweißgeruch, dem Odem der Angst, der sich mit dem Seifengeruch ihres Nachthemds mischt.
»Vitto’, wie geht es dir? Alles in Ordnung?«, fragt Ignazio.
Seine Nichte nickt, lässt das Hemd des Onkels aber trotzdem nicht los, packt es nur noch fester. Ignazio löst ihr Händchen mit Nachdruck. Doch er versteht die Angst des Mädchens: Die Kleine ist Waise, die Tochter seines Bruders Francesco. Er und seine Frau sind vor ein paar Jahren gestorben und haben das Kind in der Obhut von Paolo und Giuseppina gelassen, den Einzigen, die der Kleinen eine Familie und ein Dach über dem Kopf bieten konnten.
»Ich bin ja hier. Sei ganz beruhigt.«
Vittoria schaut ihn stumm an und klammert sich dann an Giuseppina, so wie sie sich noch kurz zuvor an ihn geklammert hat, wie eine Schiffbrüchige.
Vittoria lebt bei Giuseppina und Paolo, seit diese vor knapp drei Jahren geheiratet haben. In ihrer Art ähnelt sie sehr ihrem Onkel Paolo: Sie ist schweigsam, stolz, reserviert. Doch in diesem Moment ist sie lediglich ein kleines Mädchen, das sich fürchtet.
Angst tritt in vielen Gewändern auf. Ignazio weiß zum Beispiel, dass sein Bruder sich niemals damit aufhalten würde zu weinen. Mit finsterer Miene, die Hände in die Hüften gestützt, betrachtet Paolo den Hof und die Berge, die die Schlucht umschließen. »Heilige Mutter Gottes, wie lange hat es wohl gedauert?«
Seine Frage trifft auf Schweigen. Dann ergreift Ignazio das Wort: »Ich weiß es nicht. Lange.« Er versucht, das Beben in seinem eigenen Inneren zu beruhigen. Seine Miene ist angespannt, man sieht ihm die durchlittene Angst an. Ein heller Bartflaum sprießt an seinem Kinn, seine Hände sind schmal, nervös. Er ist jünger als Paolo, der wiederum älter wirkt, als er ist.
Die Anspannung weicht einer gewissen Erschöpfung, und allmählich machen sich körperliche Empfindungen bemerkbar: die Feuchtigkeit in der Luft, Schwindel, die Kälte der Kiesel unter den Füßen. Ignazio ist barfuß, unter dem Nachthemd praktisch nackt. Er streicht sich die Haare aus der Stirn, betrachtet den Bruder, dann die Schwägerin.
Nur ein Moment, dann ist es entschieden.
Er geht in Richtung Haus. Paolo folgt ihm, hält ihn am Arm fest. »Wo willst du denn hin?«
»Sie brauchen Decken.« Ignazio weist mit dem Kopf auf Vittoria und Giuseppina, die den Säugling im Arm hält. »Bleib du nur bei deiner Frau. Ich geh schon.«
Er wartet nicht auf eine Antwort. Eilig und vorsichtig zugleich steigt er die Treppe hoch. Am Eingang bleibt er einen Moment stehen, um seine Augen ans Halbdunkel zu gewöhnen.
Geschirr, Hausrat, Stühle: Alles ist zu Boden gegangen. Neben dem Backtrog schwebt noch eine Mehlwolke in der Luft.
Ihm wird bang ums Herz: Das hier ist das Haus, das Giuseppina als Mitgift in die Ehe mit seinem Bruder Paolo eingebracht hat. Es gehört ihnen, doch auch für Ignazio ist es ein Zuhause: ein Ort, an dem er sich behaglich und willkommen fühlt. Es ist erschütternd, es so zu sehen.
Ignazio zögert. Er weiß, was passieren kann, wenn es zu einem weiteren Erdstoß kommt.
Doch es ist nur ein Moment. Dann geht er hinein, reißt die Decken von den Betten.
Er geht in sein Zimmer, sucht nach der Satteltasche, in der er sein Werkzeug aufbewahrt, und hängt sie sich über die Schulter. Dann tritt er zu der eisernen Kassette, öffnet sie. Der Ehering seiner Mutter schimmert im Dunkeln, als wollte er ihn trösten.
Er legt das Kästchen mit dem Ring in die Satteltasche.
Im Flur entdeckt er Giuseppinas Schal, der auf dem Boden liegt: Die Schwägerin muss ihn auf der Flucht nach draußen fallen gelassen haben. Sie trennt sich nie von ihm: Seit dem allerersten Tag, als sie in die Familie kam, trägt sie ihn.
Er hebt ihn auf, wendet sich der Haustür zu und bekreuzigt sich unter dem Kruzifix, das über dem Türstock hängt.
Einen Moment später beginnt die Erde wieder zu beben.
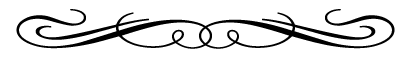
»Gott sei Dank war es diesmal kürzer.« Ignazio teilt die Decken mit dem Bruder; eine davon gibt er Vittoria. Am Ende der Schal.
Als er ihn ihr zurückgibt, greift sich Giuseppina verwirrt ans Nachthemd, fühlt nackte Haut. »Oh …«
»Den habe ich auf dem Boden gefunden«, erklärt Ignazio und senkt den Blick.
Sie murmelt »Danke« und kuschelt sich in den Stoff, auf der Suche nach Trost und Wärme in der ungewöhnlichen Kälte, die sie verspürt. Ein Schauder durchfährt sie, eine Mischung aus Angst und bösen Erinnerungen.
»Es hat keinen Sinn, draußen zu übernachten.« Paolo macht die Tür des Stalles auf. Die Kuh protestiert mit einem kurzen Muhen, als er sie am Strick zur gegenüberliegenden Wand führt und sie dort anbindet. Dann schlägt er einen Funken und entzündet eine Laterne, verteilt Heubüschel an der Wand. »Vittoria, Giuseppina, setzt euch.«
Es ist eine Geste der Fürsorge, das weiß Ignazio, doch der Ton, den Paolo anschlägt, duldet keine Widerrede. Die Frauen wirken seltsam gedankenverloren und schauen ratlos zum Himmel, auf die Straße. Wenn ihnen niemand sagte, was sie tun sollen, würden sie die ganze Nacht auf dem Hof stehen bleiben. Paolo übernimmt die Aufgabe eines Familienvaters. Stark sein, beschützen – das tut ein Mann, vor allem ein Mann wie Paolo.
Vittoria und Giuseppina lassen sich auf einem Strohbüschel nieder. Das kleine Mädchen rollt sich auf dem Boden zusammen und presst die geballten Fäuste vors Gesicht.
Giuseppina sieht sie an. Sie will der Erinnerung, die in ihr aufsteigt, Einhalt gebieten, doch sie ist hartnäckig, heimtückisch, sie greift ihr an die Kehle und zieht sie in die Vergangenheit zurück.
Ihre Kindheit. Ihre Eltern, tot.
Die Frau schließt die Lider, verscheucht mit einem tiefen Seufzer die Erinnerung. Oder sie versucht es zumindest. Sie drückt den kleinen Vincenzo an sich, öffnet dann ihr Nachthemd und legt ihn an die Brust. Die Händchen greifen nach ihrer zarten Haut, die Nägel kratzen sie rund um die Brustwarze.
Sie lebt, ihr Sohn lebt. Er wird nicht zum Waisen.
Ignazio hingegen steht reglos auf der Schwelle, betrachtet das Haus von der Seite. Obwohl es dunkel ist, sucht er nach Schäden, einem Riss etwa, einer eingedrückten Mauer, doch er kann nichts entdecken. Er kann es nicht glauben, wagt kaum zu hoffen, dass dieses Mal nichts passieren wird.
Die Erinnerung an seine Mutter ist wie ein Windstoß in der Nacht. Seine Mutter, wie sie lachte, wie sie ihm die Arme entgegenstreckte, und wie er, als er klein war, ihr entgegenlief. Die Schachtel in der Satteltasche kommt ihm auf einmal schwer wie ein Stein vor. Ignazio nimmt die Tasche, holt den Ring aus geschmiedetem Gold hervor. Er umschließt ihn mit der Hand und legt sie ans Herz.
»Mama.«
Er flüstert es nur. Es ist ein Gebet, vielleicht die Suche nach Trost. Nach einer Umarmung, die ihm fehlt, seit er sieben Jahre alt war. Seit seine Mutter Rosa gestorben ist. Man schrieb das Jahr 1783, das Jahr der göttlichen Heimsuchung, das Jahr, in dem die Erde so lange bebte, bis von Bagnara nur noch Schutt und Asche übrig waren. Jenes schreckliche Erdbeben, das halb Kalabrien und Sizilien zerstörte und Tausende Menschen das Leben kostete, davon allein zehn in einer einzigen Nacht nur in Bagnara.
Damals waren Giuseppina und er Nachbarn gewesen.
Ignazio erinnert sich gut an sie. Ein mageres, bleiches Ding, das – eingezwängt zwischen Bruder und Schwester – zwei Erdhügel mit einem einzigen Kreuz darauf anstarrte: ihre Eltern, im Schlaf getötet, begraben unter dem Schutt ihres eigenen Schlafzimmers.
Er hingegen stand neben seinem Vater und der Schwester; Paolo, ein wenig hinter ihnen, hatte die Fäuste geballt, einen traurigen Blick auf dem Gesicht eines Jünglings. In jenen Tagen beweinte niemand nur die eigenen Toten: Das Begräbnis der Eltern von Giuseppina, Giovanna und Vincenzo Saffiotti fand am gleichen Tag statt wie das seiner Mutter Rosa Bellantoni, und mit ihnen fanden viele andere aus Bagnara ihre letzte Ruhestätte. Die Nachnamen waren immer die gleichen: Barbaro, Spoliti, Di Maio, Sergi, Florio.
Ignazio senkt den Blick auf die Schwägerin. In dem Moment, als Giuseppina ihre Augen hebt und seinem Blick begegnet, weiß der junge Mann, dass auch sie von Erinnerungen überwältigt ist.
Sie sprechen die gleiche Sprache, bewohnen den gleichen Schmerz, tragen die gleiche Einsamkeit in sich.
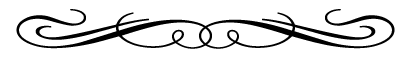
»Wir sollten nachsehen, wie es den anderen ergangen ist.« Ignazio zeigt auf den Hügel jenseits von Bagnara. Lichter sind in der Dunkelheit zu erkennen, dort sind Häuser, Menschen. »Willst du etwa nicht wissen, ob es ihnen gut geht, Mattia und Paolo Barbaro?«
In seiner Stimme liegt ein leichtes Zögern. Mit dreiundzwanzig ist er ein erwachsener Mann, doch sein Gebaren erinnert Paolo immer noch an den kleinen Jungen, der sich in ihrem Elternhaus hinter dem Schmiedeofen des Vaters versteckte, wenn ihre leibliche Mutter ihn ausschimpfte. Danach, bei jener anderen, der neuen Frau des Vaters, hat Ignazio nie wieder geweint. Er beschränkte sich darauf, sie mit einem tiefen Hass anzuschauen und zu schweigen.
Paolo zuckt mit den Achseln. »Nicht nötig. Wenn die Häuser noch stehen, wird ihnen nichts passiert sein. Außerdem ist es Nacht und stockfinster, und der Weg ist weit.«
Ignazio späht dennoch ängstlich in Richtung Straße, und noch weiter, zu den Anhöhen, die das Dorf umgeben. »Nein, ich gehe nachschauen, was geschehen ist.« Er tritt auf den Pfad, der in den Ortskern von Bagnara führt, gefolgt von einer Beschimpfung durch den Bruder.
»Kehr um«, schreit der ihm hinterher, doch Ignazio hebt nur die Hand und bedeutet ihm, dass er weitergehen wird.
Er ist barfuß, im Nachthemd, doch das ist ihm gleichgültig: Er will wissen, wie es seiner Schwester geht. Er steigt von der Anhöhe herab, auf der Pietraliscia liegt, und hat in wenigen Schritten das Dorf erreicht. Hie und da liegen Verputzbrocken, Dachstücke, zerbrochene Ziegel.
Er sieht einen Mann, der mit einer Wunde am Kopf umherläuft. Das Blut schimmert im Schein der Fackel, mit der er die Gasse beleuchtet. Ignazio kommt an der Piazza vorbei, schlüpft in eine der Gassen, die voller Tiere sind, Hühner, Ziegen, Hunde auf der Flucht. Es herrscht großes Durcheinander.
In den Höfen sitzen Frauen und Kinder und beten den Rosenkranz, oder sie rufen einander etwas zu, fragen nach Neuigkeiten. Die Männer hingegen suchen nach Spaten und Hacken, packen ihre Satteltaschen mit dem Werkzeug, das Einzige, womit sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen können, wertvoller als Essen oder Kleidung.
Er erklimmt den Pfad, der in das Granaro-Viertel führt, wo die Barbaros wohnen.
Dort stehen am Straßenrand Baracken aus Stein und Holz.
Einst standen hier richtige Häuser – er war damals noch klein, erinnert sich jedoch gut. Dann hatte das Beben des Jahres 1783 sie alle dem Erdboden gleichgemacht. Wer konnte, baute sein Haus mit dem, was er retten konnte, so gut wie möglich wieder auf. Andere nutzten die Ruinen, um größere, prächtigere Häuser daraus zu bauen, so wie es sein Schwager Paolo Barbaro, der Mann seiner Schwester Mattia Florio, getan hat.
Und der allererste Mensch, auf den er jetzt trifft, ist tatsächlich Mattia, die mit nackten Füßen auf einer Bank sitzt. Ihre Augen sind dunkel, der Blick streng; ihre kleine Tochter Anna, nur im Nachthemdchen, klammert sich an sie, Raffaele schläft in ihrem Arm.
In diesem Moment sieht Ignazio seine Mutter in ihr, ihre dunkle Haut, das schwarze Haar. Er läuft ihr entgegen und umarmt sie, ohne ein Wort zu sagen. Endlich ist die Anspannung verschwunden, die an seinem Herzen genagt hat.
»Wie geht es euch? Paolo, Vincenzo? Und Vittoria?« Sie nimmt sein Gesicht zwischen beide Hände, küsst seine Augen. Ihre Stimme klingt, als hätte sie gerade geweint. »Giuseppina, wie geht es ihr?« Der Bruder umarmt sie noch einmal, schnuppert ihren ganz eigenen Duft nach Brot und Früchten, einen süßen Duft, nach Zuhause.
»Alle sind in Sicherheit, Gott sei’s gedankt. Paolo hat Giuseppina und die beiden Kinder im Stall untergebracht. Ich bin gekommen, um zu sehen, wie es dir geht … wie es euch geht.«
In dem Moment tritt Paolo Barbaro aus dem hinteren Teil des Gebäudes. Sein Schwager. Er führt einen Esel am Strick.
Mattia versteift sich, Ignazio lässt sie los.
»Ach, gut. Gerade wollte ich dich und deinen Bruder aufsuchen.« Paolo bindet das Tier an den Karren an. »Wir müssen zum Hafen fahren, um nach dem Boot zu sehen. Es macht nichts, wenn nur du dabei bist.«
Ignazio breitet die Arme aus, lässt die Decke, in die er sich gehüllt hatte, fallen. »So? Ich bin halb nackt.«
»Was soll’s, genierst du dich etwa?«
Paolo ist klein und untersetzt; sein Schwager hingegen hat eine hagere Statur, einen sehnigen, noch jungen Körper. Mattia tritt auf die beiden zu, gleicht dabei das Gewicht der beiden Kinder aus, die sich an sie klammern.
»In der Truhe sind Kleider. Die kann er doch anziehen …«
Ihr Ehemann fährt ihr über den Mund. »Hat dich jemand gefragt? Perché t’ha sempre immiscari? Immer musst du dich einmischen. Und du, steig jetzt auf. Nach dem, was passiert ist, wird niemand darauf achten, wie einer angezogen ist …«
»Mattia wollte mir nur helfen«, nimmt Ignazio seine Schwester in Schutz. Er erträgt es nicht, Mattia mit gesenktem Kopf zu sehen, zerknirscht, die Wangen gerötet.
Der Schwager springt auf den Karren. »Meine Frau redet immer mehr als genug. Los, fahren wir.«
Ignazio will ihm Widerworte geben, doch Mattias flehentlicher Blick lässt ihn verstummen. Er weiß ja, dass Barbaro vor niemandem Respekt hat.
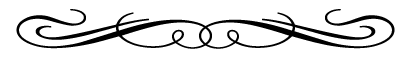
Das Meer sieht aus wie zäher Sirup. Es hat die Farbe von Tinte, die Grenze zum Himmel ist verwischt. Ignazio springt vom Karren, kaum sind sie im Hafen angelangt.
Vor ihm liegt die windgepeitschte Bucht, eingekeilt zwischen Klippen und Sand, doch auch geschützt von der zerklüfteten Felsmasse der Berge und von Kap Marturano.
Männer laufen schreiend zwischen den Booten hin und her, kontrollieren die Fracht, ziehen Taue fest.
Ein Tohuwabohu, wie zur Mittagszeit.
»Gehen wir.« Barbaro macht sich auf den Weg zum Turm von König Roger, wo das Meer tief ist. Dort liegen die größeren Boote vor Anker.
Kurz darauf stehen sie vor einem Schiff mit flachem Kiel. Das ist die San Francesco di Paola, die Schifazzo, die den Florios und den Barbaros gehört. Der hohe Mast schwankt im Rhythmus der Wellen, der Bugspriet zeigt in Richtung Meer. Die Segel sind eingeholt, das Tauwerk ist in Ordnung.
Ein Lichtschein taucht in der Schiffsluke auf. Barbaro beugt sich nach vorne, lauscht dem Knarzen und Quietschen mit einer Mischung aus Überraschung und Verärgerung. »Schwager, bist du das?«
Paolo Florios Kopf taucht in der Luke auf. »Wer sonst sollte es sein?«
»Was weiß ich? Nach all dem, was heute Nacht passiert ist …«
Doch Paolo Florio hört ihm schon nicht mehr zu. Er sieht jetzt Ignazio an. »Und du? Bist sang- und klanglos einfach verschwunden. Jetzt komm aufs Boot, mach schon.« Er zieht sich in den Bauch des Schiffes zurück, und auch der Bruder springt an Bord. Ihr Schwager bleibt auf der Brücke stehen und überprüft die linke Schiffswand, die gegen die Mole gedonnert ist.
Ignazio zwängt sich im Laderaum zwischen Kisten und Säcken hindurch, die von Kalabrien bis nach Palermo geliefert werden sollen.
Damit verdienen sie sich ihren Lebensunterhalt: mit dem Handel, vor allem zur See. Nur wenige Monate ist es her, dass es im Königreich Neapel schwerwiegende Veränderungen gegeben hat: Der König wurde vom Thron verjagt, und die Aufständischen haben in Neapel die Parthenopäische Republik ausgerufen. Dabei handelte es sich um eine Gruppe Adliger und Intellektueller, die die Ideen der Demokratie und Freiheit verbreiten wollten, genau wie es zuvor während der Revolution in Frankreich geschehen war, als man die Köpfe Ludwigs XVI. und Marie Antoinettes rollen sah. König Ferdinand und seine Gemahlin Maria Karolina haben allerdings besser aufgepasst und sind rechtzeitig entkommen, unterstützt von jenem Teil der Armee, der den Engländern, dem Erzfeind Frankreichs, die Stange gehalten hatte, bevor die lazzari, die Aufständischen, ihre Wut an ihnen auslassen konnten.
Doch bis hierher in die kalabrischen Berge ist nur die allerletzte Welle jener Revolution durchgedrungen. Es hat mehrere Morde gegeben, die Soldaten wussten nicht mehr, wem sie gehorchen sollten, und die Briganten, die schon immer dieses Bergland unsicher gemacht haben, begannen, auch die Kaufleute an der Küste auszunehmen wie die Weihnachtsgänse.
Hier die Aufständischen, dort die Briganten – die Wege sind gefährlich geworden, und auch wenn es auf dem Meer weder Kirchen noch Gasthäuser gibt, bietet es doch mehr Sicherheit als die Straßen im Königreich der Bourbonen.
Im Inneren des kleinen Laderaums ist es stickig. Da gibt es Zedernäpfel in Weidenkörbchen für die Parfümeure; außerdem Fisch, vor allem Stockfisch, und eingelegte Heringe. Weiter hinten liegen Lederstücke, bereit für den Transport nach Messina.
Paolo inspiziert die Säcke mit Waren. Im Laderaum vermischt sich das Aroma von Salzfisch mit dem leicht säuerlichen Gerbgeruch des Leders.
Die Gewürze lagern allerdings nicht hier. Die behalten sie bis kurz vor der Abfahrt im Haus. Die Feuchtigkeit und der Salzgehalt des Meeres könnten ihnen schaden, und so werden sie mit der allergrößten Achtsamkeit gelagert. Sie haben fremdländische Namen; wenn man sich deren Klang auf der Zunge zergehen lässt, steigen sogleich Bilder von Sonne und Wärme in einem auf: Pfeffer, Zitronat, Gewürznelken, Blutwurz, Zimt. Sie sind der wahre Reichtum.
Auf einmal spürt Ignazio, dass Paolo nervös ist. Er sieht es an seinen Gesten, er hört es daran, wie er spricht, auch wenn seine Worte durch das Schwappen des Wassers gegen die Bootsverkleidung gedämpft werden. »Was ist denn?«, fragt er ihn. Er fürchtet, sein Bruder habe mit Giuseppina gestritten. Seine Schwägerin ist alles andere als die unterwürfige Frau, die sie sein sollte. Zumindest für einen Mann wie Paolo. Doch das ist es nicht, was seinen Bruder aufwühlt, das spürt Ignazio. »Was gibt’s?«, fragt er noch einmal.
»Ich will von Bagnara weg.«
Der Satz fällt in dem flüchtigen Moment zwischen einer Welle und der nächsten.
Ignazio hofft, dass er seinen Bruder nicht richtig verstanden hat. Doch Paolo hat bereits bei anderen Gelegenheiten diesen Wunsch geäußert. »Wohin?«, fragt er, mehr betrübt als überrascht. Er hat Angst. Eine urplötzliche Angst, eine alte Angst, wie ein Tier, das ihm mit dem scharfen Atem des Verlassens im Nacken sitzt.
Mattia und Paolo haben ihn immer unterstützt. Jetzt hat Mattia ihre eigene Familie, und Paolo will weggehen. Ignazio allein lassen.
Sein Bruder senkt die Stimme, fast ist es nur noch ein Flüstern. »Eigentlich denke ich schon eine ganze Weile darüber nach. Das Beben von heute Nacht hat mich endgültig davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich will nicht, dass Vincenzo hier aufwächst, immer mit dem Risiko, dass ihm das Haus über dem Kopf einstürzt. Und außerdem …« Er schaut ihn an. »Ich will mehr, Igna’. Dieses Dorf hier reicht mir nicht mehr. Ich will nach Palermo.«
Ignazio öffnet den Mund, um ihm zu antworten, schließt ihn wieder. Er weiß nicht, was er sagen soll, spürt, wie die Worte zu Asche werden.
Sicher, Palermo ist eine Wahl, die auf der Hand liegt: Barbaro und Florio, wie man sie in Bagnara nennt, haben dort unten eine putìa, einen Gewürzladen.
Ignazios Gedanken schweifen zurück. Alles hat vor zwei Jahren mit einem Lagerraum begonnen, einer kleinen Faktorei, in der sie die Ware unterbrachten, die sie entlang der Küste erwarben, um sie auf der Insel wiederzuverkaufen. Am Anfang war dies schlicht eine Notwendigkeit, doch schon bald darauf kam sein Bruder Paolo auf die Idee, das Lager als Standort zu nutzen, denn von dort aus könnten sie die Verkäufe in Palermo ankurbeln, einem der größten Häfen im Mittelmeer. Und so ist aus jenem kleinen Lagerraum ein richtiges Geschäft geworden. Außerdem gibt es in Palermo eine große Gemeinde von Leuten aus Bagnara, überlegt Ignazio. Es ist ein lebendiger Markt, vielfältig und voller Möglichkeiten, vor allem jetzt nach der Ankunft der Bourbonen, die vor der Revolution geflohen sind.
Er weist mit dem Kopf stumm nach oben zur Brücke, wo die Schritte ihres Schwagers widerhallen.
Nein, Barbaro weiß es noch nicht. Paolo legt den Finger an die Lippen.
Die Einsamkeit schnürt Ignazio die Kehle zu.
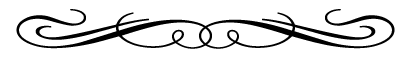
Die Rückfahrt ist schweigsam. Bagnara befindet sich in einem Zustand der Schwebe; es wartet auf den Anbruch des Tages. Als die beiden Brüder in Pietraliscia angekommen sind, betreten sie den Stall. Vittoria schläft, Vincenzo ebenso. Giuseppina hingegen ist wach.
Paolo setzt sich neben seine Frau, die stocksteif dasitzt, ein Bild des Argwohns.
Ignazio sucht sich einen Platz auf dem Stroh und kuschelt sich an Vittoria. Die Kleine stößt einen Seufzer aus. Instinktiv nimmt er sie in die Arme, doch er findet keinen Schlaf.
Die Neuigkeit ist schwer hinzunehmen. Wie soll er allein zurechtkommen, er, der noch nie allein war?
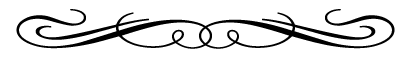
Draußen dämmert der Morgen, Lichtstrahlen stehlen sich durch die Risse in der Tür. Ein goldenes Licht, das vom Nahen des Herbstes kündet. Ignazio erschaudert vor Kälte; Rücken und Nacken sind verkrampft, die Haare voller Spelzen. Er rüttelt Vittoria sanft aus dem Schlaf.
Paolo ist schon auf den Beinen. Er schnaubt, während Giuseppina den Kleinen wiegt, der wieder zu quengeln begonnen hat.
»Wir müssen ins Haus zurück«, erklärt sie kampflustig. »Vincenzo muss gewickelt werden, und auch ich muss mich umziehen. So kann ich nicht bleiben, das schickt sich nicht.«
Paolo schnaubt erneut und macht die Tür auf; Sonnenlicht durchflutet den Stall. Das Haus steht noch, und jetzt, im frühen Morgenlicht, sieht man deutlich mehrere Verputzstücke und kaputte Dachziegel. Doch es gibt keine Risse in den Mauern, keine sonstigen Schäden. Giuseppina murmelt ein Dankgebet. Sie können wieder hinein.
Ignazio betritt das Haus direkt hinter Paolo. Danach kommt Giuseppina. Ignazio hört ihre zögerlichen Schritte und wartet auf sie, bereit, ihr beizustehen.
Sie überschreiten die Schwelle. Die Küche ist voller kaputtem Hausrat.
»Heilige Mutter Gottes, was für ein Durcheinander.« Giuseppina hält den Neugeborenen, der mittlerweile brüllt wie am Spieß, fest an sich gedrückt. Der Kleine riecht nach sauer gewordener Milch. »Vittoria, hilf mir! Räum auf hier, ich kann nicht alles machen! Beeil dich!« Jetzt betritt das Mädchen, das zurückgeblieben war, die Küche. Vittoria sucht den Blick der Tante, doch diese beachtet sie nicht. Mit aufeinandergepressten Lippen bückt sie sich und beginnt, die Scherben aufzuklauben. Weinen wird sie nicht, das darf sie nicht.
Giuseppina geht weiter zu dem Flur, an dem die Schlafzimmer liegen. Jeder ihrer Schritte ist ein Wehklagen, das ans Herz geht. Ihr Haus, ihr ganzer Stolz, ist voller Gesteinsbrocken und Scherben. Es wird Tage dauern, das alles wieder in Ordnung zu bringen.
In ihrem Schlafzimmer kümmert sie sich zuerst um Vincenzo, wäscht und wickelt ihn. Dann legt sie ihn auf die Matratze, um sich selbst zu säubern. Der Kleine strampelt, grabscht nach seinem Füßchen, lacht und gluckst.
»Mein Goldschatz«, sagt sie. »Mein Leben.«
Vincenzo ist ihre puddara, ihr Polarstern. Das Menschlein, das sie mehr liebt als alle anderen.
Am Ende zieht sie ihr Hauskleid an, legt sich den geliebten Schal über die Schultern, steckt einen Zipfel am Rücken fest.
Während sie ihren kleinen Sohn in die Wiege legt, betritt Paolo das Zimmer.
Er öffnet das Fenster. Oktoberluft weht ins Zimmer herein, zusammen mit dem Rascheln der Buchenblätter, die sich in Richtung Gebirge bereits rot verfärben. Eine Elster zetert, nur wenige Meter entfernt, in dem Gemüsegarten, um den sich Giuseppina persönlich kümmert. »Wir können nicht in Pietraliscia bleiben.«
Giuseppina, die gerade ein Kissen aufschüttelt, hält inne. »Wieso? Gibt es Schäden? Wo?«
»Das Dach hat beträchtlich gelitten, aber es geht nicht nur um die Schäden. Wir gehen hier weg. Weg von Bagnara.«
Giuseppina traut ihren Ohren nicht. Das Kissen gleitet ihr aus den Händen. »Warum?«
»Darum.« Paolos Stimme lässt keinen Zweifel: Hinter dieser Ankündigung steht eine unwiderrufliche Entscheidung.
Sie starrt ihn an. »Was redest du da? Ich soll aus meinem Haus weg?«
»Aus unserem Haus.«
Aus unserem Haus?, hätte sie beinahe gefragt. Sie tritt ihm entgegen, beißt die Zähne zusammen. Das hier ist mein Haus, denkt die Frau wütend. Mein Haus, das ich als Mitgift in die Ehe eingebracht habe, während du und dein Vater noch mehr Geld haben wolltet, und das hat immer noch nicht gereicht … Denn Giuseppina erinnert sich noch gut an das Tauziehen, das es damals um die Mitgift gab, die die Florios haben wollten, und wie viel es gebraucht hatte, bis sie zufrieden waren, während Giuseppina überhaupt nicht hatte heiraten wollen. Und jetzt will er einfach weg von hier? Warum?
Nein, sie will es eigentlich gar nicht wissen. Sie geht auf den Flur, weg aus diesem Zimmer, weg von diesem Zank.
Paolo folgt ihr. »Die Innenmauern hier haben Risse, es sind Ziegel heruntergefallen. Beim nächsten Erdbeben wird uns das Haus über dem Kopf einstürzen.«
Sie haben die Küche erreicht. Ignazio begreift sofort. Er kennt die Anzeichen dafür, dass bei den Florios der Haussegen schief hängt, und sie sind alle da. Er bedeutet Vittoria hinauszugehen, und sie verzieht sich in Richtung Treppe, nach draußen. Er selbst macht sich zum Flur auf den Weg, bleibt aber direkt hinter der Schwelle stehen: Er fürchtet Paolos Reaktionen und den Zorn seiner Schwägerin.
Nein, bei diesem Streit wird nichts Gutes herauskommen. Zwischen den beiden ist noch nie etwas Gutes herausgekommen.
Giuseppina greift nach einem Reisigbesen, um das Mehl vom Boden wegzukehren. »Dann richte die Schäden: Du bist das Familienoberhaupt. Oder ruf Handwerker.«
»Ich kann nicht die ganze Zeit hierbleiben, um die Maurer zu überwachen, und um es selbst zu machen, fehlt mir die Zeit. Wenn ich nicht rausfahre, haben wir nichts zu essen. Wir fahren über Neapel nach Palermo, aber ich habe keine Lust mehr, ein bagnaroto zu sein, ein Habenichts aus Bagnara. Ich will mehr, für mich und für meinen Sohn.«
Sie stößt einen Laut aus, der halb ordinäres Lachen und halb verächtliches Schnauben ist. »Aber du wirst immer ein bagnaroto sein, auch wenn du an den Bourbonenhof gehst. Man kann nicht auslöschen, was man ist, selbst wenn man nach Geld stinkt. Und du bist ein Trödler, der Dinge auf einer Schifazzo verkauft, einem Schiff, das er zusammen mit seinem Schwager erworben hat, der ihn immer noch wie einen Dienstboten behandelt.« Giuseppina beginnt, sich an dem Geschirr in der Spülwanne zu schaffen zu machen.
Ignazio hört das laute Klappern der Teller, er spürt, wie zornig seine Schwägerin ist. Durch den Türspalt sieht er ihren Rücken, der sich bewegt, über den Zuber gebeugt.
Er weiß, wie sie sich fühlen muss: wütend, verstört, erschrocken. Verängstigt.
Genau so, wie er sich seit der vergangenen Nacht fühlt.
»Wir gehen in den nächsten Tagen weg. Und es wäre gut, wenn du deiner Großmutter Bescheid sagst, dass wir …«
Ein Terrakottateller zerschellt auf dem Boden. »Ich gehe nicht aus meinem Haus weg! Vergiss es!«
»Deinem Haus!« Paolo unterdrückt einen Fluch. »Dein Haus! Das hältst du mir schon vor, seit wir verheiratet sind! Du und deine Verwandten, und dein Geld! Ich bin es, der dir das Leben hier ermöglicht, mit meiner Hände Arbeit.«
»Ja. Aber das Haus gehört mir, meine Eltern haben es mir vermacht. Ein solches Haus, davon konntest du nur träumen. Du hast im Heuschober deines Schwagers gelebt, erinnerst du dich? Ich habe von meinem Onkel und meinem Vater Dukaten geerbt, und jetzt beschließt du, dass ich von hier wegsoll?« Sie greift nach einer Kupferpfanne und schleudert sie mit voller Wucht auf den Boden. »Ich gehe nicht weg von hier! Das hier ist mein Haus! Das Dach ist kaputt? Dann richtet man es eben. Du bist doch sowieso nie da, jeden Monat bist du unterwegs. Dann geh doch, geh doch, wohin du willst. Mein Sohn und ich werden uns nicht von Bagnara wegrühren!«
»Nein. Du bist meine Frau. Es ist mein Sohn. Du wirst tun, was ich dir sage.« Paolo ist eiskalt.
Jegliche Farbe weicht aus Giuseppinas Gesicht.
Sie birgt ihr Antlitz hinter der Schürze und schlägt sich mit den Fäusten vor die Stirn, mit einer rohen Wut, die nur noch nach Ausbruch schreit.
Ignazio möchte einschreiten, möchte sie und den Bruder beschwichtigen, doch das darf er nicht. Er muss den Blick abwenden, um sich daran zu hindern.
»Du Unglückseliger, willst du mir wirklich alles nehmen?«, schluchzt Giuseppina. »Hier habe ich meine Tante, meine Großmutter, die Gräber meines Vaters und meiner Mutter. Du willst, dass ich nur des Geldes wegen alles hier zurücklasse? Was für ein unbarmherziger Ehemann bist du eigentlich?«
»Hör auf!«
Sie hört ihm gar nicht zu. »Nein, sagst du zu mir? Nein? Und wo, verflucht noch mal, willst du hin?«
Paolo betrachtet die Scherben des Terrakottatellers auf dem Boden, schiebt eine mit der Schuhspitze zur Seite. Er wartet einen Augenblick, bis Giuseppinas Schluchzen abebbt, und antwortet dann: »Nach Palermo, wo Barbaro und ich den Gewürzladen eröffnet haben. Palermo ist eine reiche, reiche Stadt – ganz anders als Bagnara!« Er geht auf sie zu, streichelt ihren Arm. »Außerdem leben am Hafen einige aus unserem Ort. Du wärst nicht allein.« Es ist eine unbeholfene Geste, etwas grob, aber auch sanft.
Giuseppina schüttelt die Hand ihres Mannes ab. »Nein«, schreit sie. »Ich komme nicht mit.«
Jetzt verhärtet sich Paolos Blick. »Doch, du kommst mit. Ich bin dein Ehemann, und du wirst mit mir nach Palermo kommen, und wenn ich dich an den Haaren bis zum Turm von König Roger zerren muss. Fang schon an, deine Sachen zu packen. Bis Ende der kommenden Woche sind wir hier weg.«
GEWÜRZE
November 1799 – Mai 1807
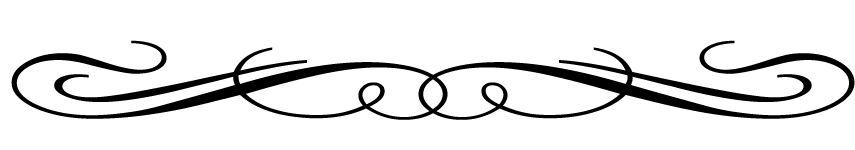
Cu mania ’un pinìa.
Wer fleißig ist, leidet nicht.
Sizilianische Redensart
Bereits seit dem Jahre 1796 weht in Italien an verschiedenen Orten der Wind der Revolution. Mitgebracht haben ihn die Truppen eines jungen und ehrgeizigen französischen Generals: Napoleon Bonaparte.
1799 rebellieren die Jakobiner des Königreichs Neapel gegen die bourbonische Monarchie und rufen die neapolitanische Republik aus. Ferdinand IV. von Neapel und seine Gemahlin, Maria Karolina von Habsburg, sind gezwungen, sich nach Palermo abzusetzen. Erst 1802 kehren sie nach Neapel zurück; die Zeit der Republik endet mit einer Phase härtester Repression.
Um dem wachsenden Einfluss der Franzosen in Europa entgegenzuwirken, schließen sich schon 1798 mehrere Staaten, darunter Großbritannien, Österreich, Russland und das Königreich Neapel, gegen Frankreich zusammen. Doch bereits kurz nach der Niederlage bei Marengo (14. Juni 1800) unterzeichnen die Österreicher den Friedensvertrag von Lunéville (9. Februar 1801), und ein Jahr später besiegelt auch Großbritannien mit dem Vertrag von Amiens (25. März 1802) den Frieden mit den Franzosen, wodurch die Briten allerdings den Großteil ihrer Kolonien verlieren. In der Folge verstärkt die englische Marine ihre Präsenz im Mittelmeer, insbesondere rund um Sizilien.
Am 2. Dezember 1804 erklärt sich Napoleon selbst zum Kaiser der Franzosen, proklamiert nach dem entscheidenden Sieg bei Austerlitz (2. Dezember 1805) das Ende der Bourbonen-Dynastie und schickt General André Masséna mit dem Auftrag nach Neapel, den Bruder Napoleons, Joseph, auf den dortigen Thron zu setzen, wodurch dieser zum König von Neapel wird. Erneut sieht sich Ferdinand gezwungen, nach Palermo zu fliehen, was ihm unter dem Schutz der Engländer gelingt; er kann in Sizilien weiterregieren.