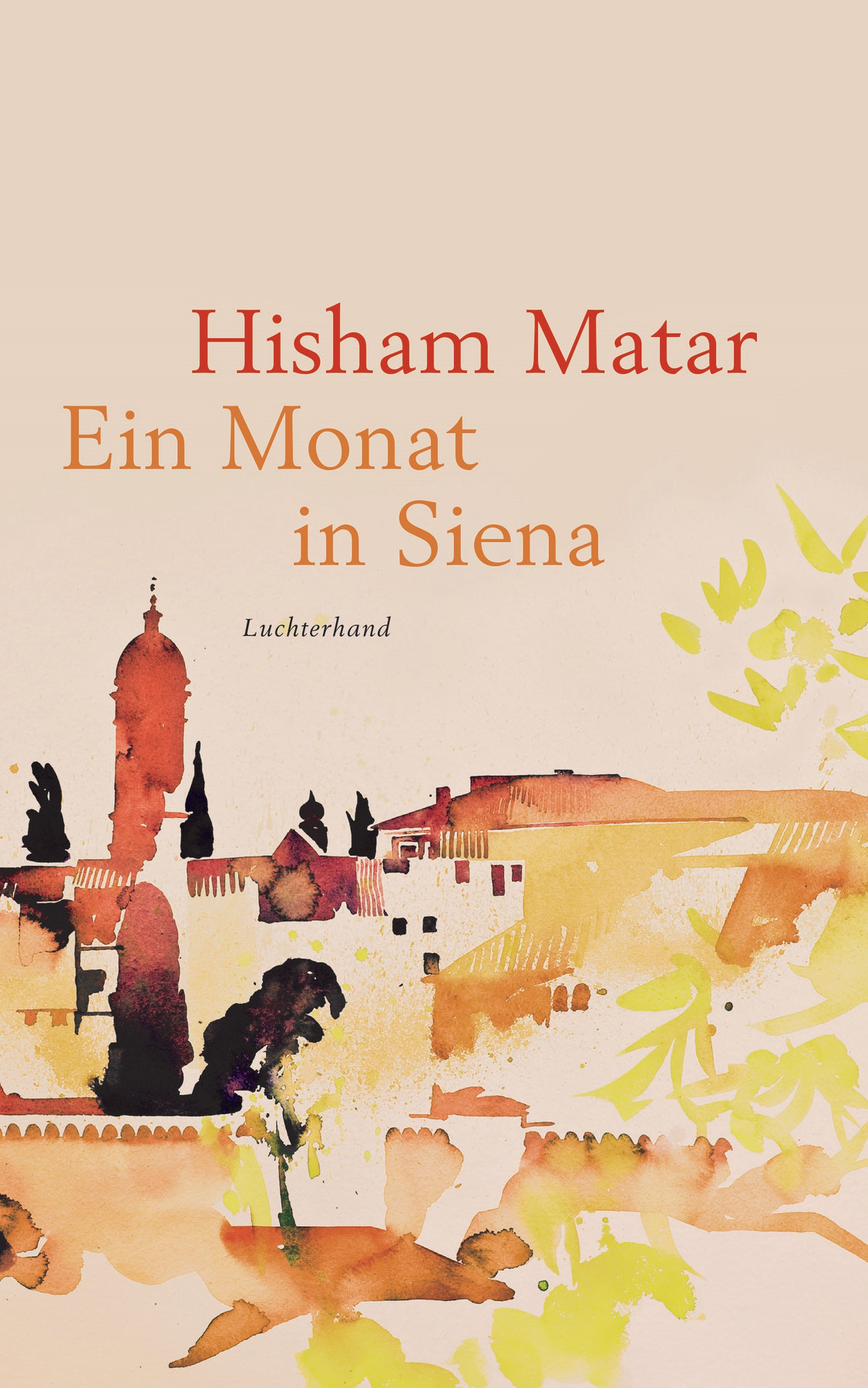
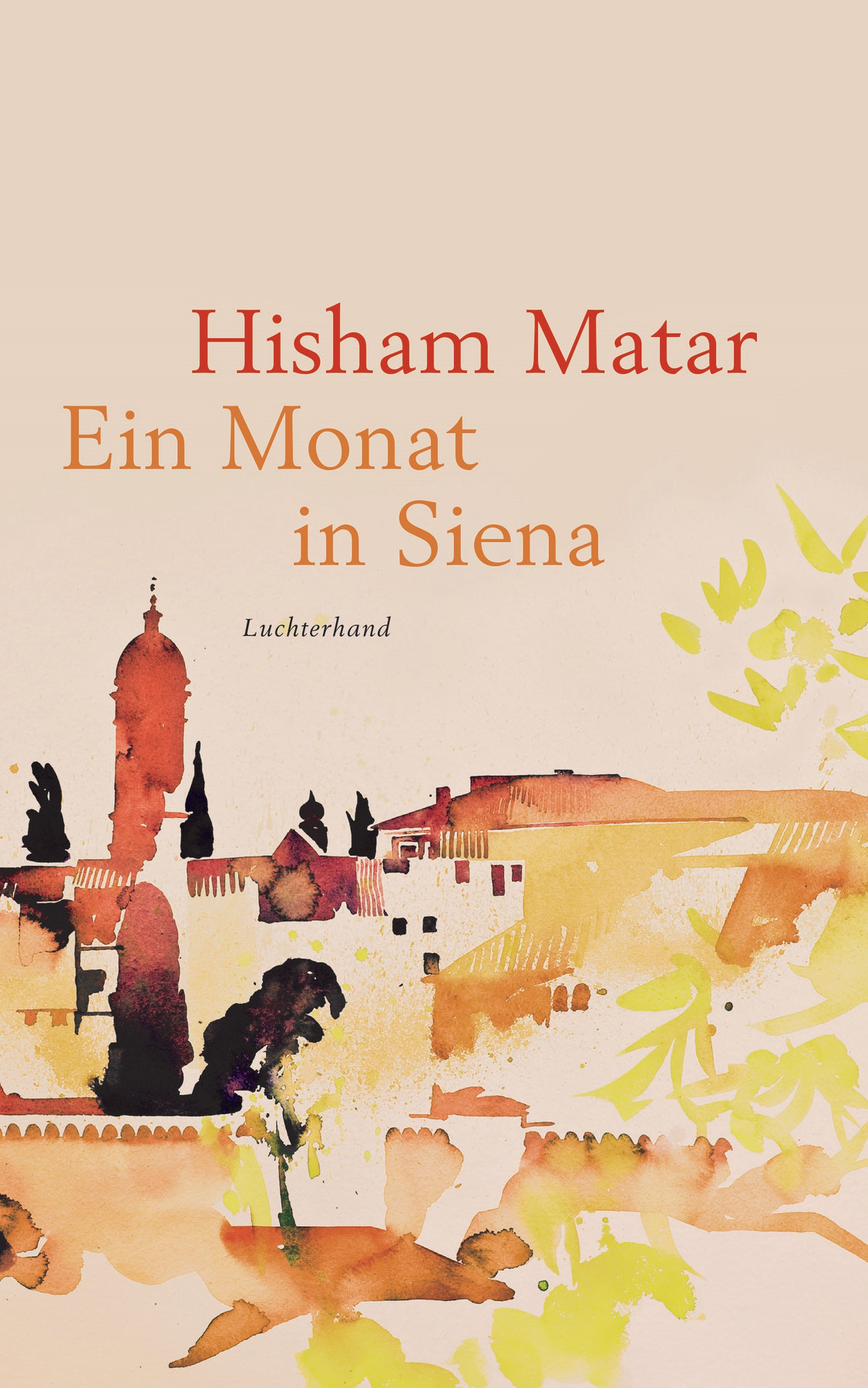
Zum Buch
Hisham Matar sah Bilder der Schule von Siena mit neunzehn Jahren zum ersten Mal. Als kurz darauf sein Vater verschwand, nahmen diese Maler einen besonderen Platz in seinem Leben ein, und Siena wurde fast zu einem mythischen Ort, wie beispielsweise Mekka oder Rom oder Jerusalem für manchen Gläubigen.
Der Monat in Siena fünfundzwanzig Jahre später ist eine besondere Zeit im Leben des Autors, er schließt ein Kapitel seines Lebens ab und beginnt, sich der Zukunft zu öffnen. Die Begegnung mit den Werken von Duccio di Buoninsegna und Ambrogio Lorenzetti und anderen italienischen Malern des dreizehnten bis fünfzehnten Jahrhunderts werden veranschaulicht durch zahlreiche Farbabbildungen, der Leser kann nachvollziehen, was sich zwischen Matar und den Gemälden abspielt. Hisham Matar schreibt über sich und die Stadt und ihre Menschen, über Geschichte, über Europa und die Welt. Über Kunst und was sie mit dem Betrachter macht, wie sie trösten und verstören kann, wie sie tief in unser Innerstes greift und uns die Augen öffnet. Seinen Gedanken über Intimität und Einsamkeit, Tod und Trauer, Kunst und Geschichte zu folgen ist ein zutiefst bewegendes, bereicherndes Erlebnis.
Zum Autor
Hisham Matar, Sohn libyscher Eltern, wurde 1970 in New York City geboren, wuchs in Tripolis und, nach der Emigration der Familie, in Kairo auf. Seit 1986 lebt Hisham Matar in England. Er hat zwei international vielbeachtete Romane verfasst, »Im Land der Männer« (2006) und »Geschichte eines Verschwindens« (2011), die mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet wurden. Sein Memoir »Die Rückkehr. Auf der Suche nach meinem verlorenen Vater« (2017) wurde u. a. ausgezeichnet mit dem Pulitzerpreis, dem Geschwister-Scholl-Preis, dem PEN/Jean Stein Book Award und dem Folio Prize.
Zum Übersetzer
Werner Löcher-Lawrence, geb. 1956, studierte Journalismus, Literatur und Philosophie und ist der Übersetzer von u. a. Nathan Englander, Nathan Hill, Hilary Mantel, Louis Sachar und Meg Wolitzer.
Hisham Matar
Ein Monat in Siena
Aus dem Englischen von
Werner Löcher-Lawrence
Luchterhand
Copyright © der Originalausgabe 2019 Hisham Matar
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
Luchterhand Literaturverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign | München
Covermotiv: Fletcher, Simon, Tuscany San Quirico d’ Orcia,
Fotocredit: Private Collection © Brian Fletcher/Bridgeman
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-25107-9
V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Für Diana
Duccios Tür
Die Form eines Raumes
Ein Anlaufpunkt
David und Goliath
Eine Rüstung, was für eine Rüstung?
Die Bank
Evidence
Die Museumswächterinnen
Das blaue Band
Platz nehmen
Das Problem mit dem Glauben
Das Feuer
Il bagno turco
Das Engels-Dilemma
Paradies
Die Illustrationen
Nach mehr als drei Jahrzehnten Abwesenheit flog ich zurück nach Libyen, wo ich aufgewachsen war, zurück ins Land meiner Herkunft, zum Ausgangspunkt, von dem ich mich immer weiter entfernt hatte. Meine Rückkehr ließ Vergangenheit und Zukunft anders erscheinen, und ich verspürte den Drang, darüber zu schreiben. Drei Jahre später beendete ich das Buch und tauchte, blinzelnd ins Licht blickend, aus langer, konzentrierter Arbeit auf. Das war der Moment, in dem ich mich entschloss, nach Siena zu fahren. Lange schon interessierte ich mich für die sienesischen Maler, aber komischerweise suchte ich jetzt, da ich die Reise endlich antreten wollte, nach Möglichkeiten, wie ich die Ankunft hinauszögern konnte. Es war, als hielten mich die langen Jahre der Erwartung zurück, und so legte ich mir Steine in den Weg. Da Siena keinen Flughafen hat, nahm ich mir vor, nach Florenz zu fliegen und die verbliebenen etwa achtzig Kilometer durch die Hügel des Chianti-Classico-Gebiets zu Fuß zurückzulegen. Den Ausschlag gab dabei, dass mir der Gedanke gefiel, eine lange Strecke mit kleinen Schritten hinter mich zu bringen und am Ende in die Stadt zu wandern. Eine Woche vor meiner geplanten Abreise jedoch verdrehte ich mir auf schon peinlich undramatische Weise das Knie – einfach, indem ich die Richtung wechselte. Es tat fürchterlich weh. Der Arzt sah mich auf meine Frage, wie man mit solch einer kleinen Bewegung einen derartigen Schaden anrichten könne, nur an und sagte: »Das kommt vor.« Dann erklärte er mir, ich könne auf keinen Fall längere Wanderungen unternehmen. Ich bereute, die Wohnung in Siena gebucht zu haben, die ich nach nur fünfzehn Minuten Online-Recherche gefunden und bereits zum Teil bezahlt hatte.
Mein Knie hatte sich zwar noch nicht ganz erholt, doch am Ende beschloss ich trotzdem, zum geplanten Termin zu fliegen. Meine Frau Diana entschied kurzerhand, mich ein paar Tage zu begleiten, was de facto bedeutete, dass sie mich hinbrachte. Besser noch als ich schien sie zu begreifen, wie sehr ich diese Reise brauchte. Die einzigen verfügbaren Flüge gab es mit Swissair. Ich bin 1970 geboren, und obwohl wir in Tripolis lebten, unternahmen meine Eltern in meiner Kindheit die meisten Reisen mit dieser Fluglinie, weshalb ich sie nach wie vor mit Abenteuer und Verlässlichkeit verbinde. Nachdem wir in Zürich umgestiegen und nach Florenz unterwegs waren, hoch über den schneebedeckten Alpengipfeln mit ihren dramatischen Schluchten, durch die tief unten schwarz das Schmelzwasser schoss, beschrieb das Flugzeug jedoch plötzlich eine 180-Grad-Wende und kehrte um. Ein paar Minuten später meldete sich der Flugkapitän. Wegen eines mechanischen Problems, sagte er, müssten wir zurück nach Zürich. Eine weitere Erklärung gab es nicht. Ich überlegte, dass wir noch etwa vierzig Minuten bis nach Florenz gebraucht hätten, zurück nach Zürich waren es ungefähr dreißig. Was konnte mit dem Flugzeug nicht stimmen, dass die zusätzlichen zehn Minuten offenbar zu viel waren? Diana hielt meine Hand. Ich machte einen Witz darüber, wie nett es wäre, ein paar Tage in den Alpen zu verbringen. Sie lächelte vorsichtig und blieb stumm. Das Flugzeug war voll besetzt, und als es plötzlich Turbulenzen gab, war von einigen Passagieren ein verschrecktes Murmeln zu hören. Ich hörte eine Frau weinen. Ansonsten blieben alle still. Ich weiß noch, dass ich dachte, es würde mir nichts ausmachen zu sterben – wozu es ja sowieso irgendwann kommen würde –, dass ich aber jetzt noch nicht wirklich bereit dafür war. Was für eine Verschwendung es wäre, angesichts all der Zeit, die ich gebraucht hatte, leben zu lernen.
Nach der Landung in Zürich klatschten einige Passagiere. Diana und ich aßen auf dem Flugplatz irgendetwas Nichtssagendes zu Mittag, der nächste Flug brachte uns erst abends nach Florenz. Wir fuhren in die Stadt, tranken und aßen noch etwas und schafften es, den letzten Bus nach Siena zu bekommen. Wir lachten über die nicht enden wollende Geschichte und dass wir von London nach Florenz so lange gebraucht hatten, als wären wir nach Indien geflogen. Der Bus fuhr durch die Dunkelheit, es fing an zu regnen, und das Wasser peitschte monströs schön gegen die Fenster. In einer Kurve riss der Fahrer heftig am Steuer und blieb am Straßenrand stehen, wo ein anderer Bus liegengeblieben war. Der Fahrer stand an der Straße und winkte mit einer Stablampe. Hinter ihm drängten sich Männer, Frauen und Kinder unter Schirmen zusammen, ihre Koffer neben sich. Die beiden Fahrer wechselten ein paar Worte, und einige der Fahrgäste aus dem liegengebliebenen Bus stiegen bei uns ein. Da es kaum mehr freie Plätze gab, füllten sie den Gang. Ihre Kleider rochen muffig und süß nach Regen. Etliche von uns überließen ihre Sitze den Älteren. Dann kam es zu einem lauten Streit zwischen den Fahrern: Es passten keine weiteren Leute mehr bei uns herein, und der andere Fahrer hätte vorsichtiger sein sollen. Als die Fahrt weiterging, sah ich, dass sich der andere Bus mit der Schnauze tief in die stählerne Leitplanke zwischen Straße und Abgrund gefressen hatte. Mit jeder neuen Kurve wiegten wir, die stehenden Fahrgäste, uns wie in einem schwermütigen Tanz hin und her.
Mittlerweile schien die ganze Reise eine fürchterliche Idee. Warum hatte ich so unbedingt herkommen müssen? 1990, mit neunzehn, als ich in London studierte, hatte ich eine unerklärliche Faszination für die Sienesische Malerschule entwickelt, mit Künstlern aus dem dreizehnten, vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert. In dem Jahr hatte ich meinen Vater verloren. Er lebte in Kairo im Exil, und eines Nachmittags wurde er entführt, in ein nicht weiter gekennzeichnetes Flugzeug geschafft und zurück nach Libyen geflogen. Dort wurde er in ein Gefängnis gesperrt und nach und nach zum Verschwinden gebracht, so wie sich Salz in Wasser auflöst. Kurz darauf begann ich aus Gründen, die mir bis heute unklar sind, die National Gallery in London zu besuchen. Tag für Tag verbrachte ich den Großteil meiner Mittagspause vor einem der Gemälde dort. Jede Woche suchte ich mir ein anderes aus. Auch heute noch, mehr als ein Vierteljahrhundert später und nachdem ich keine Spur meines Vaters habe finden können, studiere ich Gemälde auf diese Weise, immer nur eines für sich. Es lohnt sich sehr. Ein Bild verändert sich, während man es betrachtet, und das auf unerwartete Weise. Ich habe entdeckt, dass Gemälde Zeit verlangen. Heute brauche ich mehrere Monate und öfter sogar ein Jahr, bevor ich zu einem anderen wechsele. Während dieser Zeit wird das Bild zu einem geistigen und körperlichen Ort meines Lebens.
Diese Gewohnheit hatte sich gerade erst entwickelt, als ich der sienesischen Malerei begegnete. Zunächst wusste ich nicht, wie ich mich ihr nähern sollte. Mit ihrer oft symmetrischen Struktur und ihrem direkt auf mich gerichteten Blick kamen mir die Bilder trotzig vor, wirkten wie ein Affront. Sie waren mir auf eine Weise fremd, wie es andere, die mich damals interessierten – von Malern wie Velázquez, Manet, Tizian, Cézanne und Canaletto –, nicht waren. Die Gemälde der Sienesischen Schule schienen Teil einer abgeschiedenen Welt christlicher Codes und Symbole zu sein, und ich kann nicht sagen, dass ich sie genoss. Dennoch kehrte ich, fast gegen meinen Willen, immer wieder zu ihnen zurück. Oft sah ich nur kurz zu ihnen hin und ging weiter. Sie gaben mir das Gefühl, nicht auf sie vorbereitet zu sein und eine Erklärung zu brauchen. Sie standen für sich, waren weder byzantinisch noch Teil der Renaissance, eine Anomalie zwischen zwei Kapiteln, ein Orchester, das in der Pause die Saiten stimmt.
Die Neugier, die ich für sie entwickelte, hat sich während der letzten zweieinhalb Jahrzehnte noch verstärkt. Die Farben, die zarten Formen und die eingefangene Dramatik der Bilder wurden nach und nach zu einer Notwendigkeit für mich. Alle paar Monate gehe ich in die National Gallery, um mir aufs Neue Duccio di Buoninsegnas Verkündigung oder Die Heilung eines Blinden anzusehen. Die Sehenden – das sind Jesus, seine Zuschauer und der jetzt geheilte Blinde – nehmen ernst und düster die untere Bildhälfte ein. Im Kontrast dazu steht die verspielte, helle, klare Aktivität der oberen Hälfte, wo Hüpfkästchen gleiche Bögen und Fenster den Betrachter ansehen. Hinter ihnen sind offene Räume zu erkennen, und sie scheinen bewusst den Blick von der menschlichen Aktivität unten ablenken zu wollen. In ebendie Richtung, nach oben, ist auch das Gesicht der noch nicht geheilten zweiten Version des Blinden gerichtet. Duccio di Buoninsegnas Gemälde stellt in Frage und ironisiert, was es bedeutet, wirklich zu sehen. Es gibt keine eindeutige Antwort. Das Bild hat immer, über all die Jahre, die ich zur Heilung eines Blinden zurückgekehrt bin, einen Raum des Zweifels dargestellt.

Wenn ich für längere Zeit nicht in London bin, kommt unvermeidlich der Moment, da ich in den jeweiligen örtlichen Museen nach etwas von der Sienesischen Schule suche, vorzugsweise von Duccio, denn auch wenn er nicht unbedingt der Beste von ihnen ist, kann er doch als Ursprung für Simone Martini, die Brüder Lorenzetti – Ambrosio und Pietro –, Giovanni di Paolo und all die anderen gesehen werden. Die Präzision und besondere Großzügigkeit der Arbeiten Duccios öffnete ein Tor, durch das die anderen treten konnten. Eine solche Entschleierung neuen Territoriums muss eine der bemerkenswertesten Leistungen sein, die einem Künstler möglich sind. Er fordert unsere Vorstellung heraus, versetzt unserer Wahrnehmung einen Stoß, und zumindest für einen Moment formt sich die Welt neu. Fast kann man den Gedankenaustausch zwischen den Malern hören, die durch Duccios Tor traten. Ihre Werke genau zu studieren heißt, einem der fesselndsten Gespräche der Kunstgeschichte zu lauschen, das davon handelt, was ein Gemälde sein, wozu es dienen und was es im innigen Drama der persönlichen Auseinandersetzung mit einem Fremden erreichen kann. Man hört die Frage, wie sehr ein Bild auf das Gefühlsleben seines Betrachters bauen kann; wie eine gemeinsame Erfahrung den Vertrag zwischen Maler und Betrachter sowie zwischen Maler und Objekt verändern und welche kreativen Möglichkeiten diese neue Zusammenarbeit eröffnen kann.
Deshalb schienen mir diese Gemälde damals schon, selbst in meiner anfänglichen Verwirrung, wie auch heute noch ein Gefühl der Hoffnung zu artikulieren. Sie glauben, dass das Gemeinsame zwischen uns das Trennende überwiegt. Die Sienesische Schule ist hoffnungsvoll, aber auch schmeichlerisch, da sie Gemälde hervorbringt, die auf die Gegenwart, die Intelligenz und die Bereitschaft des Betrachters vertrauen, sich zu öffnen. Sie sind frühe Beispiele der später dominant werdenden Art von Kunst, in der ein Bild erst durch das Subjekt des Betrachters vollendet wird.
Je mehr mich die sienesische Malerei während der letzten fünfundzwanzig Jahre fasziniert hat, desto stärker wurde die bange Ehrfurcht, die ich vor Siena empfand, ein Gefühl, wie es ein frommer Mensch Mekka, Rom oder Jerusalem gegenüber hegen mag, und weil ich solche Pilgerreisen mit Skeptizismus betrachte, misstraute ich meiner Sehnsucht nach dieser Stadt. Zudem gab es praktische Überlegungen: Angesichts der Tiefe meiner Gefühle für den Ort und der Anzahl der Gemälde, die ich dort sehen wollte, musste ich die Zeit für einen langen Aufenthalt in der Stadt finden.
In den frühen 1960ern wurde Siena die erste italienische Stadt, die den Zugang von Autos einschränkte. Der Bus setzte uns am Rand der Stadt ab, und wir zogen unsere Koffer in das schwach beleuchtete Gassengewirr. Es nieselte nur noch, und die schwarzen Pflastersteine glänzten dunkel. Die Enge der Straßen ließ die Häuser hoch über uns emporwachsen, und ihre ergrauenden Terrakottasteine waren in der Nacht nur vage auszumachen. Die engen Windungen der Durchgänge und die Nähe der Häuser gaben mir das Gefühl, in einen lebenden Organismus zu kommen. Mit jedem Schritt drang ich tiefer in ihn ein, und wie zur Antwort gewährte er mir Raum. Ich befand mich an einem Ort, der mir zugleich vertraut und völlig unbekannt war.
Die Wohnung, die ich gemietet hatte, lag, wie sich herausstellte, in einem alten Palazzo. Sie hatte Deckenfresken und perfekt proportionierte Räume. Das bescheidene Äußere des Gebäudes ließ die Schönheit innen umso stärker hervortreten. Wenn ich das Haus während der nächsten Tage verließ, war ich mir oft, auch ohne mich umzusehen, der Nüchternheit der Fassade bewusst. Sie kam mir wie ein Verbündeter vor, dem ich alle möglichen Geheimnisse anvertrauen wollte. Das Ganze erinnerte mich daran, dass manche Gebäude, genau wie Menschen, denen wir zum ersten Mal begegnen, Begierden in uns wachzurufen vermögen, die bis dahin in uns verborgen waren. Meist sind wir uns solcher Veränderungen nicht bewusst. Sie vollziehen sich unbemerkt und oft beidseitig, denn genau, wie wir andere beeinflussen und von ihnen beeinflusst werden, reflektiert auch die Atmosphäre eines Raumes, was wir in ihm tun. Der Großteil unseres Tuns verflüchtigt sich wieder, doch ein schwacher, schemenhafter Rest bleibt. Wie sonst ließe sich erklären, warum wir den Hauch von etwas Schrecklichem spüren, das sich an einem Ort ereignet hat, oder durch einen Raum inspiriert werden, der lange von Schönheit und Güte erfüllt war. Jedes Mal, wenn ich mich auf den Heimweg machte, verspürte ich eine wachsende Vorfreude auf die Wohnung, und wohin immer ich in den nächsten Tagen in Siena ging, trug ich die Freude an diesen Räumen wie eine persönliche Melodie mit mir.