


Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen..
1. Auflage 2020
Copyright © 2019 by Lynda Mullaly Hunt
All rights reserved including the right of reproduction
in whole or in part in any form
This edition published by arrangement with Nancy Paulsen Books,
a division of Penguin Young Readers Group, a member of Penguin Group (USA) LLC, A Penguin Random House Company.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Shouting at the Rain« bei Nancy Paulsen Books, New York.
© 2020 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem amerikanischen Englisch von Ursula Höfker
Umschlaggestaltung: © Suse Kopp, Hamburg unter Verwendung mehrerer Motive von Trevillion Images (Ebru Sidar, Krasimira Petrova Shishkova); iStockphoto / vladimir_karpenyuk
he ∙ Herstellung: TW
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25275-5
V001
www.cbj-verlag.de

Für Nancy Paulsen,
die breite Schultern hat
Greg, Kim, Kyle und Dave,
früher träumte ich davon,
eine eigene Familie zu haben;
ihr macht mich glücklicher,
als ich es mir je erträumt hätte.

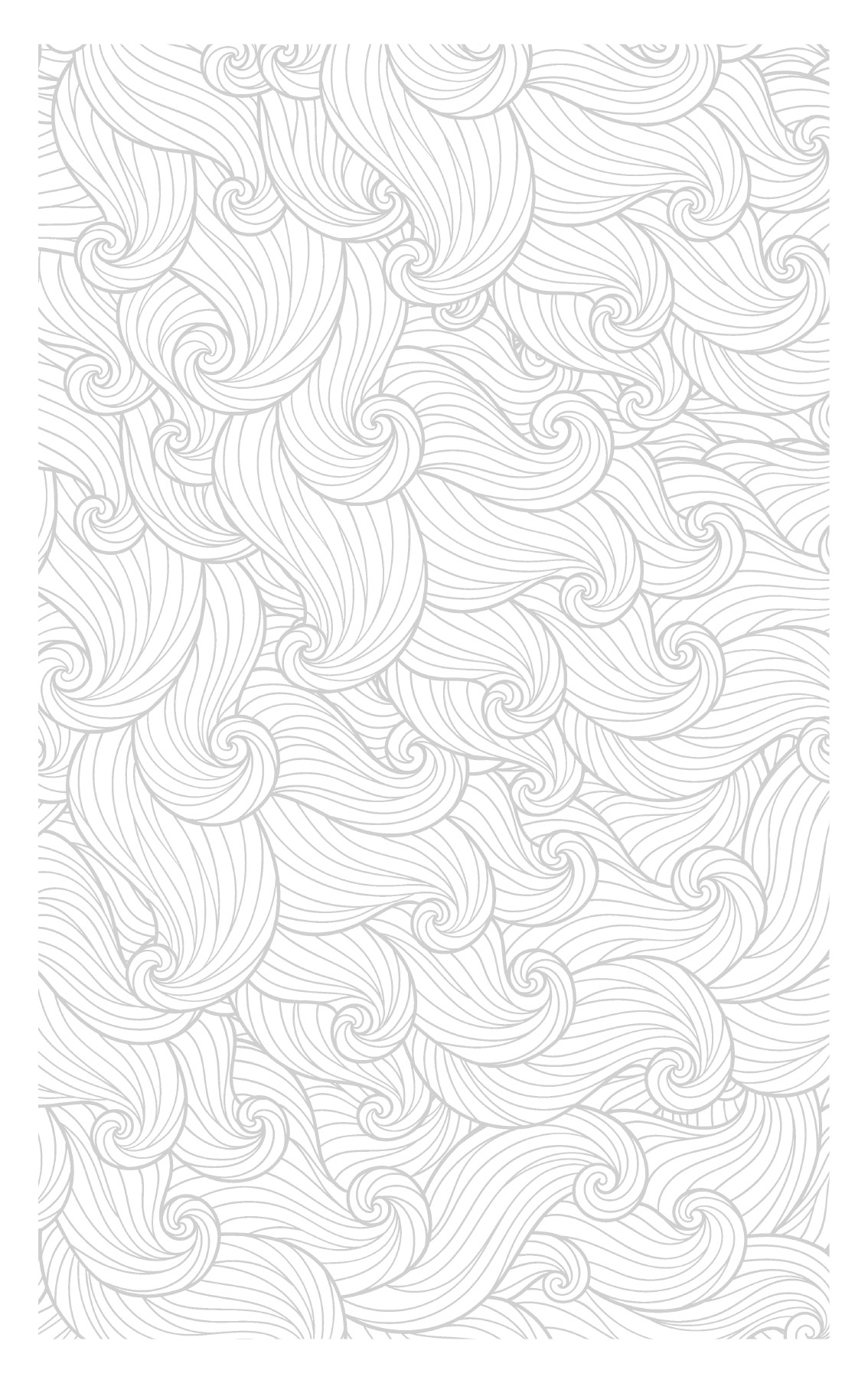

Bis jetzt
Die Beste bisher
Madre
Zerbrochen
Olivenöl
Gewitterjunge
Spiele
Ein Lügner und Dieb
Wale und Clowns
Ein knallhartes Leben
Auf Schatzsuche
Gezonkt
Der Riss
Rückkehr der Madre
Dieser nahrhafte Tee
Fleischwurstschüsselchen
Kein Ende als Krabbenpuffer
Wer beobachtet dich beim Sandwichessen?
Bist du das?
Samen, die aufgehen, und Samen, die nicht aufgehen
Ein nicht ganz perfektes Bild
Optimistische Elefanten
Eine Schaufel voll Sand
Sturm
Die Reel of Misfortune
Ein mittleres Drama
Wettervorhersage
Haifutter
Der beste Erfolgsanzeiger
War meine Momma stark?
Aale für die Reel
Von draußen nach drinnen schauen
Der härteste Panzer von allen
Chatham Pier
Wer wirst du einmal sein?
Boots
Eier und Kartoffeln
Jetzt wird gegrillt
Ausreißer
Das Gefühl, bestohlen worden zu sein
Katzenkinder
Ein Geheimnis lüften
Eine Lektion von Moby Dick
Die Sonne wird herauskommen
Wer bleibt
Was man sieht
Das Große mit der Leiter
Ein Geschenk von Opa
Der beschützende Baum
Liebe Leserinnen und Leser,
Danksagungen

Es gibt zwei Arten von Menschen. Solche, die Überraschungen lieben, und solche, die es nicht tun.
Ich tu’s nicht.
Dennoch kommt Aimee Polloch, meine Freundin seit der ersten Klasse, laut wie eine Krähe im Sommer ins Haus marschiert. »Delsie! Ich habe die Überraschung!«
Oh-oh.
»Also«, beginnt sie, »du weißt doch, dass Michael und ich beim Casting für die Sommerproduktion im Kap-Theater waren, ja?«
»Ach ja?«
»Michael hat eine super Rolle bekommen, aber ich … ich habe die Hauptrolle bekommen! Die Hauptrolle! Kannst du das glauben?« Sie wird plötzlich todernst. »Moment. Autogramme. Meinst du, die Leute wollen welche von mir haben?«
»Ich glaube, wir werden einen roten Teppich besorgen müssen, der zu eurer Haustür führt.«
»Das ist kein Witz.« Sie beugt sich ein wenig vor. »Hast du eine Ahnung, wie viele berühmte Leute im Kap-Theater angefangen haben?«
»Ich glaube, du hast es schon einmal erwähnt«, erwidere ich lächelnd.
Sie macht einen Riesenschritt und steht direkt vor mir. »Ich brauche aber deine Hilfe. Unbedingt.«
»Meine Hilfe? Wie könnte ich dir denn helfen? Du weißt doch, dass ich lieber bei Sturm und Hagel mit einem Hängegleiter fliegen würde, als in einem Theaterstück mitzuspielen.«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich brauche dich nicht in dem Stück, Delsie. Du musst mir nur bei meiner Rolle helfen. Wir spielen Annie«, fügt sie mit großen Augen hinzu.
»Die Hard-knock-life-Annie? Aus dem Film, den wir gesehen haben?«
Sie verdreht die Augen. »Es war schon ewig ein Theaterstück, bevor es verfilmt wurde.«
»Meinetwegen, Aims. Du weißt, dass Theater nicht wirklich mein Ding ist.«
»Es geht einfach nur darum, dass ich …« Sie wedelt mit der Hand in der Luft herum wie ein Zauberer. »... authentisch sein will.«
»Und? Ich verstehe immer noch nicht, wie ich dir helfen kann. Könnte Michael das nicht viel besser?«
»Nein. Er kann mir nicht helfen. Nicht so wie du. Michael hat … eine Familie.«
Ich habe das Gefühl, gestolpert, aber noch nicht gestürzt zu sein.
»Sag es mir. Wie ist es … wie ist es wirklich … Waise zu sein?«
Der Boden unter meinen Füßen scheint in Bewegung zu geraten.
Sie beugt sich vor. Redet. Redet und redet. Irgendetwas davon, dass ich Glück hätte. Während ich nur dastehe, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, zu verschwinden und ihr zu helfen. Ich taste nach einer Antwort auf ihre Frage, finde aber keine.
Natürlich habe ich über meine Mutter nachgedacht. Ich habe mich gefragt, wohin sie gegangen ist und wo sie die ganze Zeit gewesen ist. Doch Aimee hat wahrscheinlich recht. Ich wurde im Stich gelassen … und ich bin Waise. Aber klingt es blöd, wenn ich sage, dass ich nie wirklich so darüber nachgedacht habe?
Bis jetzt.


»Grammy!«, rufe ich, während ich die Treppe hinunterrenne. »Bist du bald so weit?«
Sie sitzt in ihrer Arbeitskleidung über ihr Puzzle gebeugt und drückt ein Teilchen hinein. »Ich weiß, dass du Hummeln im Hintern hast, weil Brandy wieder in Seaside ist«, sagt sie und steht auf. »Ich habe allerdings keine Hummeln im Hintern. Für mich heißt es, wieder eine Saison lang die ganzen Ferienhäuser putzen.« Sie tätschelt mir die Wange. »Jetzt lauf und hol unser Mittagessen aus dem Kühlschrank. Und vergiss unser gutes Rootbeer nicht.«
Ich bin in drei Sekunden in der Küche und wieder zurück. »Okay. Gehen wir!«
Wir setzen uns ins Auto. Wie immer zeichnet sie mit dem Finger ein Kreuz aufs Armaturenbrett, schaut durch die Windschutzscheibe hinauf zum Himmel und betet, dass der Wagen startet. Als er es tut, tätschelt sie das Armaturenbrett. »Braves Mädchen. Springst für deine gute alte Bridget an.«
Sie stellt den Hebel auf D. »Findest du es seltsam, dass ich mit dem Wagen rede?«
»Nur wenn du erwartest, dass er antwortet.«
Sie muss beim Lachen husten. »Du bist der letzte Heuler, weißt du das?«
Das zählt zu Großmutters größten Komplimenten.
Beim ersten Stoppschild schaut sie zu mir herüber. »Du gleichst einer Zecke kurz vor dem Platzen. Ich weiß schon, du kannst es kaum erwarten, Brandy zu sehen.«
»Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Aber eine Zecke kurz vor dem Platzen? Krass … Nein … uaaah!«
»Ich werde nie begreifen, wie ein Mädchen, das Tornados und Hurrikane und Überschwemmungen liebt, Angst vor einer kleinen Zecke haben kann.«
»Das Wetter saugt dir nicht dein Blut aus.« Ich erwarte eigentlich eine Erwiderung, doch sie schüttelt nur den Kopf.
Sie setzt den Blinker. »Dann hast du schon mit Brandy gesprochen? Bleibt sie wieder mit ihrer Familie den Sommer über?«
»Ja. Sie und ihre Mom zumindest.«
»Du liebe Güte! Ich erinnere mich noch an den Tag, als ihr euch zum ersten Mal begegnet seid.« Grammy lässt sich gegen die Rückenlehne fallen. »Ich hatte an dem Tag keine andere Wahl, als dich mit zur Arbeit zu nehmen, doch ihre Mutter war so nett und hat auf dich aufgepasst. Und du und Brandy, so klein ihr damals wart, habt nebeneinander in einem dieser großen Gartenstühle gesessen. Seither seid ihr wie Burger und Fritten.«
Ich muss lachen. »Grammy! Wer will denn wie Burger und Fritten sein? Das geht nie gut aus. Zumindest nicht für die zwei.«
Grammy schüttelt wieder den Kopf und fährt in eine Parklücke. Ich wende mich ihr zu. »Kann ich gehen?«
»Ja, aber achte um Himmels willen auf den Verkehr.«
Kaum setze ich einen Fuß auf den roten Gehweg, der nach Seaside hineinführt, höre ich Brandy auch schon. »Dels!«, ruft sie und springt von einem Picknicktisch auf. Es stinkt bereits nach Sonnencreme und Grillkohle, obwohl es noch nicht mal neun Uhr ist. Der Sommer hat offiziell begonnen.
Ich renne über den Rasen und wir fallen uns in die Arme und hüpfen herum. »Mensch! Wie geht es dir? Ich freue mich soooo, dich zu sehen!« Dann tritt sie einen Schritt zurück. »Wow, Dels, du bist gewachsen.«
»Findest du?« Dann fällt mir auf, dass Brandy viel älter aussieht als ich. Sie ist geschminkt, trägt eine Handtasche und die Art Klamotten, die man in kleinen Läden kauft und nicht in großen. Ich komme mir ein bisschen komisch vor in meinem verblichenen Boston-Marathon-T-Shirt, obwohl es das beste Flohmarktschnäppchen des letzten Sommers war. Aber Brandy lächelt und ich freue mich sie zu sehen.
»Ich habe schon unsere Sammeleimer geholt«, verkündet sie, und dieses Gefühl in meinem Bauch schmilzt. Sie ist die alte Brandy.
Seit der Vorschule haben wir Steine und Muscheln gesammelt, sie zusammengeklebt, angemalt und Skulpturen daraus gemacht.
Ich zupfe an ihrem Ärmel. »Aber lass uns zuerst nach dem Haus sehen.«
Unter ein paar riesigen blühenden Büschen steht ein Steinhäuschen, das wir im Sommer, bevor wir in die zweite Klasse kamen, gebaut haben. Wir hofften, dass Feen einziehen würden. Das war vor fünf Jahren. Jetzt schauen wir einfach jeden Sommer als Erstes danach.
Ich lasse mich auf die Knie fallen und biege die Zweige beiseite. Das Haus ist nicht mehr da.
Brandy kauert neben mir. »Wo ist es?«
»Keine Ahnung. Glaubst du, jemand hat es mitgenommen?«
Sie lacht. »Wahrscheinlich. Es war schließlich kein Wohnmobil. Es sei denn, die Feen sind endlich aufgetaucht.« Sie richtet sich auf und tritt einen Schritt zurück.
Ich krieche durchs Gebüsch und suche nach dem Häuschen.
»Komm«, sagt sie, »lass uns an den Strand gehen.«
»Ist es dir denn gleichgültig?«, frage ich.
»Klar wäre es mir lieber, es wäre noch da, Dels. Aber wahrscheinlich haben es ein paar Kinder entdeckt. Was soll’s.« Sie zupft mich am Ärmel. »Komm, gehen wir an den Strand. Ich muss an meiner Bräune arbeiten.«
An ihrer Bräune? Seit wann macht sie sich Gedanken um ihre Bräune? Ich folge ihr, doch die leise Stimme, von der mein Nachbar Henry sagt, dass man sie auf keinen Fall ignorieren darf – diese leise Stimme, die Menschen hören, wenn sie in Gefahr sind oder kurz davor, eine Dummheit zu begehen –, sagt mir, dass eine Kaltfront im Anmarsch ist. Die Luft verändert sich. Ich finde es schlimm, dass das Häuschen nicht mehr da ist, aber noch schlimmer finde ich, dass es Brandy so gar nichts ausmacht.
Wir schnappen die Eimer, und als sie losrennt, renne ich auch. Die Fiesters haben einen alten roten und einen blauen Eimer, mit denen Mrs Fiester und ihr Bruder vor einer Million Jahren auf dem Kap gespielt haben. Sie sind aus Metall und inzwischen völlig zerkratzt. Am unteren Rand haben sie Rost angesetzt. In einem Eimer sammeln wir Steine, im anderen Muscheln, damit die Muscheln nicht kaputt gehen, wenn ein Stein darauf fällt.
»Okay«, sagt sie. »Steine oder Muscheln?«
»Du darfst wählen.« Ich lächle und bin einfach nur glücklich, mit Brandy wieder an der Seagull Beach zu sein. Sie fehlt mir den Rest des Jahres. Wir chatten gelegentlich, aber das ist nicht dasselbe. Wir können es kaum erwarten, bis ihre Mutter und meine Grammy uns unsere eigenen Handys erlauben. Allerdings freue ich mich am meisten auf die App, die globale Blitzeinschläge aufzeichnet.
Wir hängen den Vormittag über an den Molen ab, sammeln verschiedene Dinge und veranstalten den einen oder anderen Spritzwettkampf mit den Füßen. Irgendwann kehren wir zu den Picknicktischen zurück, breiten unsere gesammelten Schätze aus und überlegen, welche Skulpturen wir daraus machen.
Brandy sortiert die Steine der Größe nach. »Findest du es nicht kindisch, dass wir das immer noch machen?«
»Nicht, solang es uns Spaß macht.«
»Ja … wahrscheinlich. Wenigstens sieht uns niemand.«
Ich schaue sie an. »Und wenn doch … wen kümmert’s?«
»Ja, wahrscheinlich hast du recht.«
Aber ich kenne Brandy. Ihr Mund stimmt mir zu, doch ihr Gehirn denkt etwas vollkommen anderes.


Brandys Mom lehnt sich aus der Tür und ruft ihr zu: »Liebes, wir müssen in ein paar Minuten los zu unserem Termin.«
Brandy ruft »Okay« zurück. Sie tut mir leid. »Oh, Mist. Musst du zum Zahnarzt oder so?«
Sie lächelt. »Nein, meine Mom und ich bekommen Mani-Pedis.«
Meine Nachbarin Esme bekommt so was auch, deshalb weiß ich, was es ist, aber ich war noch nie bei einer. Eher würde meine Grammy mich im größten Sturm zu einer Raftingtour mitnehmen.
Brandy winkt, als sie gehen, und als sie um die Ecke verschwinden, empfinde ich eine Leere, die ich vorher nicht gekannt habe.
Ich bin Waise, wie Aimee sagt. Keine Mutter. Kein Vater.
Ich habe nie darüber nachgedacht. Mir auch nie Sorgen gemacht deshalb. Doch jetzt, da ich einmal damit angefangen habe, frage ich mich, was ich tun würde, wenn Grammy etwas zustoßen würde. Würden Henry und Esme mich zu sich nehmen? Obwohl sie eine eigene Tochter haben?
Ich vergrabe die Hände in meinen Taschen, mache mich auf die Suche nach Grammy und sage ihr, dass ich am Strand spazieren gehe und wir uns später zu Hause treffen.
»Pass auf dich auf«, sagt sie, drückt einen Kuss auf ihre Handfläche und bläst ihn in meine Richtung. Seit ich klein bin, habe ich mir im Spaß immer einen Klaps auf die Wange gegeben, als treffe mich dort ihr Kuss. Heute kann ich mich nicht dazu überwinden.
Am Strand gehe ich direkt am Wasser entlang und beobachte, wie kleine Steine mit den Wellen hin und her kullern. Genau so kullert Aimees Waisen-Frage in meinem Kopf hin und her.
Doch dann … sehe ich etwas am Strand, mit dem ich nie gerechnet hätte.
Zunächst fürchte ich, er sei tot, doch seine dunklen Augen folgen mir, als ich vor ihn trete. Es erscheint so unnatürlich, wie er da ohne Beine am Strand liegt und doch aussieht, als wollte er weggehen. Sogar wegrennen.
Die Strandwache ist eine zierliche Frau mit kräftiger Stimme. »Alle zurücktreten!«, ruft sie der größer werdenden Menschenmenge zu. »Der kleine Seehund hat Angst.«
Die meisten Leute hier sind Touristen. Das sehe ich an den vielen Cape-Cod-T-Shirts aus diesem bekannten »Kaufe eines, bekomme zwölf umsonst«-Laden. Einheimische würden sich nicht lebend in so einem Teil erwischen lassen.
Die Leute bewegen sich nicht schnell genug für die Strandwache. Sie beugen sich vor. Fotografieren. »Liebes«, bittet eine Mutter ihre Tochter in lautem Flüsterton, »geh ein wenig näher an den Seehund heran und lächle.«
Die Strandwache wird zur Mauer. Sie geht mit ausgebreiteten Armen in die Menschenreihe, als könnte sie fliegen. »Nein, Ma’am. Treten Sie jetzt bitte zurück.« Ich bewundere sie. Sie wirkt nett, lässt aber gleichzeitig ein unmissverständliches Legt euch nicht mit mir an durchklingen.
Die Reihe setzt sich in Bewegung, doch meine Füße machen ohne mein Zutun einen Schritt nach vorn. Der Seehund ist klein. Ist er krank? Wird er sterben? Die Strandwache wirft mir einen strengen Blick zu und ich trete mit den anderen zurück.
Ein Junge neben mir spricht spanisch. Vom Spanischunterricht in der Schule ist nicht viel hängen geblieben, doch er verwendet das Wort madre. Das, so viel weiß ich noch, »Mutter« bedeutet.
Die Frau von der Strandwache steckt Holzstangen in den Sand, zieht ein Neonband von einer zur anderen und spannt so ein großes Viereck aus leuchtendem Band um den Seehund. »Es kommt sehr häufig vor«, erklärt sie, »dass eine Mutter ihr Junges am Strand lässt, während sie jagen geht. Das Baby bleibt hier auf dem Sand zurück, wo es in Sicherheit ist. In Sicherheit vor den Weißhaien, die sie jeden Sommer jagen.«
Eine Welle der Erleichterung überspült mich. Das Seehundjunge ist okay.
Ich schaue hinaus auf die anrollenden Wellen und frage mich, wo die Seehundmutter ist. Wie ist es möglich, dass sie sich erinnert, wo sie ihr Baby auf diesem Strand zurückgelassen hat, der sich über die gesamte Südküste von Cape Cod erstreckt?
»Bitte gehen Sie nicht weiter als bis zu dem Band«, ruft die Frau der Menge zu. »Falls die Mutter zu dicht bei ihrem Baby Menschen sieht, lässt sie es vielleicht im Stich.«
Die beiden Wörter ihr Baby gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Nicht das Baby oder ein Baby, sondern ihr Baby.
Die Frau von der Strandwache dreht sich um. Ihre nächsten Worte scheinen nur an mich gerichtet zu sein. »Aber keine Bange. Die Mutter kommt immer zurück.«
Wieder blicke ich hinaus auf den Ozean. Wenn es nur wahr wäre.
Ich gehe am Strand entlang, weg von all den Menschen, die mich total nervös machen. Und während ich die Seagull Beach hinuntergehe, schleppe ich die ganze Zeit diese Gedanken an das Seehundjunge mit mir herum.
Ob es sich Gedanken über seine Situation macht?
Der nasse Sand quillt beim Gehen zwischen meinen Zehen nach oben. Doch bald ist es vorbei mit der Stille. Der Wind trägt aufgeregte Stimmen zu mir herüber. Als ich mich umdrehe, sehe ich, dass die Frau von der Strandwache die Leute ein gutes Stück weiter nach hinten geschickt hat. Der ganze Lärm und die auf den Ozean zeigenden Hände sagen mir, dass es dort etwas zu sehen gibt. Also sprinte ich zurück, immer am Rand des Wassers entlang. Als ich nah genug herangekommen bin, sehe ich etwas wie einen schwarzen Ball auf dem Wasser treiben. Den Kopf der Madre, der Seehundmutter.
Das Seehundbaby robbt wie eine dicke kleine Raupe zum Ozean. Unter dem Neonband durch und auf die Wellen zu. Die Seehundmutter schwimmt vor und zurück, vor und zurück, und ich spüre ihre Sorge wegen all der Leute in der Nähe ihres Babys. Aber immerhin … ist sie da.
Da.
Es überrascht mich, wie erleichtert ich bin, sie zu sehen. Als das Baby das Wasser erreicht hat, katapultiert sich die Seehundmutter aus dem Wasser und taucht wieder ab. Springt und taucht ab.
Und dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Ich beginne zu weinen. Nicht die Art von Weinen, die man unterdrücken und hinunterschlucken kann, sondern die andere Art, bei der dein ganzer Körper weiß, wie du dich fühlst. Und genau in dem Moment wird mir klar, dass es einfach nicht stimmt, wenn die Leute sagen, dass man etwas, das man nicht kennt, auch nicht vermissen kann.


Ich renne barfuß vom Strand hinauf zu unserem Haus, stoße die Haustür auf und stolpere hinein.
Grammy schaut sich Der Preis ist heiß an und beugt sich zur Seite, um an mir vorbeisehen zu können, als ich mich vor dem Fernseher aufbaue.
»Grammy, ich muss dich was fragen.«
»Du meine Güte, Liebes. Wirst du jemals Schuhe tragen?« Sie schüttelt den Kopf. »Hol die Salbe und die Binden, damit ich dich verarzten kann.«
Ich betrachte meine Füße. Einer blutet.
»Grammy!« Ich bin selbst erschrocken, wie schrill meine Stimme klingt. »Bitte, bitte erzähl mir von meiner Mom. Ich weiß, dass du nicht gern über sie sprichst, aber ich muss wissen, wie sie war. Hat sie geklungen wie ich? War sie eine Läuferin? Mochte sie Rootbeer?«
Grammy sieht aus wie damals, als sie den Stecker des Toasters in die Steckdose gesteckt hat und einen Stromschlag erhielt.
»Und wer ist mein Dad? Wie heißt er?«
»Oh, tut mir leid, Kleine. Ich würde es dir sagen, wenn ich es wüsste, aber Mellie hat es mir nie verraten.«
Das tut weh.
Ich mache einen Schritt auf sie zu. »Dann will ich wenigstens wissen, warum sie gegangen ist. Sag mir die Wahrheit über meine Mom.«
»Oh, Delsie, weshalb möchtest du über das alles reden? Es gibt keinen Grund, traurige Dinge ans Licht zu zerren.«
»Ich weiß, dass du nicht gern über sie sprichst, aber ich kapiere einfach nicht, weshalb.«
»Aus demselben Grund, aus dem ich keinen Kaffee trinke«, erwidert Grammy. »Weil es meinem Magen nicht guttut und ich mich danach innendrin ganz schrecklich fühle. Und warum sollte ich etwas tun, das solche Gefühle hervorruft?«
»Ich weiß, dass es dich traurig macht, über sie zu reden. Das weiß ich. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn ich einfach ein paar Dinge wüsste. Nichts zu wissen ist das schlimmste Gefühl auf der ganzen Welt. Seine Mom nicht zu kennen ist, als wüsste man nicht, wann man Geburtstag hast. Und das sollte jeder wissen.«
Eine Welle der Traurigkeit spült über ihr Gesicht, dann klopft sie neben sich auf die Couch. »Komm. Setz dich zu deiner guten alten Grammy. Wir wollen sehen, wer die letzte Runde gewinnt. Eine Lady hat auf zwei Autos gesetzt. Zwei Stück!« Sie hebt zwei Finger, macht große Augen und lächelt, und ich weiß, dass ich nichts über meine Mutter erfahren werde.
»Später«, sage ich und gehe an ihr vorbei.
Ich habe nicht die Absicht zurückzukommen, und ich weiß, dass sie während der letzten Runde von Der Preis ist heiß nicht nach mir schauen wird, es sei denn, das Haus brennt lichterloh. Und selbst dann ist es noch fraglich.
Meine Zimmertür quietscht, als ich sie schließe. Ich setze mich aufs Bett und greife nach dem Foto von meiner Mutter in einem Rahmen voller Zuckerperlen und Glitter. Ein Foto, dem ich Gute Nacht gesagt habe, seit Opa Joseph mir beigebracht hat zu beten.
In meinem Kopf herrschen schwere Turbulenzen. Meine Fragen richten immense Schäden an, wirbeln alles herum und hinterlassen ein Trümmerfeld.
Und ich werde das Bild von dem kleinen Seehund nicht los. Wie kann es sein, dass er so viel mehr Glück hat als ich? Meine Fingerspitzen werden weiß, so fest halte ich den Bilderrahmen. Die Worte »Das ist nicht fair« blubbern in mir hoch und aus mir heraus, und Glas zerschellt, als ich das Bild auf den Boden schmettere. Ich betrachte die Scherben und Rahmenteile und bin genauso kaputt.
Die Teile erinnern mich an Grammys Puzzle, obwohl ich den Sinn eines Puzzles nie verstanden habe. Warum sitzt jemand stundenlang da und versucht ein Bild, das in hundert Teile zerstückelt wurde, wieder zusammenzusetzen? Außerdem weiß man, wenn man den Deckel der Schachtel anschaut, ganz genau, was am Ende dabei herauskommt.
Ich komme mir ein bisschen vor wie ein Haufen Puzzleteilchen, die man auf den Boden geschüttet hat. Aber ich kann die Teilchen nicht zusammensetzen, da ich das Bild auf der Schachtel nicht kenne. Ich weiß nicht, wer ich bin – oder wie viele Teile mir fehlen. Und seit Aimee mir die Augen geöffnet hat für etwas, das die ganze Zeit vor mir lag, frage ich mich, was ich sonst noch alles nicht sehe.
Ich schaue mir die zerbrochenen Rahmenteile an und fühle mich genauso zerbrochen.


Das Viertel, in dem ich wohne, liegt am Ende einer unbefestigten Straße, die die meisten Leute für eine Hofeinfahrt halten. Es hat die Form eines Lutschers. Die Straße ist der Stiel, der zu vier im Kreis angeordneten Häusern führt – drei bewohnte und eines, das seit Jahren leer steht.
Strauchkiefern, die aussehen wie die windschiefen Bäume in einem Buch von Dr. Seuss, bieten das ganze Jahr über Schatten. Doch in der Mitte des Kreises steht eine richtige Kiefer, die alles überragt. Wir nennen sie Olives Baum nach einer unserer Nachbarinnen, obwohl ich nicht weiß, weshalb, außer, dass sie den Baum liebt und länger hier wohnt als wir alle.
Am Eingang zu unserem kleinen Viertel steht ein Schild, auf dem MÜLL ABLADEN VERBOTEN steht, und wenn man rausfährt, sagt ein verblichenes, bemoostes Schild DANKE.
Grammy behauptet, das bedeutet »Danke für Ihren Besuch«.
Olive behauptet, es heißt »Danke, dass ihr wieder verschwindet«.
Jetzt steht Olive vor unserer Tür.
Olive Tinselly erinnert mich an einen Hurrikan. Sie wirbelt herum und gewinnt an Kraft, während sie vorwärtsstürmt. Doch wie das Auge eines Sturms gibt es auch bei ihr ruhige Momente. Sogar sonnige. An Olives stürmischen Tagen müssen wir besonders nett zu ihr sein, sagt Grammy, da es in ihrem Leben viele Verluste und Grund zu Trauer gegeben hat. Doch Olive macht keinen traurigen Eindruck auf mich. Sie wirkt einfach nur wütend.
Schon beim Öffnen der Tür sehe ich an der Form ihres Mundes, dass es ein stürmischer Tag ist. »Ist deine Großmutter zu Hause?«
Grammy reißt sich von ihrem Puzzle los und stellt sich neben mich. »Hallo, Olive«, grüßt Grammy. Und quasi als Information fügt sie noch »Ein herrlicher Abend« hinzu.
»Wir müssen etwas bezüglich Henry unternehmen«, faucht Olive. »Dieses Mal ist er zu weit gegangen.«
Was? Ich kann’s nicht glauben. Zu weit gegangen? Henry?
»Habt ihr gesehen, was er getan hat?«
»Du liebe Güte, Olive«, meint Grammy. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass er überhaupt Zeit hat, etwas Schlimmes anzustellen. Er arbeitet Vollzeit und muss sich allein um Ruby kümmern, während Esme weg ist und ihren Vater pflegt.«
»Dann seht es euch mit eigenen Augen an!«
Ich höre ein wunderschönes Klimpern, als wir vors Haus treten. Mrs Tinselly zeigt auf einen Baum in Henrys Garten. »Schaut euch das an! Ich fürchte, dieses Mal hat er tatsächlich den Verstand verloren. Weshalb würde jemand sonst etwas so Verrücktes tun?«
Esmarelda »Esme« Laskos silberne Löffel hängen an weißen Fäden im Baum. Das Klimpern ertönt, wenn sie im Wind aneinanderschlagen.
»Ich finde es wunderschön«, sage ich.
Olive hebt einen Finger und öffnet den Mund, um etwas zu erwidern.
Grammy kommt ihr zuvor. »Jetzt komm mal wieder runter, Olive. Jeder Pfannkuchen hat zwei Seiten. Wahrscheinlich gibt es einen verflixt guten Grund dafür.«
»Zuerst streicht Esme das Haus leuchtend rot an«, beginnt Olive. »Herrgottnochmal, es sieht aus wie ein Feuerwehrauto. Und dann hat sie die Vorderfront auch noch mit diesen ganzen lächerlichen Eidechsen aus Metall vollgepappt. Ich weiß, dass sie das an ihre Heimat erinnert, aber hier auf dem Kap ist es bescheuert …«
In diesem Moment schwingt die Fliegentür auf und Henry tritt auf die Veranda. »Wem oder was verdanke ich das Vergnügen einer so erfreulichen Gesellschaft?« Er zwinkert mir zu.
»Henry Lasko! Was hast du getan?«, fragt Olive.
»Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen, Olive. Ist das nicht ein wunderschöner Tag?« Er tut so, als lüfte er zum Gruß den Hut.
Ruby kommt aus dem Haus, schlingt beide Arme um die Beine ihres Daddy und stellt sich auf seine Füße. Aber es ist die Art, wie sie zu ihm aufschaut. Ich habe das schon tausend Mal gesehen, aber jetzt fährt es mir zum ersten Mal in den Magen. Es wäre schön, einen Dad wie Henry zu haben.
Er legt eine Hand auf Rubys Kopf und schaut hinauf zu den Löffeln. »Das war Rubys Idee. Sie vermisst ihre Mom und sagt, die Löffel klingen wie das Lachen ihrer Mutter.«
Womit sie recht hat, wie ich feststelle.
»Es ist schwer für sie.« Er weist mit dem Kinn auf seine Tochter. »Esmes Dad ist ziemlich krank. Sie wird also noch eine ganze Weile weg sein.«
Mir kommt Esmes Löffelsammlung und die Wand voller Teetassen in den Sinn, und dass ich mir eine aussuchen darf, wenn ich bei ihr zum Tee eingeladen bin. Im Sommer gibt es Eistee in Gläsern mit dickem Rand, wie sie früher zum Einkochen benutzt wurden.
Esme gibt mir immer einen der Löffel, die jetzt im Baum hängen, zum Umrühren, und wir spreizen den kleinen Finger ab beim Trinken und lachen. Und tun so, als seien wir vornehmere Leute, als wir tatsächlich sind. Mein Magen schmerzt, wenn ich an sie denke, und ich merke, wie sehr auch ich Esme vermisse.
Nachdem Henry Olive einige Augenblicke betrachtet hat, schaut er mich an. »Und da wir gerade von großen Fischen reden – Delsie! Du hättest das Riesenteil sehen sollen, das wir heute rausgezogen haben!«
»Henry Lasko!«, schimpft Olive. »Fang nicht wieder damit an!«
Wenn es Henry nicht passt, wovon Olive spricht, sagt er »da wir gerade von … reden« und schwenkt zu einem vollkommen anderen Thema um. Olive hasst das. Ich glaube, sie streitet lieber.
»Es war ein Streifenbarsch«, fährt Henry fort, »aber einen so großen habe ich noch nie gesehen. Er war eine Stange Geld wert, aber es hätte mir das Herz gebrochen, wenn ich ihn behalten hätte. Deshalb habe ich ihn wieder freigelassen.«
»Henry! Das hast du nicht getan!«, ruft Großmutter.
»Ich weiß. Sag Esme nichts davon. Aber er hat so lang gelebt, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich hätte kein Recht, ihn jemandem auf den Teller zu legen.« Er verlagert sein Gewicht auf die Fersen. »Man hätte jede Menge Teller damit füllen können.«
»So ein Unsinn!«, faucht Olive. »Was für ein Fischer bist du denn? Der arme Joseph McHill schüttelt wahrscheinlich droben im Himmel den Kopf, weil er dir sein Boot überlassen hat, als Gott ihn heimgeholt hat.«
Henry und ich schauen uns an und er zwinkert mir wieder zu. »Opa Joseph hätte eine Möglichkeit gefunden, den herrlichen Fisch zu retten und Geld damit zu verdienen.« Er blickt nach oben und atmet tief durch. »Jeden Tag, wenn ich vom Hafen in Chatham auslaufe, blicke ich zum Himmel hinauf und danke Joseph dafür, dass er mir die Reel of Fortune überlassen hat. Sie ist das beste Boot auf dem Kap.« Henry kommt zu mir und wuschelt mir kurz durchs Haar. »Er war ein guter Mensch und ein guter Freund, dein Opa. Ja, das war er. Er fehlt mir auch.«
Olive fängt wieder mit den Löffeln an, doch Henry unterbricht sie. »Da wir gerade von Ruby reden, wir sollten besser reingehen.« Er lacht leise in sich hinein und geht zurück ins Haus.
Als sich die Tür hinter ihm schließt, holt Grammy tief Luft und blickt auf das Haus. »Du hast vollkommen recht, Olive. Es muss etwas passieren.«
Olive nickt zufrieden in Grammys Richtung. »Endlich. Etwas Vernunft.«
»Und ich weiß auch schon, was.« Grammy grinst. »Henry braucht was Gebackenes. Vielleicht ein paar Brownies. Oder ein Stück von diesem Blaubeerkuchen, den er so gern mag.« Sie wendet sich an mich. »Was hältst du davon, Delsie?«
»W-w-was?«, stammelt Olive. »Das ist doch keine Lösung. Was ist mit … den Löffeln?«
»Kein Löffel auf der ganzen Welt hat sich je einsam oder vergessen gefühlt. Henry dagegen? Wir müssen ihn und Ruby wissen lassen, dass wir ihre Nachbarn und Freunde sind.« Sie beugt sich vor und schaut ihr in die Augen. »Und es war einfach ganz, ganz lieb von dir, Olive, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast.«
»Also, das war nicht unbedingt …«
Grammy unterbricht sie erneut. »Weißt du was, Olive? Du könntest uns beim Backen helfen.«
»Also, ich … ich meine … ich weiß nicht … Ich habe eine Menge zu tun.«
»Du brauchst nur zu rufen, falls du es dir anders überlegst, ja?«
Olive wirkt hin- und hergerissen. Als wollte sie gern kommen, würde es sich aber nicht erlauben. Ich weiß jetzt schon, dass Grammy mich beim Backen zu ihr rüberschicken wird, um etwas zu borgen, das wir gar nicht brauchen, nur um Olive noch einmal eine Chance zu geben zu kommen.
Ich lächle in mich hinein. Einer von Grammys Sprüchen lautet: Wenn Leute mit Steinen werfen, kann man entweder Mauern damit bauen oder Brücken. Grammy war immer eine Brückenbauerin.
