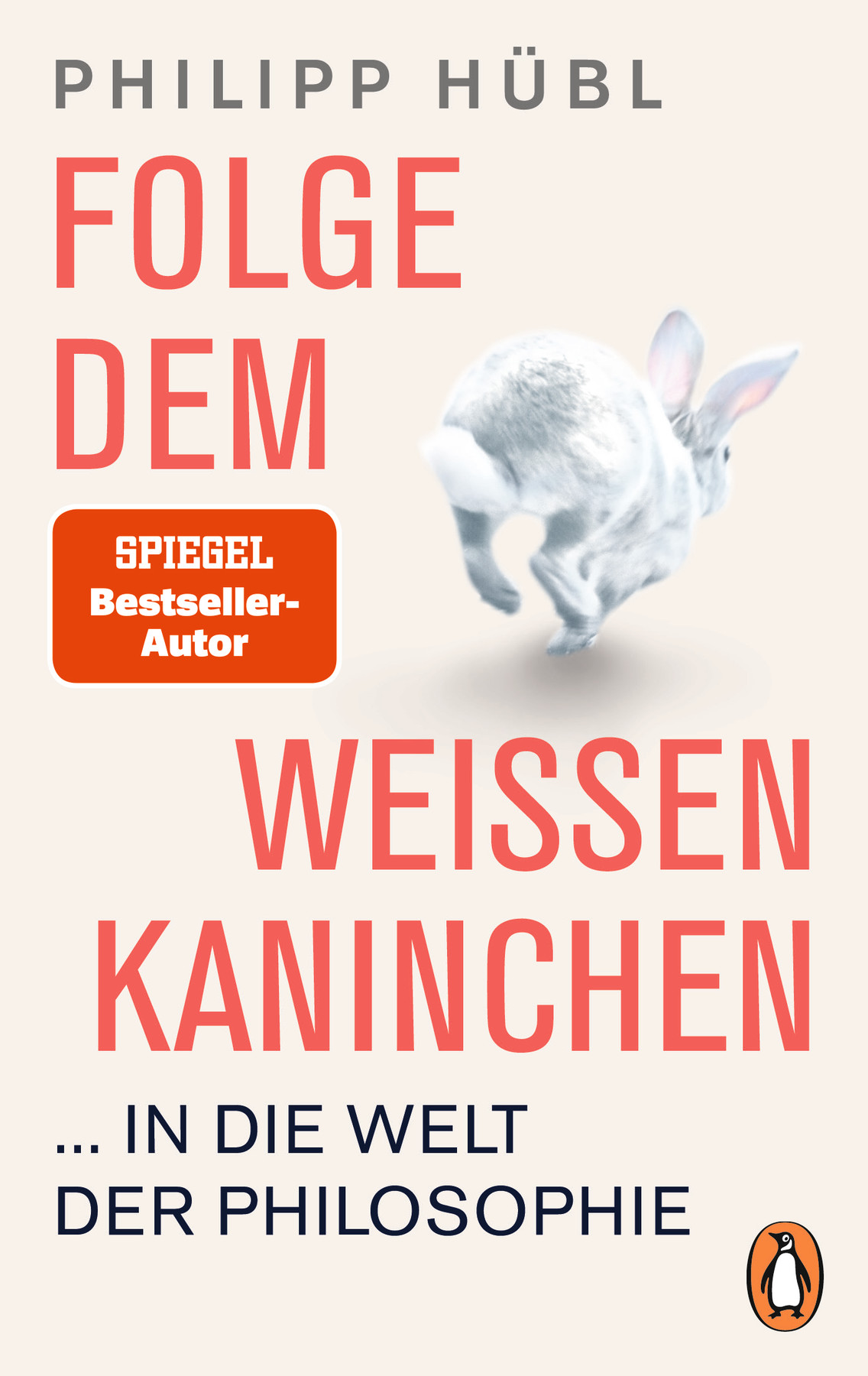
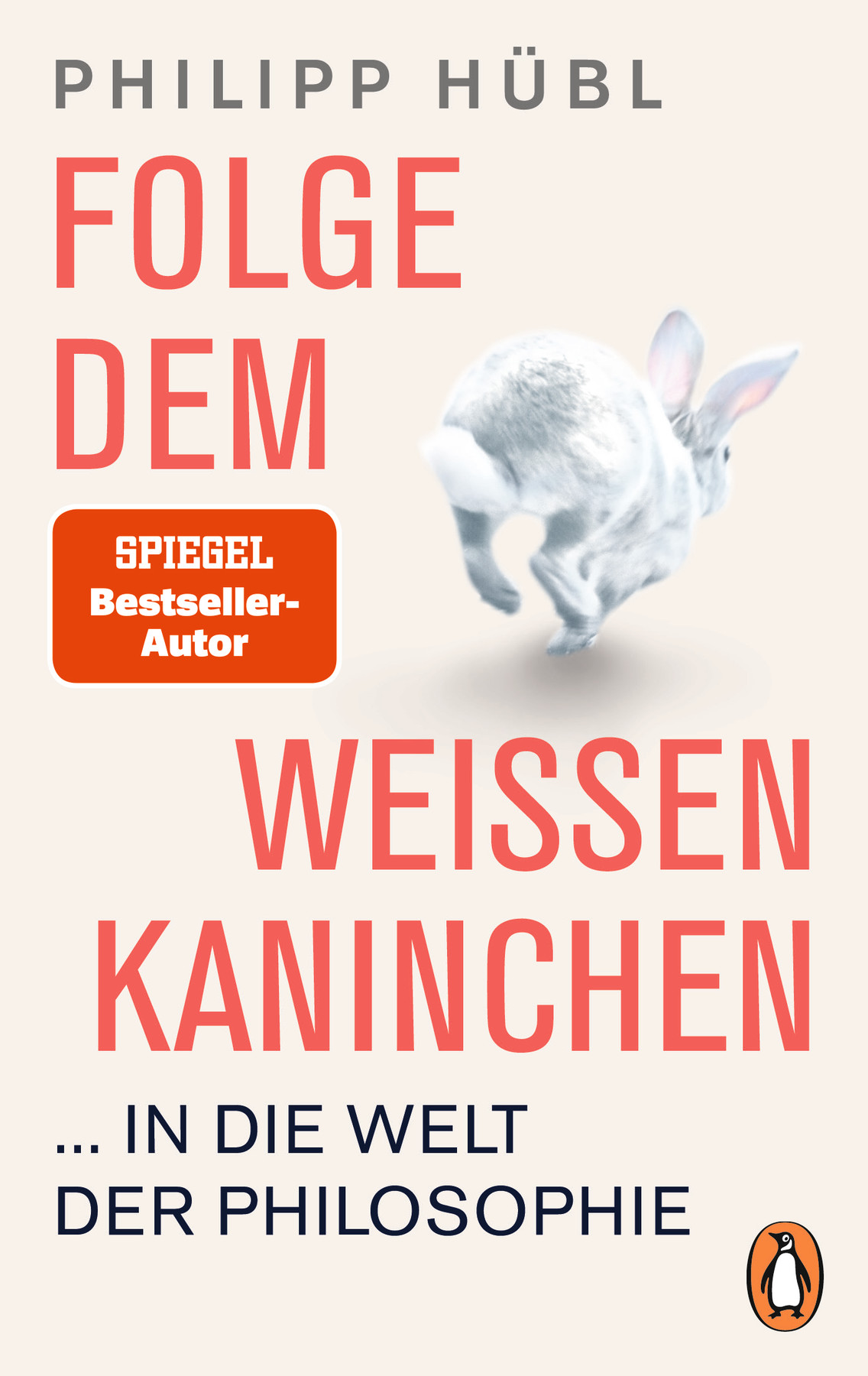
Professor Dr. Philipp Hübl hat Philosophie und Sprachwissenschaft in Berlin, Berkeley, New York und Oxford studiert und u. a. an der RWTH Aachen, der Humboldt-Universität Berlin und der Universität Stuttgart gelehrt. Er ist Autor mehrerer Bücher, darunter Der Untergrund des Denkens. Eine Philosophie des Unbewussten (2015), Bullshit-Resistenz (2018) und Die aufgeregte Gesellschaft (2019). Sein Bestseller »Folge dem weißen Kaninchen« wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
Folge dem weißen Kaninchen … in der Presse:
»Hübls locker und luzide geschriebene Einführung ist
wärmstens zu empfehlen.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
PHILIPP HÜBL
FOLGE DEM
WEISSEN
KANINCHEN
… IN DIE WELT DER PHILOSOPHIE

Einleitung
Dem Kaninchen auf der Spur
Kapitel 1
Fühlen – Die Vernunft des Bauches
Kapitel 2
Sprechen – Das Spiel mit Bedeutung
Kapitel 3
Glauben – Der Gott im Gehirn
Kapitel 4
Träumen – Der Wahnsinn des Schlafes
Kapitel 5
Handeln – Die Freiheit des Willens
Kapitel 6
Wissen – Auf Umwegen zur Wahrheit
Kapitel 7
Genießen – Die Kunst der Schönheit
Kapitel 8
Denken – Das Rätsel des Bewusstseins
Kapitel 9
Berühren – Die Entdeckung des Körpers
Kapitel 10
Leben – Der Sinn des Todes
Anhang
Literaturliste
Personenregister
Sachregister
Dem Kaninchen auf der Spur
Als Alice im Garten spielt, hoppelt plötzlich ein weißes Kaninchen vorbei, das irgendetwas vor sich hin murmelt. Sie rennt ihm nach, fällt in den Kaninchenbau und gelangt so ins Wunderland. Alice reist von der Wirklichkeit in eine Phantasiewelt. Und wieder zurück. Lewis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland, war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Logiker und Philosoph. So entpuppt sich das Wunderland beim zweiten Lesen als ein Ort voller philosophischer Rätsel: Kann man schon vor dem Frühstück sechs unmögliche Dinge denken? Kann Humpty Dumpty die Bedeutung seiner Worte selbst festlegen? Kann die Grinsekatze komplett verschwinden, während ihr Grinsen zurückbleibt?
Im Film The Matrix geht die Reise in die umgekehrte Richtung. Neo, die Hauptfigur, sieht auf seinem Computerbildschirm die Nachricht «Folge dem weißen Kaninchen». Kurz darauf klopft es an seiner Tür. Eine Frau, auf deren Schulter ein Kaninchen tätowiert ist, lädt ihn zu einer Party ein. Neo trifft den mysteriösen Morpheus, der ihn zwischen einer roten und einer blauen Pille wählen lässt. Neo nimmt die rote und reist aus seiner grünlich eleganten Phantasiewelt in die dunkle, rohe Wirklichkeit. Und kehrt mit geöffneten Augen wieder zurück. Wie Carroll haben die Regisseure Andrew und Lana (ehemals Laurence) Wachowski mit der Matrix einen Ort voller philosophischer Rätsel erschaffen: Könnte die ganze Welt eine Illusion sein? Können Maschinen denken? Haben wir einen freien Willen, oder ist alles Schicksal?
Wenn wir uns philosophische Fragen stellen, gehen unsere Gedanken auf Wanderschaft. In der Philosophie sind Metaphern der Fortbewegung wie «Wanderschaft» oder «Reise» allgegenwärtig. Immanuel Kant beschreibt das Philosophieren als «sich im Denken orientieren». Ludwig Wittgenstein zufolge hat ein philosophisches Problem die Form «Ich kenne mich nicht aus». Ziel der Philosophie sei es, der «Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas» zu zeigen. Fliegengläser sind unten offen und oben geschlossen. Hat die Fliege sich einmal da hinein verirrt, ist sie gefangen, denn sie will immer nach oben. Aus dem Glas findet sie so schwer wieder hinaus wie Menschen aus dem Wunderland oder der Matrix.
In diesem Buch können Sie dem weißen Kaninchen in ein anderes Wunderland folgen: die Wirklichkeit. Denn wer durch die philosophische Brille schaut, sieht Altbekanntes mit einem schärferen Blick. Die besten Entdeckungsreisen sind nicht die, bei denen man fremde Länder bereist, sondern die, bei denen man die Welt mit anderen Augen sieht, wie es bei Marcel Proust sinngemäß steht. Es ist eine Jagd mit reicher Beute, hin und her, querweltein, durchs ganze Leben und zurück.
Wir können wie gewohnt in den Supermarkt gehen oder gleichzeitig darüber nachdenken, ob ein Einkauf unsere Willensfreiheit auf die Probe stellt. Wir können ganz unbedarft die Oper besuchen oder uns dabei überlegen, ob wir die Walküre vielleicht bloß deshalb schön finden, weil wir zu einer Gruppe dazugehören wollen. Wir können einen Joint rauchen und es einfach nur genießen oder uns zusätzlich fragen, ob wir so unser Bewusstsein verengen oder erweitern und was damit überhaupt gemeint sein soll.
Dieses Buch ist eine Einführung in die moderne Philosophie. Zehn Kapitel geben klare Antworten auf große philosophische Fragen: Kann man ohne Gefühle leben? Gibt es Gott? Sind wir frei in unseren Entscheidungen? Was können wir wissen? Wie erhalten unsere Worte ihre Bedeutung? Kann man Bewusstsein wissenschaftlich erklären? Haben Träume eine Funktion? Wie erleben wir unseren Körper? Warum ist uns Schönheit so wichtig? Hat der Tod einen Sinn? Dabei steht jedes Kapitel für sich und ist unabhängig von den anderen verständlich.
Klassische Einführungsbücher haben mich immer gelangweilt. Ein Dutzend Mal las man etwas über die alten Denker* und deren schwerverständliche Theorien, ohne zu erfahren, wer eigentlich recht hatte und warum. Die spannenden aktuellen Debatten kamen so gut wie gar nicht vor.
* Aus stilistischen Gründen stehen allgemeine Ausdrücke wie «Philosophin» oder «Student» und die Personalpronomen «er» und «sie» immer für Frauen, Männer und andere. Das grammatische Geschlecht spiegelt nicht das biologische wider.
Dieses Buch bietet Orientierung im Irrgarten der Philosophie, einschließlich der Abkürzungen und Schleichwege, die sich erst in den letzten Jahrzehnten auftaten. Bei den Ausflügen bleiben einige bekannte, aber konfuse Theorien auf der Strecke, viele Vorurteile und Mythen werden zurechtgestutzt. Das Buch ist also keine typische Einführung, in der alle möglichen Positionen aufgelistet sind, sondern eine, in der die guten Argumente im Vordergrund stehen.
In der Oberstufe haben wir in vielen Fächern philosophische Texte gelesen. Mich hat das begeistert, aber die geballte Wucht an grauer Theorie war sicherlich für zwei Irrtümer verantwortlich, denen ich damals aufsaß. Zum einen die Auffassung, dass ein Text umso «tiefsinniger» sei, je dunkler und unverständlicher er mir zuraunte. Im Studium zeigte sich bald, dass die Unverständlichkeiten oft nicht von mir, sondern von den Texten abhingen, und dass die vermeintlich «tiefen Weisheiten» entweder Banalitäten oder Unsinn waren.
Der zweite Irrtum: Ich glaubte, dass ich durch das Philosophiestudium einen Vorhang zur Seite ziehen und so in eine ganz neue Welt eintauchen könnte. Doch als Philosoph entdeckt man kein fremdes Wunderland, man sieht allenfalls die bekannte Welt klarer, zum Beispiel, indem man lernt, dass die Metaphern des «Vorhangs» und der «verborgenen Weisheiten» aus Platons Ideenlehre stammen, einer einflussreichen, aber unhaltbaren Theorie des Wissens. Tatsächlich ist da keine verborgene zweite Welt. Die Wirklichkeit ist das eigentliche Wunderland.
Gute Philosophen streben in ihren Texten nach einem Ideal von Klarheit und Verständlichkeit. Dafür setzen sie ihre sauber geputzten Begriffsbrillen auf. Manchmal gehen sie mit der Lupe ganz nah ran. Und manchmal arbeiten sie mit dem Weitwinkelobjektiv, um die großen Zusammenhänge in den Blick zu nehmen.
Dabei dürfen die begrifflichen Linsen den Blick nicht trüben. Viele nämlich, die sich intensiver mit einem Denker beschäftigen, fühlen sich nicht nur in dessen Vokabular und Gedankengängen heimisch, sondern nehmen auch immer nur eine Perspektive ein. Durch Nietzsches Sonnenbrille beispielsweise sieht die Welt düster aus, und mit Freuds pinker Brille auf der Nase entdeckt man überall Rosiges. Dieser Versuchung muss man widerstehen. Dann darf man auch sehenden Auges Bewegungsmetaphern für das Denken und visuelle Metaphern für das Wissen verwenden.
Die Philosophie beginne mit dem Staunen, sagt Aristoteles, oder gar mit einem kindlichen Staunen, wie viele behaupten. Das stimmt allerdings nur, wenn man mit «Philosophie» wie die antiken Griechen «Wissenschaft» meint. Kinder sind von klein auf Forscher und bleiben es ein Leben lang, wenn es ihnen nicht abgewöhnt wird. Aber sie sind noch keine Philosophen. Die kindliche Neugierde ist eine naturwissenschaftliche. Kinder wollen wissen, wie die Welt funktioniert: Löffel fallen lassen, Geräusch, Löffel fallen lassen, Geräusch. Sie fragen, warum es dunkel wird oder wo der Wind ist, wenn er nicht weht, lange bevor sie wissen wollen, ob Gott existiert oder was Gerechtigkeit ist.
Während die Naturwissenschaft typischerweise Warum-Fragen beantwortet wie «Warum fällt der Stein zu Boden?», «Warum teilen sich die Zellen?» oder «Warum gefriert Wasser?», stellt die Philosophie die dazu passenden Was-Fragen: Was ist Verursachung? Was ist Leben? Was ist ein Naturgesetz? An der Form der Was-Frage allein kann man die Philosophie natürlich noch nicht erkennen, aber am Ziel: Philosophen fragen nach dem Wesen der Dinge.
Die Philosophie im heutigen Sinn ist eine Wissenschaft der Begriffe, also der Kategorien des Denkens, und zwar derjenigen, die so grundlegend und allgemein sind, dass wir ohne sie überhaupt nichts verstehen würden: Raum und Zeit, Sprache, Vernunft, Bedeutung, Wahrheit, Wissen, Verursachung, Objekt, Ereignis, Bewusstsein, Gut und Böse, Wahrnehmung, Handlung, Gefühl, Mensch, Gerechtigkeit, Schönheit.
Naturwissenschaftler wollen wie Kinder wissen, warum etwas passiert. Philosophen hingegen gehen in ihrer Neugier dem Alltäglichen, schon Bekannten auf den Grund. Sie suchen das Mysterium im Selbstverständlichen. Sie fragen, wie die grundlegendsten Begriffe zusammenhängen: Kann die Zeit auch vergehen, wenn es kein Universum gibt? Muss man Vernunft haben, um sprechen zu können? Können Schmerzen oder Gefühle auch unbewusst auftreten?
Natur- und Humanwissenschaftler wenden ihre Theorien auf Daten aus Versuchen und Beobachtungen an. Philosophen führen auch Versuche durch. Allerdings sind das Gedankenexperimente, für die man keine Apparaturen braucht. Den sauberen Unterschied zwischen Daten und Theorie gibt es in der Philosophie nicht: Jeder philosophische Gedanke oder Text kann wiederum Gegenstand eigener philosophischer Gedanken sein.
So begibt sich schon jeder Philosophiestudent auf Augenhöhe mit den großen Denkern der Geschichte. Das geht nur, weil wir Spätgeborenen Zwerge auf den Schultern dieser Riesen sind, wie der mittelalterliche Philosoph Bernhard von Chartres sagt. Der Weg hinauf ist manchmal mühsam, aber von oben hat man einen fast unbeschreiblichen Ausblick. Oft kann man weiter sehen als die Riesen selbst. Man darf nur nicht vergessen, dass man ohne sie niemals so weit oben sitzen würde. Und man darf den langen Schatten des Riesen nicht mit der eigenen Größe verwechseln.
Der Titel «Philosoph» ist keine geschützte Berufsbezeichnung, so wenig wie «Detektiv», «Designer» oder «Journalist». Jeder kann ihn als Beinamen auf seine Visitenkarte schreiben. Diese Titelinflation irritiert einige seriöse Philosophen in der Wissenschaft genauso wie ausgebildete Journalisten oder diplomierte Abgänger von Kunstschulen. Aber man kann da großzügig sein: Wir sind alle Philosophen, so, wie wir alle Psychologen sind oder Fußballtrainer vor dem Fernsehschirm. Wie unter Fußballtrainern gibt es auch unter Philosophen gute und schlechte. Die guten arbeiten nach hohen wissenschaftlichen Standards. Sie schreiben klar und verständlich, argumentieren genau und wollen zum wissenschaftlichen Fortschritt beitragen.
Diesem Ideal verpflichtet sich unter anderem die Analytische Philosophie, die stark von der angloamerikanischen Forschung beeinflusst ist und der auch ich mich zuordne. Wie jedes Handwerk ist die Philosophie ein Kennen und Können: Man muss mit den Inhalten und den Methoden vertraut sein. Das Markenzeichen Analytischer Philosophen ist ihre Methode. Sie streben danach, sich so einfach wie möglich auszudrücken und Fachwörter nur dort zu verwenden, wo es nötig ist. Sie begründen ihre Argumente, wollen Probleme lösen, sind in der Logik geschult und bringen ihre Thesen präzise auf den Punkt. In der Analytischen Philosophie gibt es keinen falschen Respekt vor Autoritäten. Bei einem guten Argument ist es ganz gleich, von wem es stammt: von Aristoteles, Bertrand Russell oder einem Schüler aus der Oberstufe.
Analytische Philosophen schreiben mit einem unsichtbaren Augenzwinkern: Sie nehmen die fachlichen Fragen sehr, sich selbst aber nicht so ernst. Sie kultivieren keinen individuellen Jargon, um sich sozial abzugrenzen, sondern begreifen sich als Mitglieder eines Forschungsprojektes, zu dem jeder etwas beisteuert. Sie fassen es als Stärke auf, angreifbar zu sein, statt sich durch Unverständlichkeit gegen Kritik zu immunisieren. Sie denken gründlich nach und fragen sich, wie die Ergebnisse aller Wissenschaften zusammenpassen. Analytische Philosophen sehen ihre Aufgabe darin, die Redeweisen und Gedankengänge des Alltags und der Wissenschaften zu präzisieren.
In den Anfängen, vor etwa 100 Jahren, haben sich Analytische Philosophen vor allem auf die Sprachphilosophie und die Wissenschaftstheorie konzentriert. Heute diskutieren sie alle Themen, sei es aus der Ethik, Ästhetik, Kultur, Religion oder Politik.
Die philosophische Landschaft ist dichter bevölkert als jemals zuvor. Dafür hat die Landkarte auch einen feineren Maßstab bekommen, da viele Positionen früher gar nicht besetzt waren. In diesem Buch versuche ich, vor allem originelle Denker zu Wort kommen zu lassen, sei es aus der Philosophie oder aus angrenzenden Disziplinen wie Psychologie, Soziologie, Anthropologie und den Neurowissenschaften.
Dem Ideal von Klarheit und Genauigkeit der wissenschaftlichen Philosophie folgen nicht alle. Im Gegenteil: Viele Philosophen haben sich weit davon entfernt. Auf drei Prototypen trifft man immer wieder.
Da sind zum einen die Micky-Maus-Philosophen, wie der amerikanische Philosoph John Searle sie nennt. Sie haben eine Vorliebe für steile Thesen: Es gibt keine Wahrheit, wir haben keine Willensfreiheit, Gefühle sind nichts als Hirnzustände. Anders als seriöse Philosophen jedoch machen sich Micky-Maus-Philosophen nicht die Mühe, für ihre Behauptungen zu argumentieren. Sie kennen die Forschungsliteratur nicht und leiten ihre Schlüsse aus halbverstandenen Theorien ab. Statt gründlich nachzudenken, wollen sie lieber unser «Weltbild» revolutionieren. Meist können sie jedoch nicht einmal sagen, was sie damit überhaupt meinen.
Manchmal sind sogar Neurowissenschaftler oder Physiker unter ihnen, besonders jene, die in ihrem eigenen Fach Erfolg hatten, gleichzeitig aber verkennen, dass andere Wissenschaften auf einem ebenso hohen Niveau arbeiten. Sie glauben in Experimenten Antworten auf Fragen zu finden, die sie schon von vornherein falsch gestellt haben. Statt dem weißen Kaninchen zu folgen, schießen einige Micky-Maus-Philosophen mit Kanonen auf Spatzen in einem Wald, den sie vor lauter Bäumen nicht sehen.
Der zweite Typ sind die Rotweinphilosophen, die bei einem guten Glas Bordeaux einfach so drauflos reden oder schreiben. Viele sind sehr gebildet und gute Stilisten, die ungewöhnliche Metaphern am Fließband produzieren. Aber sie stellen ihr Sprachtalent nicht in den Dienst der Sache. Sie interessieren sich ebenfalls nicht für den Forschungsstand, durchdenken ihre Thesen nicht systematisch, schreiben assoziativ und stellen Fragen, wenn sie nicht weiterwissen. Unter ihnen sind oft Publizisten, die die «Schulphilosophie» angreifen, manchmal vielleicht, weil ihnen die Anerkennung der Fachwelt verwehrt blieb. Sie wirken für Laien gelehrt, weil sie immer ein passendes Zitat zur Hand haben und ihre Einzelbeobachtungen geschickt als große Thesen verkaufen. Die Rotweinphilosophen sind an ihrem Stil und ihrer Inszenierung erkennbar, aber nicht an den Inhalten. Viele ihrer Texte lesen sich schön, aber am Ende weiß man nicht mehr als zuvor, sondern eher weniger.
Den dritten Typ stellen die Heißluftballon-Philosophen dar. Vor allem französische Kulturwissenschaftler haben Sinnestäuschungen im Alltag, Mehrdeutigkeiten in Texten oder Machtspiele in der Wissenschaft entdeckt und kühn daraus geschlossen, dass die Welt nur eine Konstruktion sei, unsere Worte unendlich viele Bedeutungen haben und dass es keine methodische Wahrheitssuche geben könne. Der amerikanische Philosoph Jerry Fodor hat einmal gesagt, das sei so, als würde man sich bei Kopfschmerzen den Kopf abhacken, statt ein Aspirin zu nehmen. Wie die Micky-Maus-Philosophen lieben sie provokante und radikale Thesen, haben daraus allerdings methodische Konsequenzen gezogen: Sie wollen nicht mehr wissenschaftlich arbeiten, klar und widerspruchsfrei schreiben oder für ihre Behauptungen argumentieren, sondern nur Literatur machen. Dafür blasen sie ihre Thesen auf. Im Höhenflug, wenn die Luft ganz dünn wird, verwechseln sie dann ihre Halluzinationen mit echten Einsichten. Den Mangel an Sauerstoff machen auch sie wie die Rotweinphilosophen mit metaphorischem Süßstoff wett.
Weil es nicht um die Wahrheit geht, zählt in diesen Kreisen die Währung der Aufmerksamkeit mehr als anderswo: Sie müssen lauter schreien, um sich Gehör zu verschaffen, weil alle Themen nur Moden sind, die wie die Ballons schnell vom Winde verweht werden. Die Heißluftballon-Philosophen sammeln kein echtes Lehrwissen an, dafür grenzen sie sich durch ihre Wortwahl ab. Sie folgen nicht dem weißen Kaninchen, sondern ziehen es vor, im Land der Blinden als Kurzsichtige die Fremdenführer zu spielen.
Dagegen verorten sich unter anderem Analytische Philosophen im Idealfall in der Mitte eines Dreiecks mit den Eckpunkten: Text, Natur und Kultur. Sie kennen die einschlägigen Schriften genau, um nicht alte Debatten zu wiederholen. Sie verschaffen sich außerdem einen Überblick über die empirische Forschung, denn sie können nicht wie früher in ihrem sprichwörtlichen Lehnsessel versinken, bis nur noch der Kopf herausschaut, sondern müssen am runden Tisch auf die unbequemen Fragen der anderen Wissenschaften antworten. Wie die Kulturwissenschaftler schließlich sensibilisieren sich Analytische Philosophen für Moden und Machtspiele, für die soziale und kulturelle Dimension ihres Faches, ohne dafür jedoch die Genauigkeit, den Realismus und die wissenschaftliche Methode zu opfern.
Keine Wissenschaft ist so vielen Vorurteilen ausgesetzt wie die Philosophie. Manche glauben, Philosophie sei hauptsächlich Textkunde, also die Auslegung alter Schriften. Ihnen reicht es, wenn sie einen Gedanken geistesgeschichtlich einordnen können. Doch Philosophie beginnt erst dort, wo man sich fragt, ob eine Behauptung gut begründet ist.
Andere finden blumige Kalendersprüche besonders philosophisch, vor allem, wenn sie Begriffe wie «Freiheit» oder «Sinn» enthalten. Auch hier beginnt die Philosophie erst, wenn der Aphoristiker erklärt, was er mit seinem Ausspruch eigentlich meint.
Manche halten sich selbst für Philosophen, weil sie alles anzweifeln. Ganz gleich, was man sagt, sofort kommt ein «Woher willst du das wissen?». Dieser reflexartige Skeptizismus ist die Karikatur wissenschaftlicher Skepsis. Er verwechselt gesichertes Wissen mit Unfehlbarkeit. Ironischerweise kann man philosophisch zeigen, dass es unmöglich ist, alles gleichzeitig in Frage zu stellen.
Verwandt mit dem Zweifel ist die Kritik. So nehmen viele an, zu großen gesellschaftlichen Fragen müssten gerade Philosophen Stellung beziehen, weil sie besonders qualifiziert seien. Doch erstens kann sich jeder zu drängenden Themen ein kompetentes Urteil bilden. Und zweitens hat auch jeder die Pflicht, Missstände und Ungerechtigkeiten anzuprangern und zu beheben. Eine philosophische Ausbildung mag dabei helfen. Sie ist aber nicht der Königsweg zur politischen Mündigkeit.
Philosophen sind auch nicht von Haus aus Lebensberater, die uns sagen können, wie wir ein glückliches und erfülltes Leben führen, auch wenn einige in dieser Branche ihr Glück versuchen.
Und schließlich ist die Philosophie nicht an ihrem «Ende» angekommen und wurde auch nicht durch die anderen Wissenschaften ersetzt. Der englische Philosoph John L. Austin verglich die Philosophie einmal mit der Sonne, die nach und nach die Einzelwissenschaften ausgeworfen habe, die dann zu Planeten erkalteten. Manche gehen weiter: Die Sonne habe aufgehört zu strahlen, und nur noch die Planeten seien übrig geblieben.
Das ist ein ansprechendes Bild, doch leider ist es schief. Aristoteles beispielsweise hat danach gefragt, was ein Wesen lebendig macht oder warum wir träumen. Das waren empirische Probleme: Aristoteles war eben auch Naturwissenschaftler, selbst wenn es dafür noch keine eigene Bezeichnung gab. Er diskutierte aber vor allem echte philosophische Fragen, zum Beispiel nach der Natur der Zeit oder der Verursachung. Das hat sich bis heute nicht geändert. Zwei Beispiele: Physiker formulieren Naturgesetze, aber was ein Naturgesetz ist, gehört nicht zu den Fragen der Naturwissenschaft. Und Psychologen erklären unser Verhalten, aber sie fragen sich selten, was eine gute psychologische Erklärung ausmacht. Wenn sie es tun, dann betreiben sie Philosophie.
Wer auf einer Party zugibt, dass er Philosophie studiert oder gar unterrichtet, steht immer wieder einer Mischung aus Bewunderung und Befremden gegenüber. Manchmal überwiegt die Bewunderung, weil man die großen Rätsel der Menschheit in Angriff nimmt, manchmal das Befremden, weil man sich mit so wahnsinnig lebensfernen Themen befasst.
Darauf folgen immer die gleichen Fragen, zum Beispiel: «Wer ist dein Lieblingsphilosoph?», als seien Philosophen Schriftsteller, Schauspieler oder Regisseure. Die einzig passende Antwort ist «Woody Allen», denn der ist alles gleichzeitig.
Die zweite typische Frage lautet: «Warum Philosophie?» Ganz ehrlich: Das frage ich mich auch jeden Tag. Fodor hat eine gute Antwort. Er sagt: Die Bezahlung ist schlecht, der Fortschritt ist langsam, aber man lernt spannende Leute kennen.
Die dritte typische Frage ist oft von einem besorgten Blick begleitet: «Und was macht man damit?» Ich war viele Jahre Studienberater am Philosophischen Institut. Zuerst habe ich immer meinen Standardsatz aufgesagt: Philosophen arbeiten in Verlagen, in den Medien, in der Politik und in der Unternehmensberatung. Dann habe ich gemerkt, dass es wirkungsvoller ist, Absolventen der Philosophie aufzuzählen, die etwas aus ihrem Leben gemacht haben: Bruce Lee, Martin Luther King, Papst Benedikt XVI.
Wittgenstein, der immer eine starke Metapher aus dem Ärmel schütteln konnte, sagt, die Philosophie sei ein «Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache». Heute sind Philosophen Ärzte ohne theoretische Grenzen, die nicht nur Sprachverwirrungen therapieren, sondern Unsinn in allen Lebenslagen entlarven. Sie arbeiten mit einem Wahrheits-Detektor, der Alarm schlägt bei den Worthülsen der Politik, der Propaganda der Werbung, den Klischees des Kinos und den Fehlschlüssen in Fernsehsendungen und Zeitungsberichten.
Trotzdem ist die These weit verbreitet, die Philosophie erfülle keine gesellschaftliche Funktion. Philosophen haben selbst zu diesem Vorurteil beigetragen. Georg Wilhelm Friedrich Hegel meint, die Philosophie käme immer zu spät, nämlich dann, wenn schon nichts mehr zu ändern sei: Die «Eule der Minerva», also die allegorische Weisheit, beginne erst «mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug». Das weiße Kaninchen jedenfalls ist schon im Morgengrauen wach und schlägt bei Sonnenaufgang seine Haken.
Fühlen Die Vernunft des Bauches
Wir können nicht mehr zusammen sein, sagte sie. Ich verstand überhaupt nichts. Dann weinte sie, und plötzlich verstand ich alles. Ich erschrak. Ich wollte auch weinen, doch ich konnte nicht. Ich war sprachlos … Mir ging es schlecht, doch es fällt mir schwer, genau zu beschreiben, wie sich das anfühlte. Es war kein Schlag in die Magengrube. Aber irgendwo im Brustkorb spürte ich ein flaues Ziehen, als ob der Herzschlag für einen Augenblick aussetzt. Zuerst hoffte ich, dass sie nur einen Scherz machte, obwohl ich längst wusste, dass es keiner war. Dann wurde ich wütend. Was findet sie an dem anderen?
Therapeuten sagen, bei einem Verlust ginge man durch mehrere Phasen: Schock, Verneinung, Wut, Traurigkeit und Akzeptanz. Die letzte Phase kam nie. Am Ende blieb nur die Sehnsucht: nach ihrem Duft, ihren neugierigen Augen, ihrer Wärme. Ich war verletzt, enttäuscht und eifersüchtig: Der andere würde sie jetzt küssen.
Es gibt kein typisches Gefühl des Verlassenwerdens, aber viele Gefühle, die es auslöst: Erschrecken, Angst, Eifersucht, Enttäuschung, Sehnsucht und vor allem Traurigkeit. Unsere Gefühle packen uns schnell und unmittelbar, wir erleben sie oft heftig, und sie sind typischerweise von kurzer Dauer: Nur selten halten Wut und Freude auch lange an. Gefühle sind außerdem Widerfahrnisse: Wir können sie normalerweise nicht willentlich hervorrufen oder abschalten, sondern sie stoßen uns zu. In alten Texten heißen sie deshalb auch «Leidenschaften», weil wir sie im alten Sinne des Wortes passiv «erleiden». Natürlich lernen wir, mit unseren Gefühlen umzugehen. Wir können tief durchatmen und uns beruhigen, wenn wir die Wut in uns aufsteigen spüren, und wir können uns klarmachen, dass unsere Angst unbegründet ist. Aber das ungewollte Element bleibt. Selbst der Schauspieler, der sich vor der Kamera seine schmerzlichen Erlebnisse so in Erinnerung rufen kann, dass er wirklich traurig wird, ist in diesem Gefühl dann gefangen.
Gefühle sind seit etwa zwanzig Jahren eines der meistdiskutierten Themen in der Neurologie, Psychologie und in der Philosophie. Die wissenschaftliche Begeisterung für Gefühle entbrannte erstaunlich spät, wenn man bedenkt, wie sehr sie unser Leben bestimmen. Viele Forscher sprechen von «Emotionen» statt von «Gefühlen». Ich verwende diese Ausdrücke gleichbedeutend. Oft ist allerdings eine sprachliche Genauigkeit wichtig, weil wir uns im Deutschen mit dem Wort «Fühlen» auf mindestens drei unterschiedliche Erlebnisse beziehen: Wir fühlen die Wut in uns aufsteigen, wir fühlen uns manchmal niedergeschlagen, und wir fühlen den Grashalm an der Nasenspitze. Wut ist ein Gefühl im Sinne einer Emotion, Niedergeschlagensein ist eine Stimmung, und das Kitzeln ist eine einfache Körperempfindung.
Während wir Empfindungen wie Kitzeln, Hunger oder Schmerz direkt am Körper spüren, sind Stimmungen und Gefühle komplexer: zwar allgegenwärtig, aber schwer zu fassen. Stimmungen wie Unbehagen oder Gereiztheit unterscheidet man traditionell von Gefühlen, denn Gefühle haben einen direkten Bezug zu ihrer Ursache: Wir sind eifersüchtig auf andere oder freuen uns über die Sonnenblumen. Man kann nicht einfach so eifersüchtig sein oder sich einfach so ärgern. Bei Stimmungen ist das anders: Wir können den ganzen Tag niedergeschlagen oder nach dem Sport beschwingt sein, ohne dass uns die Ursache präsent ist.
Stellen Sie sich vor, der schlechterzogene Dobermann des Nachbarn steht plötzlich ohne seinen Maulkorb knurrend vor Ihnen. Dann werden Sie das vermutlich typischste aller Gefühle erleben: Angst. Einige Philosophen konstruieren zwischen den Wörtern «Angst» und «Furcht» einen künstlichen Unterschied, aber in unserer Alltagssprache gibt es keinen, allenfalls dass «Furcht» etwas altertümlich klingt. Angst hat wie alle anderen Gefühle mindestens fünf typische Eigenschaften. Erstens den erwähnten Bezug: Man hat immer Angst vor etwas, zum Beispiel vor dem Hund. Zweitens eine automatische Einschätzung der Situation: Die Angst lässt den Hund gefährlich erscheinen. Drittens ein Erleben: Angst empfinden wir anders als etwa Zorn oder Freude. Viertens einen spezifischen Gesichtsausdruck: Unsere Augen weiten sich, die Lippen strecken sich geradlinig zu den Ohren, und das Kinn wandert zum Hals. Fünftens eine Handlungsvorbereitung: Adrenalin flutet das Hirn und erhöht unsere Aufmerksamkeit, Blut fließt in die Beine und bereitet uns auf die Flucht vor, und natürlich entsteht in uns auch der Drang, tatsächlich wegzulaufen.
Wer Angst und andere Gefühle mit einer Theorie erklären will, muss zwei wichtige Fragen beantworten. Erstens: «Was ist wesentlich für Gefühle?» Wesentlich ist ein Merkmal dann, wenn es nicht fehlen darf. Denken wir noch einmal an den Dobermann: Damit ein Tier ein Hund ist, muss es ein bestimmtes Genom haben. Das Genom ist für das Hundsein wesentlich. Die Anzahl der Beine ist nicht wesentlich: Ein dreibeiniger Hund ist immer noch ein Hund. Die Farbe des Fells ist auch nicht wesentlich. Man kann zum Beispiel einen Pudel rosa färben. Damit nimmt man dem Pudel nicht seinen Kern.
Auf Gefühle bezogen, lautet die Frage also: Welche der fünf Charakteristika dürfen nicht fehlen, damit ein Zustand ein Gefühl ist? Als sich meine Freundin von mir getrennt hat, war ich traurig. Was ist wesentlich für dieses Erlebnis? Die Körpertheorien sagen: Wesentlich ist eine Form von Körpererleben. Keine Traurigkeit ohne Tränen oder einen Kloß im Hals. Die kognitiven Theorien, also die Gedankentheorien, sagen: Gefühle haben immer etwas mit einer Interpretation oder Beurteilung zu tun. Keine Traurigkeit ohne das Wissen, dass man etwas verloren hat, zum Beispiel eine Partnerschaft oder auch die Großeltern. Die Mischtheorien sagen: Gefühle sind aus mehreren Elementen zusammengesetzt. Man kann Gefühlstheorien gut in diese drei Gruppen einteilen.
Die zweite Frage lautet: «Welche Funktion haben Gefühle?» Bei Angst scheint die Funktion offensichtlich zu sein: Vorbereitung und Motivation zur Flucht. Bei meiner Traurigkeit war das nicht so offensichtlich. Sie hat mich gelähmt, aber es ist schwer zu sagen, ob sie mich dadurch auf etwas vorbereitet hat.
Doch zuerst zu den Theorien: Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, beobachtete um 1870, dass Affen bei Überraschung die Brauen hochziehen und die Augen aufreißen. Dadurch vergrößert sich ihr Sichtfeld, sodass sie besser auf Beute oder Gefahr reagieren können. Ein klarer Überlebensvorteil. Wenn Katzen Angst haben, machen sie einen Buckel. Dadurch erscheinen sie größer. Auch das kann in der Evolution ein Vorteil gewesen sein, denn es mag Angreifer abgeschreckt haben. Nun könnte man meinen, dass Darwin auch die menschlichen Emotionen untersucht hat. Immerhin haben wir die gleichen wie andere Säugetiere und noch einige, die bei Tieren nicht vorkommen, zum Beispiel Scham oder Neid. Überraschenderweise hielt er den Ausdruck menschlicher Gefühle jedoch weitgehend für funktionslose Überbleibsel der Evolution. Eine Gefühlstheorie für Menschen entwickelte Darwin nicht. Dennoch kann er als ein früher Körpertheoretiker gelten, denn ihm zufolge sind Gefühle am Körper ablesbare Verhaltensmuster.
Die erste ausgearbeitete Körpertheorie begründeten zwei Wissenschaftler um 1900 unabhängig voneinander, nämlich der amerikanische Psychologe William James und sein dänischer Kollege Carl Georg Lange. Der James-Lange-Theorie zufolge sind Gefühle Wahrnehmungen von Körpervorgängen. Das klingt zunächst wenig überraschend, hat aber eine paradoxe Pointe: Laut James zittern wir nicht, weil wir Angst haben, sondern wir haben Angst, weil wir zittern. Wir weinen nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen. Die Wahrnehmung der Körpervorgänge geht dem Gefühl nicht voran, sondern die Wahrnehmung ist das Gefühl. James lädt uns zu einem Gedankenexperiment ein: Wenn man alle Körpererlebnisse von der Angst wegnähme, bliebe nur ein blasser Gedankenrest übrig, der nichts mit dem Gefühl zu tun hat. Ein einfaches psychologisches Experiment scheint diesen Ansatz zu belegen. Setzen Sie sich einmal hin, und verziehen Sie Ihr Gesicht zu einem Lachen. Nach einiger Zeit werden Sie dann wirklich fröhlich. Inzwischen gibt es Seminare für Lach-Yoga, in denen die Teilnehmer den schmunzelnden Löwen oder den kichernden Pinguin imitieren und am Ende freudestrahlend nach Hause gehen. Diesen Effekt kann man so auslegen, als sei Freude nichts anderes als die Wahrnehmung der veränderten Gesichtsmuskulatur.
Dennoch hat die Theorie einen Haken: Sie sagt voraus, dass ein vermindertes Körpererleben zu einem verminderten Gefühlserleben führt. Sie ist also widerlegt, wenn Menschen ohne Körperempfindungen dennoch Gefühle haben. Dieses Problem hat schon James gesehen. Einige Querschnittsgelähmte klagen zwar, dass ihr emotionales Leben nach den Unfällen ärmer geworden sei. Aber das gilt nicht für alle. Ein eindrückliches Gegenbeispiel stellt der Journalist Jean-Dominique Bauby dar, ehemals Chefredakteur der französischen Zeitschrift Elle, der nach einem Schlaganfall am Locked-In-Syndrom litt. Bis auf sein linkes Augenlid konnte er seinen Körper nicht mehr bewegen. Daher musste er lernen, nur durch Blinzeln Buchstaben aus einer Reihe auszuwählen, die ihm seine Therapeutin hinhielt. Die Buchstaben waren nach Häufigkeit geordnet. Einmal blinzeln hieß «ja», zweimal «nein». Seite für Seite diktierte Bauby so das Buch Schmetterling und Taucherglocke, das der amerikanische Regisseur Julian Schnabel im Jahr 2007 verfilmt hat. In dem Buch spricht Bauby über sein Leben vor und nach dem Schlaganfall. Und über sein fast gänzlich ausgelöschtes Körpergefühl: Er spürt nichts als einen konstanten Druck von Kopf bis Fuß, so als sei er in einer alten Taucherglocke gefangen. Bauby ist todtraurig und doch voller Hoffnung, wieder zu genesen. Er ist stolz, als er sieht, wie sein Sohn und seine Tochter heranwachsen. Das erzählt Bauby mit wenigen Worten, aber doch so eindringlich, dass es einen berührt. Wer die James-Lange-Theorie verteidigen will, müsste behaupten, dass er sich all diese Gefühle nur einbildet, denn er hat ja keine Körperwahrnehmung mehr. Doch das ist schwer vorstellbar. Vor allem: Könnten wir uns überhaupt ein Gefühl einbilden, ohne es auch gleichzeitig zu haben?
Der portugiesisch-amerikanische Neurowissenschaftler Antonio Damasio hat sich von der James-Lange-Theorie inspirieren lassen. Damasio vertritt eine moderne Körpertheorie. Er unterscheidet zwischen Gefühl (emotion) und Gefühlserleben (feeling). Seine Pointe ist: Gefühle regulieren unser Verhalten, auch wenn wir sie nicht immer bewusst erleben. Das klingt zunächst eigenartig, immerhin steckt im Wort «Gefühl» schon das «Fühlen». Wie kann ein Gefühl nicht gefühlt sein? Passenderweise findet sich im alternativen Ausdruck «Emotion» das lateinische Wort «motio» für «Bewegung» und «Antrieb». Das sagt zwar noch nichts über die Natur der Gefühle, aber Damasio geht es genau um diesen zweiten Aspekt. Er glaubt, dass Gefühle uns auch dann antreiben, wenn wir sie nicht fühlen. Dafür sprechen seiner Meinung nach Experimente der Neurowissenschaft und Psychologie.
Ein Beispiel: Zeigt man Versuchspersonen das Bild einer Spinne für 50 Millisekunden, also nur eine Zwanzigstelsekunde, und gleich darauf das neutrale Bild eines Wohnhauses, so nehmen sie nur das Haus bewusst wahr. Niemand berichtet, dass er eine Spinne gesehen habe. Das zweite Bild «maskiert» das erste, daher heißen diese Versuche Masking-Experimente. Dennoch schlägt bei den Versuchspersonen sofort das Herz schneller, und Schweiß bildet sich an den Fingerspitzen: zwei typische Anzeichen für Angst, die fast so deutlich ausfallen, als hätten die Probanden die Spinne bewusst gesehen. Mehr noch: Die Versuchspersonen merken manchmal gar nicht, dass sie sich in diesem unruhigen Zustand befinden. Angst ist Damasio zufolge Teil unseres eingebauten emotionalen Alarmsystems, denn sie bereitet uns aufs Fliehen vor. Dieses System funktioniert auch dann, wenn wir die Alarmglocke gar nicht hören. Es ist, als ob unser Körper für uns reagiert, so, wie wir instinktartig zurückschrecken, wenn etwas großes Dunkles auf uns zukommt.
Damasios Kollege Joseph LeDoux konnte diese These neurologisch belegen: Im Hirn gibt es einen kurzen und einen langen Schaltkreis für Angst. Der kurze Schaltkreis reagiert unmittelbar und ohne unser Bewusstsein, ist aber auch fehleranfällig und löst oft falschen Alarm aus. Die zweite Verbindung läuft über Großhirnareale, die erst spät in der Evolution entstanden sind. Diese langsame Bahn ist zuverlässiger, und sie ist es, die unseren bewussten Urteilen zugrunde liegt. Darüber können wir auch die Informationen der anderen Verbindung stoppen. Wir erschrecken vor der Riesenspinne, merken dann aber, dass es nur ein Scherzartikel aus Gummi ist, und beruhigen uns schnell wieder. Manchmal ist diese bewusste Korrektur allerdings gestört. Menschen mit einer Spinnenphobie beispielsweise fürchten sich auch vor Attrappen, selbst wenn sie wissen, dass diese ungefährlich sind. Der kurze Schaltkreis ist bei ihnen offenbar so fest verdrahtet, dass sie nicht umschalten können.
Damasios und LeDoux’ wichtige Entdeckung lautet: Gefühle können auch unbewusst auftreten und unser Handeln beeinflussen. Bewusste Gefühle sind demnach ein Sonderfall: nicht Körperwahrnehmungen wie bei James, sondern eher so etwas wie höherstufige Abbildungen von Körpervorgängen, genauer von Hirnprozessen. Von diesen Abbildungen bekommen wir Damasio zufolge im Bewusstsein nichts mit außer eben dem warmen Erleben der Freude oder dem brodelnden Erleben der Wut.
Allerdings bleibt offen, warum wir Gefühle so oft bewusst fühlen, wenn sie ihre Funktion auch jenseits des Bewusstseins erfüllen können. Es kann ja kein Zufall sein, dass wir Angst als unangenehm erleben und sie deshalb vermeiden wollen. Außerdem scheint Angst mehr als bloß ein automatischer Fluchtmechanismus zu sein.
Wenn wir uns ängstigen, dann haben wir auch Gedanken: Wir halten den zähnefletschenden Dobermann des Nachbarn für gefährlich. Auf diesen Aspekt zielen die kognitiven Theorien, denen zufolge Gefühle eine Form von Gedanken sind, nämlich Einschätzungen oder Beurteilungen. Viele kognitive Theoretiker geben zu, dass manchmal Gefühle auch etwas mit Fühlen zu tun haben, aber dieser Zusammenhang sei eher zufällig.
Das behauptet zum Beispiel die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum. Wie könnte man von «Angst» sprechen, fragt sie, wenn es nicht eine Angst vor dem Dobermann ist, wie von Trauer, wenn es nicht die Trauer über den Tod des Großvaters ist? Damit Angst und Trauer diesen Bezug haben, müssen sie für Nussbaum Einschätzungen oder Urteile beinhalten. Nussbaum dreht James’ Frage einfach um: Was bliebe von einer Wut übrig, wenn man alle Gedanken und Einschätzungen wegnähme? Laut Nussbaum nichts als ein undefinierbares Körpererleben, das nicht einmal bei allen Menschen gleich sei. Amerikanische Männer würden Wut eher als brodelnd empfinden, während die Frauen sie eher als eine Anspannung im Nacken spürten. Das könnte kulturelle Gründe haben: In der amerikanischen Mittelschicht dürfen Männer ihre Wut herauslassen, während man von Frauen erwartet, dass sie sich kontrollieren. Für Italienerinnen gilt das nicht, wie wir aus Filmen wissen. In jedem Fall zeigt dieser Unterschied laut Nussbaum, dass Gefühle wie Wut keine typische Physiologie haben. Sie seien vielmehr Urteile über das, was in unserem Leben Bedeutung hat oder was unsere Selbstzufriedenheit bestimmt.
Nussbaum ist mit einem Problem konfrontiert: Unsere Gefühle müssten sich ändern, sobald sich unsere Urteile ändern. Doch viele Menschen haben auch dann noch Angst vor Spinnen, wenn sie wissen, dass sie nicht gefährlich sind. Falsche Urteile können wir schnell verwerfen, unsere Gefühle aber nicht. Und oft ist die Angst schon da, bevor wir überhaupt begreifen, wovor wir uns fürchten. Ein überlegtes Urteil kann also nicht wesentlich für die Angst sein.
Vielleicht entstehen die «Urteile» unserer Gefühle aber auch gar nicht aus Überlegungen, sondern ganz automatisch. Wenn uns jemand anrempelt, sind wir sofort wütend, noch bevor uns der Gedanke kommt: Der hätte besser aufpassen können. Dieses Phänomen erklärt der amerikanische Psychologe Richard Lazarus mit seiner Bewertungstheorie, die weniger gedankenlastig ist als Nussbaums Ansatz. Auch Lazarus beginnt mit der Beobachtung, dass wir durch Gefühle Bezug auf unsere Umwelt nehmen. So, wie wir uns durch die Wahrnehmung ein Bild von der Welt machen, so zeigen uns Gefühle wichtige Faktoren für unser Zusammenleben in der Gruppe und für unser Überleben in der Wildnis an. Lazarus nennt diese Faktoren «Kernthemen». Man könnte auch von «grundlegenden Lebensthemen» sprechen. Die Angst vor der Schlange lässt uns nicht einfach nur die Schlange sehen, sondern vielmehr das Kernthema: eine Gefahr in Form der Schlange. Die Angst «bewertet» sozusagen die Schlange als Gefahrenquelle. Diese «Bewertung» darf man sich aber nicht als ein bewusstes Nachdenken vorstellen. Es ist eher ein automatisches und schnelles Einschätzen einer Situation.
Lazarus hat für alle Gefühle die entsprechenden Kernthemen aufgelistet: Traurigkeit zeigt beispielsweise Verlust an, Scham das Überschreiten einer sozialen Norm, Wut eine Beleidigung. So sichern wir unser Überleben, denn wir meiden Gefahr, suchen Schutz, und wir funktionieren in der Gruppe: Wir versuchen, Normen nicht zu überschreiten. Lazarus’ Theorie ist innovativ und passt zu der Beobachtung, dass Gefühle unser Verhalten steuern, auch wenn er selbst die Kernthemen nicht immer genau trifft. Ein Beispiel: Beleidigungen als Auslöser unseres Ärgers sind zu speziell, denn wir ärgern uns auch, wenn der Computer abstürzt. Das Kernthema des Ärgers ist eher: Etwas hindert uns, unser Ziel zu erreichen.
Vor allem bleibt offen, warum wir überhaupt Körpererlebnisse brauchen, wenn die Kernthemen allein ausreichen würden. Es scheint, als hätten sowohl die Körper- als auch die Gedankentheorien Lücken. Haben beide nur zur Hälfte recht? Die Wahrheit liegt in großen Debatten zwar selten in der Mitte, aber oft in einer geschickten Kombination von Gegensätzen. Hier kommen die Mischtheorien ins Spiel. Sie fassen Gefühle als Bündel von Elementen auf.