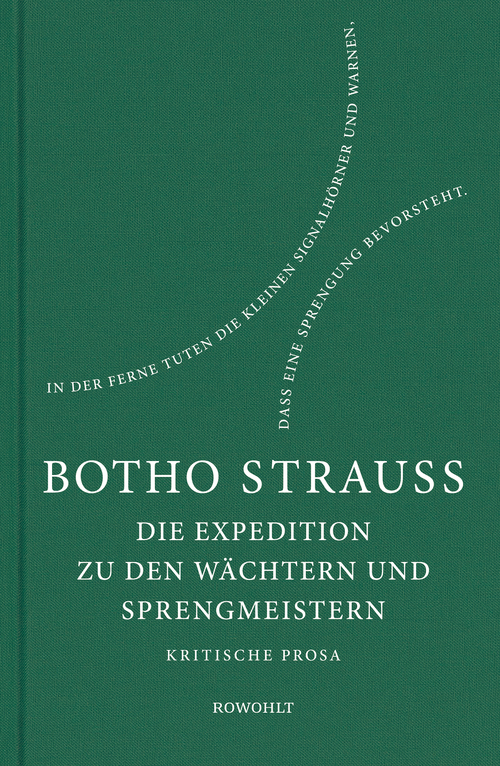
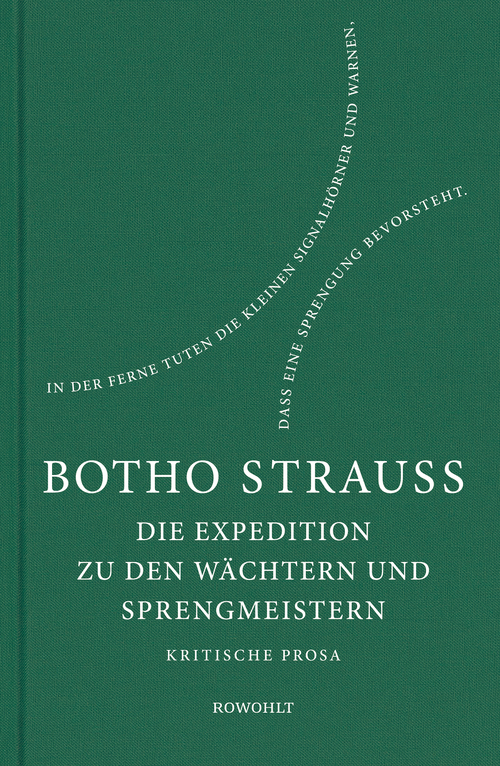
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Frank Ortmann
Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00142-8
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
ISBN 978-3-644-00142-8
1991
The prologues are over. It is a question, now,
Of final belief.
Wallace Stevens, ‹Asides on the Oboe›
Wir haben Reiche stürzen sehen binnen weniger Wochen. Menschen, Orte, Gesinnungen und Doktrinen, von einem Tag auf den anderen aufgegeben, gewandelt, widerrufen. Das Unvorhersehbare hatte sich sein Recht verschafft und zerschnitt das scheinbar undurchdringliche Geflecht von Programmen und Prognosen, Gewöhnungen und Folgerichtigkeiten. Es belehrte alle, daß es der Geschichte sehr wohl beliebt, Sprünge zu machen, ebenso wie der Natur. Obgleich in diesem Zusammenhang keine Partikel häufiger verwendet wurde als das Präfix «wieder», ging es doch am allerwenigsten um Wiederherstellung oder Wiederkehr. Was geschah, besaß vielmehr etwas von jener Ereigniskraft, die man in den biologischen Wissenschaften mit dem Ausdruck «Emergenz» bezeichnet: etwas Neues, etwas, das sich aus bisheriger Erfahrung nicht ableiten ließ, trat plötzlich in Erscheinung und veränderte das «Systemganze», in diesem Fall: die Welt.
Die Revolution, die stattfand, oder eben: die emergence, die Summe von vielerlei Zerfalls-, Druck- und Widerstandsformen, mußte von Anfang an als ein Aufbruch ins Bestehende, in den Westen, gelten, und seine Dynamik wird sich in der Regulierung von Synchronisationen und Nachholbedarf erschöpfen. Doch über das Bewußtsein vieler Betroffener kam der letzte Herbst als ein Trugbrecher und beendete mit bitteren Einsichten einen langen, mehr oder weniger dornigen Dornröschenschlaf. Die letzte Rache des gestürzten totalitären Regimes war denn auch die totale Entlarvung, die negative Offenbarung einer verfehlten, weltlichen Soteriologie: Alles falsch von Anbeginn!
Die westliche Welt hatte vermutlich im Osten seit langem keine überzeugten Gegner mehr. Die uneingeschränkte Konkurrenzlosigkeit ihrer inneren und äußeren Lebensformen könnte sich in Zukunft gegen ihr eigenes Prinzip, ihre antagonistischen Bedürfnisse wenden und dazu führen, daß man die nötige Ersatzspannung zwischen anderen Polen schafft, oder aber, daß Polarität überhaupt nur in metapolitischen Dimensionen neue Bedeutung gewinnt.
Soziale Demokratien brauchen keinen Heilshorizont. Viel eher der einzelne Freie, das aufgerichtete Bewußtsein, wird seiner bedürfen. Viele werden erst lernen müssen, daß vom Reichtum an aufwärts die Not beginnt. Die Not, überzeugt zu sein, ohne Praxis und Lehre einer machtvollen Diesseits-Religion und vor allem: ohne die moralischen Sondervergütungen eines gläubigen Ketzertums. Schließlich erscheint es nicht mehr unmöglich, daß der Zusammenbruch von Weltanschauung auch die Entmischung der weltlichen von den verweltlichten heiligen Dingen vorantreibt und daß aus dieser Scheidung die endliche Säkularisierung des Säkularen einerseits und ein «geläutertes» Erwarten andererseits hervorgehen.
«Was würde geschehen, wenn wir unsere Schulden gegenüber der Theologie und der Metaphysik … bezahlen müßten? Was wäre, wenn die dem Glauben entnommenen Anleihen an Transzendenz, die wir seit Platon und Augustinus hinsichtlich bedeutungserfüllter Formen erhalten haben, fällig würden? Was wäre, wenn wir die Annahme explizit machten und konkretisieren müßten, daß alle ernstzunehmende Kunst und Literatur, und nicht nur die Musik, auf die Nietzsche diesen Begriff anwendet, ein opus metaphysicum ist?»
Die Lektion, die das Unerwartete als geschichtliche «Ankunft» dem skeptisch-verschlafenen Dahinwursteln erteilt hat, ist eine gute Voraussetzung, um sich auf George Steiners Versuch über das Unmittelbare einzulassen, den er in seinem Buch ‹Von realer Gegenwart› (‹Real Presences›) wagt. Ein Wagnis, ja, jetzt noch, ist diese Schrift, da der Autor fast allem, was auf dem Gebiet der ästhetischen Theorie gegenwärtig tonangebend ist, den Rücken kehrt. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Befreiung des Kunstwerks von der Diktatur der sekundären Diskurse, es geht um die Wiederentdeckung nicht seiner Selbst-, sondern seiner theophanen Herrlichkeit, seiner transzendentalen Nachbarschaft.
Nach gutem Brauch stellt die Abhandlung gleich auf der ersten Seite ihre klare Absicht und ihre einzige These vor: Überall, wo in den schönen Künsten die Erfahrung von Sinn gemacht wird, handelt es sich zuletzt um einen zweifellosen und rational nicht erschließbaren Sinn, der von realer Gegenwart, von der Gegenwart des Logos-Gottes zeugt.
Das Unbeweisbare in der Krone jenes Erkenntnisbaums, der durch den Roman, die Skulptur, die Fuge emporwächst, ist Zeugnis Seiner Anwesenheit. Wo kein Arkanum, dort kein Zeugnis, keine Realpräsenz.
In der Feier der Eucharistie wird die Begrenzung, das Ende des Zeichens (und seines Bedeutens) genau festgelegt: der geweihte Priester wandelt Weizenbrot und Rebenwein in die Substanz des Leibs und des Bluts Christi. Damit hört die Substanz der beiden Nahrungselemente auf, und nur ihre äußeren Formen bleiben. Im Gegensatz zur rationalen Sprachtheorie ersetzt das eine (das Zeichen, das Brot) nicht das fehlende andere (den realen Leib), sondern übernimmt seine Andersheit. Dementsprechend müßte es in einer sakralen Poetik heißen: Das Wort Baum ist der Baum, da jedes Wort wesensmäßig Gottes Wort ist und es mithin keinen pneumatischen Unterschied zwischen dem Schöpfer des Worts und dem Schöpfer des Dings geben kann.
Gegenwärtig beim Abendmahl ist der reale Leib des Christus passus (d.i. im Zustand seines Todesopfers) unter der Gestalt des Brots. Das Gedenken im Sinne des Stiftungsbefehls («Solches tuet aber zu meinem Gedächtnis») wird dann zur Feier der Gleichzeitigkeit, es ist nicht gemeint ein Sich-erinnern-an-Etwas.
Pascal wunderte sich, daß jemand nachts schlafen könne, wenn ihm einfiele, daß Christus für ihn am Kreuz gestorben sei. Für Kierkegaard war Christus so gegenwärtig, daß die 2000 Jahre seit seinem Tod wie ungültig daneben schienen. In der hebräischen Tradition führt der rituelle Nachvollzug eines einmaligen historischen Geschehens (die «Wachenacht») den Gläubigen in die Zeitraumvergessenheit: «In jedem Zeitalter ist jeder verpflichtet, sich so anzusehen, als sei er selbst aus Ägypten ausgezogen.»
Der englische Malerdichter David Jones, wie Pound und Eliot Schöpfer eines der großen epischen Gedichte des Jahrhunderts, der ‹Anathémata›, erlebte in jeder Messe Golgatha. Für ihn ist der Mensch ein sakramentales Wesen, ein Zeichensetzer in allen seinen Werken, gleich, ob es sich um die Kunst des Schiffsbaus oder eines walisischen Feenmärchens handelt. Alles, was er schafft, ist Darbringung, Opfergabe. Zuerst geben wir etwas ab, dann einander, dann weiter. Die erste Richtung des Werks ist die vertikale, seine Menhirgestalt. Die ‹Anathémata› sammeln und erbringen in tausend Benennungen und Anrufen Votive einer abendländischen Poiesis. Und der heutige Leser wiederum sammelt diese Benennungen selbst als kostbare Gedächtnisstücke (deren Bedeutung ihm oft nur des Dichters Kommentar erschlüsseln kann). Jedes Opus ist Opfer, alle Dichtkunst die Magd der anámnesis, im ursprünglichen Wortsinn des Alten und Neuen Testaments: «sich vor Gott ein Ereignis der Vergangenheit so in Erinnerung zu bringen oder zu repräsentieren, daß es hier und jetzt wirksam wird». Hierin feiern Gedicht und Eucharistie dasselbe; im Versklang tönt noch der «Brotbrechlaut» (Jones). Die Kunstlehre von der realen Gegenwart oder: die um die Kunst erweiterte Sakramentenlehre ist davon überzeugt, daß das Bildnis des Mädchens nicht ein Mädchen zeigt, sondern daß es das Mädchen ist unter der Gestalt von Farbe und Leinwand.
Diese Auffassung vertrat niemand inständiger und unerbittlicher als der russische Naturwissenschaftler, Philosoph und Priester Pavel Florenskij. In den frühen zwanziger Jahren (während er im übrigen als Elektrotechniker im Dienst der Leninschen Revolution arbeitete, ohne je sein Popengewand abzulegen) verfaßte er seine (damals unveröffentlichten) Betrachtungen zur Kunst der Ikonenmalerei und verteidigte sie gegen jede Idee der bloß abbildlichen oder bedeutungtragenden Darstellung. Die Ikone mit der Gottesmutter ist nicht einmal ein Bild, sondern vielmehr ein Fenster, durch das wir sie selbst erblicken. Der Maler wendet seine ganze Kunst an, um einen Vorhang zu öffnen, die Vision zu ermöglichen. Die Ikone wird mit Licht gemalt, und Licht meint keine Form der Beleuchtung und nicht das Eigenleuchten der Dinge: das Licht gründet überhaupt erst die Dinge, es ist ihre Ursache. (In Steiners Untersuchung entspräche dem die Logos-Quelle der Sprache und aller Kunst.) Die Ikone ist der Ort, wo das Antlitz, das Urlicht hervortritt, es bildet die Grenze zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Schaffen ist hier, wie bei jeder Ästhetik der Anwesenheit, nichts anderes als ein kunstvolles Enthüllen. Es ist daher nicht geistreich, sondern ein Ausdruck von Überwältigtsein und Demut, wenn diese Auffassung ihren lakonischen Schluß in einem ästhetischen Gottesbeweis findet: «Es gibt die Dreifaltigkeit Rublevs, folglich gibt es Gott.»
Obschon Steiner sie nicht erwähnt, gehören Pavel Florenskij und David Jones zu den wichtigsten Bekennern und praktizierenden Gläubigen der Realpräsenz. Ihre Werke entstanden freilich während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in einem für Kunst und Wissenschaft ungewöhnlich fruchtbaren Zeitalter, das gerade auch den Typus des Anachronisten oder Widersachers der Moderne mitbeflügelte und mit gesteigerter Schärfe begabte. Der Sprach- und Literaturwissenschaftler George Steiner hingegen erlebt und reflektiert wie wir alle den Rest, die zweite, die wahrhaft sekundäre Hälfte: die Epoche «nach dem Wort», den Epilog, wie er es nennt. Dieser setzte zwar mit Nietzsches Todesurteil für den Logos-Gott schon früher ein, aber das Imperium der Abschwörung und der Leugnung mit seinen unzähligen radikalen Provinzen und subversiven Satyrspielen des Intellekts konnte sich erst nach Zweitem Weltkrieg und Nazikult, als häßliche Aufklärung des Hassenswerten unbegrenzt entfalten. Das kritisch-soziale Zeitalter war geboren und ließ auf ein schöpferisches zurückblicken. Sein Genius ist laut Steiner der Journalismus. Der Journalismus als die letztlich einzige, die höchststehende kulturelle Leistung der Nachkriegsdemokratie; längst nicht mehr nur als Institution zur Verbreitung von Nachricht und Meinung, sondern als eine umfassende Mentalität des Sekundären, die tief eingedrungen ist in die Literatur, in die Gelehrsamkeit, die Philosophie und nicht zuletzt in den Glauben und seine Ämter.
Um dem Dickicht der Vermittlungen, Moderationen und Interpretationen wenigstens in einem Gedankenspiel zu entfliehen, ruft Steiner zu Beginn seines Buchs eine kleine antiakademische Republik aus, eine erträumte Stadt der Künste, in der es nur Werke und Empfänger, nur Künstler und Amateure geben soll und wo jedes Gerede «über», jeder Kommentar (mit Ausnahme des rein philologischen) verboten ist. In diesen Mauern wird es nun unumgänglich, daß der Leser, Hörer, Betrachter einberufen steht in die Verantwortung gegenüber dem Kunstwerk und seiner unmittelbaren Wirkung, seinem Mysterium. Es bleibt ihm nichts übrig, als ein «aktives Verstehen», eine Antwort zu versuchen. Und das bedeutet zum Beispiel: selber zu musizieren; und es bedeutet: sich einzuverleiben (statt bloß zu konsumieren), was geschrieben steht, etwa durch Auswendiglernen, savoir par cœur.
Muß eigens betont werden, daß Steiners Argumentation nirgends die verkitschte Naivität rechtfertigt und daß sie sich kaum eignet, um irgendwelchen Befindlichkeits- und Betroffenheits-Verifikationen im Umgang mit Kunst Vorschub zu leisten? Sie mißbilligt Selbstherrlichkeit überall, einschließlich der demokratischen Vereinnahmung des Herrlichen. Sie läßt auch keinen Zweifel, daß das Wort (wie auch das Kunstwerk) an sich auslegungsbedürftig ist; nur gelte es, die Rede so zu führen, daß sie, wie es talmudischer Überlieferung entspricht, ursprünglich aus der Scheu vor der tabuverletzenden Benennung hervorgeht. Die unergründliche Schrift bedarf der tagtäglichen Glossierung. Diese aber schützt das Wort, umwebt die Wahrheit mit Antwort. Das war ihr Text. Der uns beherrschende Text, die tagtägliche Zeitung, entlarvt indessen überall das scheinhafte Wort, er macht das Gewebe der Welt fadenscheinig. Nichts anderes ist freilich ihre Aufgabe, und man brauchte kein Wort darüber zu verlieren, wären die Dienstleistungen des Durchschauens und des Mißtrauens nicht beinahe das alleingültige, konkurrenzlose Angebot, das heute allem öffentlichen und privaten Verstehen der Welt aufgenötigt wird, in und vermittels der Sprache.
Andererseits ist die Auslegung und Deutung von Kunstwerken bei uns in die Obhut kleiner akademischer Zirkel gestellt, von denen vor allem die späten Schulen der Hermeneutik, die poststrukturalistischen und dekonstruktivistischen, von Steiner mit respektvollem Unbehagen gewürdigt werden. In ihren Diskursen ist jede Begrenzung des Kommentars durch die Scheu vor dem Schöpfungsakt, dem Werk, längst gefallen. Die Schutzhülle des Textes ist zur Flechte des Parasiten geworden, der seinen Wirt zersetzt und überwuchert. Diese Poetik hat den esoterischen Poetisten hervorgebracht, dessen familiäres Mitreden am Werk den Poeten von seiner Poesie trennt und in minutiösen Schnitten Zeit, Ort, Sinn, Autorschaft vom Werk abspaltet, um es zu einer autonomen Textualität zu verarbeiten. Die Metapher vom Parasiten ist altgedient, und sie wiegt nicht mehr als ein umwelt-, ein «logos-bewußter» Protest gegen die Übermacht der sekundären, medialen, indirekten Sprechweisen, die die atmende Sprache ebenso erstickend bedecken wie die Flächenversiegelung den fruchtbaren Boden.
Vieles in den Gedankengängen dieses Buches (die streckenweise an der Seite Heideggers zurückgelegt werden) erinnert daran, daß nicht nur das natürliche, biologische Haus der Erde, sondern ebenso das geistige beschädigt und bedroht ist und nicht minder dringend der Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen bedürfte.
Gegen die herrenlose Erlaubnis des Sagbaren und Besprechbaren rät Steiner «eine Ziemlichkeit des Verstehens» an. Das Kunstwerk, um ihm neu zu begegnen, sei zu behandeln als ein Gast, ein Fremder, der plötzlich erscheint in unserem gewöhnlichen Alltag, dessen Ankunft Freude und leise Furcht begleiten. Dem Verstehen der Andersheit sind Grenzen gesetzt; mehr als Annäherung, als ein Umgang der «kardinalen Diskretionen» ist nicht möglich. Wichtiger ist, wie sich der Empfangende verhält: ob seine Begabung ausreicht, sich überwältigen zu lassen; ob er stark genug und widerstandslos zugleich sein wird für das singuläre Zustoßen eines Gedichts, einer Musik, einer Plastik, und bedacht genug, um das Fremde nicht dem Vielen einzumischen, es nicht zu verbrauchen und mit allem übrigen durcheinanderzubringen.
‹Von realer Gegenwart› ist ein Schneisenschlag, ein rigoroser Entwurf gegen die philosophischen Journalisten, die Mitverfertiger einer Weltworld, die Realisten der Entropie und der überfüllten Leere, die Rhetoriker der Simulationen und des unendlichen ludibriums. Der Autor weiß selbstverständlich, daß ihm gegenwärtig noch die Seminare und Redaktionen in Reih und Glied entgegenstehen. Er weiß aber ebenso sicher, daß die ideelle Macht der Abwesenheit und der Leugnung verbraucht ist, so wie die große Subversion und Selbstherrlichkeit Nietzsches ihr Jahrhundert gehabt hat und nur einen zerstreuten Haufen «kraftloser Empörer» (Dostojewski) übrigließ. Diese werden sich zweifellos noch lange und je bedeutungsloser, um so verbissener als die Bewahrer jener Thersites-Kultur ansehen, für deren Verbreitung die deutsche Intelligenz nach dem Krieg ihr Bestes gab, Zug um Zug häßlicher und liebloser werdend. Doch all dies enthält keinen Funken Aussicht, keine Kraft zur Erneuerung und Veränderung mehr.
Steiners Buch ist geschrieben in der deutlichen Wahrnehmung, daß die Mitternacht der Abwesenheit überschritten ist.
Ohne den Autor in eine Nachbarschaft zu rücken, die ihm vielleicht nicht behagt, gibt es doch einige Aspekte seiner Theologie des Textes, die ihn mit bedeutenden Autoren der «Remythologisierung» verbinden, insoweit sie in der «Revolte gegen die moderne Welt» ein Gemeinsames finden: Julius Evola, Eliade, Nicolás Gómez Dávila.
Wenn es in den Maximen und Reflexionen des letzteren heißt: «Die moderne Geschichte ist der Dialog zwischen zwei Männern: einer, der an Gott glaubt, ein anderer, der Gott zu sein glaubt» – so läßt sich hieran die Blickwende bestimmen, die Steiners Essay vornimmt von Nietzsches Gottmenschen ab und jenem anderen zu, der bereit ist, sein eigenes Gesicht zu verlieren und zurück in die Begegnung zu treten, die Verantwortung. Dávila ist Kolumbianer, überzeugter Hierarchist und Katholik, Moralist in der Folge Montaignes, Rivarols, de Maistres; einer der großen spirituellen Reaktionäre – und das ist gleichbedeutend mit: einer der großen Stilisten unserer Zeit, und dies wiederum ist gleichbedeutend mit: ein unbeirrter Zeitfremdling, voll scharfsinniger Frommheit. Sein Rat und seine eigene Regel: «Klarsichtig ein schlichtes, verschwiegenes, diskretes Leben führen, zwischen klugen Büchern, einigen wenigen Geschöpfen in Liebe zugetan.» An seinem Werk – fünf große Bände sollen es sein, auf deutsch ist davon nur eine schmale Auswahl erhältlich –, an seinen Provokationen und Unduldsamkeiten ließe sich beispielhaft darlegen, wie sehr heute die Faszination des Rebellen gerade von demjenigen ausgeht, der den Weg der Rechtgläubigkeit verteidigt; ihm wächst unter dem Anspruch einer diffusen häretischen Konvention jene gesteigerte Klugheit zu, die früher der gesellschaftliche Außenseiter, der kritische Nonkonformist besaß oder besitzen mußte.
«Die Freiheit des Demokraten besteht nicht darin, alles sagen zu können, was er denkt, sondern nicht alles denken zu müssen, was er sagt.»
«Die Dekadenz einer Literatur beginnt, wenn ihre Leser nicht schreiben können.»
«Der Abstand zwischen Gott und dem menschlichen Verstand ist so gewaltig, daß nur eine kindliche Theologie nicht kindisch ist.»
«Glauben heißt in die Eingeweide dessen eindringen, was wir bloß wußten.»
«Die Welt verändern: Beschäftigung für einen Zuchthäusler, der sich abfand mit seiner Verurteilung.»
«Die Fanatiker der Freiheit enden als Theoretiker der Polizei. Die Doktrin Fichtes zum Beispiel gipfelt in einer Theorie des Reisepasses.»
«Ungeachtet seiner Wut auf das Christentum ist der Stammbaum Nietzsches ungewiß. Nietzsche ist ein Saulus, der auf dem Wege nach Damaskus in Ohnmacht fällt.»
«Der Reaktionär wird nur in den Epochen ein Konservativer, die etwas bewahren, das es wert ist, erhalten zu werden.»
Der Reaktionär ist eben nicht der Aufhalter oder unverbesserliche Rückschrittler, zu dem ihn die politische Denunziation macht – er schreitet im Gegenteil voran, wenn es darum geht, etwas Vergessenes wieder in die Erinnerung zu bringen. Er hat jetzt und hier vor sich die dichten Schleier des technischen Scheins und der Bedeutungsleere, und er will sie teilen, zumindest für lichte Augenblicke, in denen Anwesenheit, Sinn, Logos offenbar werden. Nichts anderes verfolgt nach Steiner jedes große Kunstwerk und ist demnach auf eine zeitlose Weise «reaktionär»; es kämpft gegen Vergeßlichkeit in jeder Epoche.
Für den Eintritt von Modernität in unser Sprach-Bewußtsein gibt Steiner ein präzises Datum an. Es geschah, als Mallarmé sagte: das Wort Rose bedeutet nichts anderes als die vollkommene Abwesenheit des so bezeichneten Gegenstands. Das Wort duftet nicht noch sticht es. Bis dahin mochte man an Gott und der Welt zweifeln, mochte fromm oder aufgeklärt sein, jede Geisteshaltung verblieb dennoch im Vertrauen auf die Logos-Stiftung der Sprache. Nun aber war es zum Kontraktbruch zwischen Welt und Wort gekommen. Fortan sprach sich die Sprache selbst, und die Welt, Gottes Schöpfung, war ihr: die reale Abwesenheit: nicht da, wo Worte. Von der Aufkündigung der semantischen Verbindlichkeit (bei gleichzeitiger Emanzipation des Gottmenschen) bis zur reinen Selbstreferenz der Diskurse, dem nihilistischen Vertexten von Texten, verging ein Jahrhundert, das die großen «Zeichensetzer» der Moderne mit heroischen Bedeutungsschöpfungen bestritten. Aber sie alle, ob Marx, Freud, Wittgenstein, ob rational oder irrational, gingen hervor aus dem Verlust des tautologischen Urvertrauens in die Sprache: Ich bin, der Ich bin.
Die Unangemessenheit der sprachlichen Explikation, die Armut der «Antwort», die wir auf die Fülle des Empfangs geben, wenn wir zum Beispiel aufmerksam Musik hören, ist eine erste Erfahrung des Unmittelbaren und der Andersheit, die im Kunstwerk Asyl genießen. Das unerklärlich Schöne verbleibt in der complicatio, in der Eingefaßtheit aller Bedeutungen, es wird unverletzt, unenthüllt erlebt. Es bringt uns in Berührung «mit dem Stoff, der unerträumt ist in unserer Stofflichkeit». Weder ist es ein utopisches Humanum noch ein höherer ästhetischer Gemütsreflex, noch überhaupt etwas vom Menschen Vermochtes, das sich in der Schönheit verbirgt. Vielmehr klingt in ihr an oder schimmert durch: Realpräsenz, Anwesenheit, und zwar unabhängig davon, welchen historischen oder biographischen Interessen sich die Entstehung eines Romans oder eines Gemäldes verdankt. Ob man einem Kunstwerk begegnet sei, meinte der metaphysisch nicht leicht erregbare Paul Valéry, erkenne man daran, ob es einen im Zustand der Inspiriertheit zurückläßt.
Wir antworten mit Widerschein.
Die Kunstwerke sind da. Ihre Heterophanie ist unabweislich, unwandelbar. Verborgen, verhindert, verlegen ist allein der Empfänger, der Beschenkte, der Angesprochene. Er hat sich aus der Ver-antwortung gestohlen und in ein methodisches Drumherumreden geflüchtet. Nichts ist unmittelbarer mit dem Schicksal der Erde verbunden als die Sprache. Verläßt sie uns oder lösen wir uns von ihr, dann braucht man sich auch nicht weiter um den (inzwischen als politische Floskel dienenden) «Schöpfungsauftrag» zu kümmern. Die Sprache verläßt uns nicht im Schweigen, sondern nur im A-Logos, in der Entbundenheit von Form, Sinn, auctoritas der Bedeutung.
Die Lage der Kunst ist seit jeher eine unschlüssige; es ist die Samstagslage, wie es am Ende des Buchs in Gleichnisform heißt, zwischen dem Freitag mit Kreuzestod und grausamen Schmerzen und dem Sonntag der Auferstehung und der reinen Hoffnung. Weder am Tag des Grauens noch am Tag der Freude wird große Kunst geschaffen. Wohl aber am Samstag, wenn das Warten sich teilt in Erinnerung und Erwartung. So oder so ist die Unschlüssigkeit in Gefahr. Für unsere Epoche könnte dies bedeuten: Entweder wird sie beendet vom Ausbruch des vollkommenen Vergessens, nach Art einer technologischen Mutation unserer gesamten Kultur. Oder aber, was der Autor für das Bedrohlichste hält, durch den Ausbruch eines religiösen Fundamentalismus.
Setzte nicht aber die Wiederbegegnung mit dem Primären, für die hier so unerschrocken plädiert wird, zuerst voraus, daß eine revelatische Befreiung des Menschen stattfände, ein Zerreißen all der Texte und Texturen, in die er sein Herz und sein Antlitz gehüllt hat? Es wäre sehr die Frage, ob dies nicht notwendig einem Akt von fundamentalistischer Gewalt gleichkäme: Der liberale Kritiker (der nihilistische Versucher) hätte mit seiner Antwort ohnehin leichtes Spiel. In der Dichte des Möglichen, würde er sagen, in der komplexen Vielfalt ist der Eintritt der Andersheit mehr oder minder eine Angelegenheit der metaphysischen Bedürfnisse des einzelnen. Was bedeutet es schon, woran ich glaube, wenn nicht alle (oder doch zumindest sehr viele) daran glauben? Nichts. Jeder Glaube, der mich wirklich beherrschte, bedürfte der kollektiven Glaubensstärke. Wir sind indes zu lange mit allen Wassern gewaschen, als daß es je wieder das einzige geben könnte, das allein die endliche Reinheit bringt.
Darauf wird nun derjenige entgegnen, den man den Fulguristen nennen könnte, also jemand, der, wie eingangs erwähnt, von den Göttern und der modernen Wissenschaft gelernt hat, daß ein geringer abrupter Wechsel innerhalb eines «Systemganzen» zuweilen genügt, um die Heraufkunft von etwas völlig Unvorhergesehenem und Neuem zu bewirken. Kein noch so komplexes, hochentwickeltes, gleichgültiges, liberales und strapazierfähiges Gemeinsames vermag sich gegen den Blitz zu schützen, der es umordnet. Wenn der Schein wild wird nach Gestalt, wird er den Spiegel zum Bersten bringen.
Der liberale Skeptiker würde weiterhin darauf bestehen, daß sakrales Empfinden in sakraler Gemeinschaft gründen müsse, daß beider Erneuerung oder beider Wiedererstehen einen Akt der Stiftung zur Voraussetzung habe. Kein noch so rigoroser Wille zum Irrationalen, kein noch so tiefes metaphysisches Ekelgefühl vor Weltverdorbenheit könnte aber einen Einfluß auf Eintritt oder Ausbleiben einer solchen Stiftung haben. «Ich bin ein Mensch mit den unterschiedlichsten Begierden», würde er noch hinzufügen, «für mich gibt es im Grunde nur eine Sorte von Lastern, und das sind die Laster jedweder Gewißheit. Die Sünde der zu frühen Befriedigung unserer Wachheit. Ich frage mich ernstlich: Was ist und wozu braucht der Mensch Glaubenseifer und Durchdrungenheit? Gibt es dafür irgendeine biochemische Vorbedingung in seinem Genom?»
Darauf wiederum der Fulgurist: «Jetzt, natürlich – wie leicht ist es! –, man gibt sich weltklug abgeklärt, verblendungsfrei, ernüchtert. Aber der menschliche Geist wird sich nicht für alle Zeiten mit schwerentflammbarem Stoff zufriedengeben. Er ist geschaffen auch für die Begeisterung, den festlichen Irrtum, ja sogar für die Manie, die große Menschenmassen alle gleich befällt. ‹Tief ist nur die Überzeugung, die ihre eigene Unvernunft kennt› (Dávila). Man muß darauf gefaßt sein, dem Enthusiasmus wieder zu begegnen. Und man muß die nötige Vorsorge treffen, daß er nicht in die Fänge weltlicher Interessen gerät …»
So könnten sie einander ewig widersprechen, der Erwartungsvolle und der Abwartende, und würden sich doch niemals verständigen. Schließlich aber würde vielleicht der Skeptiker als erster müde und schlösse nach einem Seufzer mit der Bemerkung: «Sehen Sie, dort, die Mücken tanzen im Abendlicht. Sie klopfen mit ihren Flügeln die Luft so weich, daß die Schallwellen eines schrillen Pfiffs genügten, um den ganzen Schwarm beiseite zucken zu lassen. Aber dann nebenan tanzen sie munter weiter, sie stieben niemals auseinander.»
1987
Proust bot ihm eine widerwärtige Schriftstellerei, Rilke zeigte hysterische Weichlichkeit, Hauptmann war Barbarei, Wedekind eine schnöde Spottgeburt, Büchner ein catilinarischer Hetzer und Problemwühler, Thomas Mann gehörte auf den Weihnachtstisch bürgerlicher Genügsamkeit, Heine: ein bourgeoiser Lyriker mit den Wut- und Rachezischlauten des gekränkten und übergangenen Parisers, und auch die Lektüre von Robert Walser bereitete ihm peinliche Stunden. Ein Mann stürzt Tempelsäulen wie Samson und jagt wie dieser die Füchse mit brennendem Schweif ins literarische Philisterland. Die moderne Literatur: «eine in ihrer Masse totgeborene Produktion», Allotria, Epigonentum oder dilettantische Frechheit, jedenfalls null und windig. Nein, es ist kein Phrasendrescher, der so urteilt, kein zynischer Rebell, sondern im Gegenteil eine hochaufgerichtete Gestalt, ein Heros, der schuftet und schützt – einer der sprachmächtigsten Deutschen, mit Luther, Herder, Hölderlin, wenn Macht in der Sprache sich davon herleitet, daß jemand souverän über ihre berufbare Geschichte verfügt und doch die wahren Reichtümer aus legendärer Tiefe, aus ruhloser Noch-nicht-Sprache gewinnt. Im Besitz solcher Kräfte, der forschenden und der beschwörenden, will dieser Rudolf Borchardt nicht etwa sein Jahrhundert in die Schranken fordern, dazu findet er’s viel zu schwach, er will es verjagen und ein neues ausrufen.
Ebenso heftig, wie er schmäht, bewundert er auch. Da sind es unter den Zeitgenossen vor allem George und Hofmannsthal, zu denen er sich bekennt. Zum einen unterhält er zeitlebens ein gespanntes, nervöses Konkurrenzverhältnis. Mit dem anderen verbindet ihn die persönliche Freundschaft, wenn auch eine wechselvolle. Beide gelten ihm als die großen Erneuerer der Form, die Erschütterer und Widerrufer der Modernität. Mit ihnen sieht er um 1898 die Epoche der «Schöpferischen Restauration» heraufziehen, vor der Historismus und Naturalismus, epigonaler Klassizismus und Philistertum abzudanken haben. Der Erste Weltkrieg, für das erschreckte Europa der Zusammenbruch der alten Welt, offenbart umgekehrt dem metapolitischen Poeten gerade das unwiderrufliche Ende der neuen, der modernen Welt, der Ära des Unternehmertums und des Sozialismus, des Mammons überhaupt, «des ungeheueren Fehlschlusses der Technik, der Weltkatastrophe der Industrie».
«Die Welt wird reißend konservativ», diktiert er seinem Publikum in flammender Rede über ‹Führung› noch 1931. Sie wurde es nicht. Im Gegenteil, solchen Schlagworten folgten die Schlagetots auf dem Fuß, Führung wurde zu Terror und Geist zu Ungeist. Bevor er als Jude Deutschland hätte verlassen müssen, residierte der Dichter seit Jahren in einer Villa nahe Lucca.
Borchardts schönste, zarteste Dichtung wie seine schroffe, überspannte Gebärde als Kulturheros verdanken sich gemeinsam ein und demselben Irrtum, dem schutzspendenden, dem geschichtlichen Tiefenirrtum, daß irgendwo keine Geschichte sei, sondern nur und wiederbringlich der reine Anfang. Tief, weil er an den unvergänglichen Teil des Daseins schließt; zweifelhaft trotzdem, weil ihm die bedingungsvollen Wirklichkeiten wie auf Geheiß revidierbar erscheinen müssen.
Um das Erbe, das keiner mehr im Blut trägt, schaffend zu erwerben, um große Literaturtraditionen des Abendlands, die verkannt oder verfälscht wurden, wiederzuentdecken und fortzuführen, dazu bedarf es des wissensfrohen Dichters, nicht des Gelehrten oder Philosophen, die nur ihr Forscher-Material und -Gerät anliefern; des Dichters also mit herakleischer Stärke, der zu einen und nicht zu sondern gekommen ist, der’s zusammenfügen muß über die Jahrhunderte hin, der ganze Epochen säubert, bis er auf den Kern ihrer Frühe stößt und ihn bloßlegt. Wo er ihn berührt, wird er selbst mit Ursprung begabt, gelingt es ihm, in Zungen der Frühe gleich mit den Frühen zu sprechen, dort kann er nun übersetzen, das ist: sein Deutsch schaffen, es erneuern. Erneuern, ja, nicht kunststopfen; keine Verwandlungstricks, keine Maskenspiele des Stils – niemand war ärger feind allem Späten und Unechten als ebendieser Übersetzer, der nicht den geringsten sentimentalen Sinn besaß für gute alte Zeiten. Dem an Wiederherstellung früherer Verhältnisse gar nichts, an der Wiederkehr der Frühe alles gelegen war. Deshalb klingen Richtworte wie konservativ und Restauration, die schon für alle möglichen politischen Possen herhalten mußten, so unwürdig im Zusammenhang mit seiner Person, so lächerlich seitenverkehrt auch, da vor unserem Ohr inzwischen der Fortschrittseiferer sich konservativ nennt und das «Zurück zu» ein Kampfsignal der Weltverbesserer wurde.
Borchardts Restauration aber, zu welchen gesinnungspraktischen Konsequenzen sie ihn auch geführt haben mag, ist von den Wurzeln her universalpoetisch im Geist Herders und Friedrich Schlegels, als die zeitenspaltende Sehnsucht nach dem Ersten und Ganzen.
Es ist ein zutiefst religiöses Programm. Es will Ursprung zu Ursprung fügen, über alle Vergänglichkeit hinweg. Aber da es nun fraglos inmitten der Geschichte mit mythischer Entgegnung auftritt, gerät es auch notwendig in den Stand des geweihten Irrtums. Da aber zum anderen Borchardt der umfängliche Apparat der philologischen und historischen Wissenschaft des 19. Jahrhunderts zur Verfügung stand und er ihn mühelos beherrschte, handelt es sich gewissermaßen auch um einen gesunden und kompetenten Irrtum, der ihn vorm Irrsinn bewahrt; darin ungleich dem anderen großen Wiederbringer, der, mit Ursprung beladen, unter seiner Last in die Knie brach, dem ihm nicht nur pindarisch verwandten Hölderlin.
In den Kontinuitäten stehen, so schreibt er einmal an Hofmannsthal, wer das nicht könne, der sterbe an Selbstgift wie Nietzsche und Hölderlin, Kleist und Keats. Borchardt zerbricht nicht; aus Selbstzucht, aus Visionen der Gesundheit, aus tiefgeordnetem Geschichtsgefühl. Seine Entscheidung – unpassivisch wie der ganze Mann – ist eindeutig, hart und tatenfroh: Wiederherstellung, nichts anderes.
Sein Schutz, der Schutz eines fast dämonisch erwartungsgespannten, zu höchster Führung bereiten Menschen, liegt in seiner strenggläubigen Auffassung von den Heil-Zeiten als einem gleichsam durch die Geschichte wandernden Goldenen Urzeitalter, das aus geschichtschemischen eher denn aus historischen Prozessen auf- und abtaucht. An seiner Zeit, an irgendeiner Zeit zu leiden, das ist noch kein Talent, noch weniger ein Schicksal, denn «die Epochen waren immer fürchterlich». Folglich ist sein Lebens- und Schaffenswille von Anfang an darauf gerichtet, «mich im Bereiche meiner Kräfte der Geschichte des menschlichen Geistes unbedingt einzuheilen».
Der Zusammenbruch seines Geistes erfolgt dann nach Ablauf von Borchardts Lebenszeit, als seine Wirkung überhaupt erst hätte beginnen müssen, um so jammervoller, nämlich in Form des wohl einzigartigen Überlieferungsbruchs, der die öffentliche Nachwelt von seinem gewaltigen und anspruchsstolzen Werk bis heute trennt.
Brauchen wir etwa jetzt schon das Borchardtsche Genie der Überlieferungskunst, um uns dem Dichter selbst zu nähern – ihn überzusetzen über das stehende Wasser der Verkennung, Mißachtung, des Vergessens und, sagen wir es deutlich: der mangelnden Bildung und Empfangsqualität unseres Bewußtseins?
In dem frühen ‹Gespräch über Formen›, das den verdeutschten ‹Lysis› des Platon einführt, dem Werk des kaum Fünfundzwanzigjährigen, finden sich bereits die wichtigsten Operationen angeführt, die den Dichter als den Überbringer mit den «schicklichen Händen» (Hölderlin) darstellen. Ja, das zwiegestalte Stück ist mit seinen heiteren, mehrfachen Symmetrien selbst der lebendigste Beweis für die gelungene Technik der Wiedergewinnung: der Frühdialog Platons, in dem sich eine neue literarische Form erst bildet, nämlich das Gespräch, das er der Welt dann als «sein schönstes Geschenk übergeben wird», besitzt die fortzeugende Kraft des Anfänglichen und stiftet auch das ‹Gespräch über Formen›. Denn auch in ihm geht es um nichts anderes als um das Programm eines Wiederanfangs: um die Ankündigung einer neuen Zeit, einer neuen, traditionalen Kunst, als deren oberste Gattung eben die Übersetzung des literarischen Meisterwerks angesehen wird. Attische Wechselrede und moderne kritische Unterhaltung gehen darüber noch feinere Entsprechungen ein. Wie dort Sokrates mit dem schönen Lysis, dem neugierigen und geduldigen Knaben, das Wesen von Freundschaft und Liebe erkundet, so erschließen hier die beiden Kunstfreunde – nach allerlei philologischen Streifzügen und Seitenhieben – zuletzt allein den Liebenden, den Enthusiasten als den wahren, den originalen Übersetzer. Es ist derjenige, der sich mit aller Sehnsucht nach seinem Gegenstand verzehrt und doch zugleich in der Lage ist, «Distanz zu ertragen», der nicht versucht, das Alte uns modern, das Unverständliche daran uns verständlicher zu machen. Denn die Griechen «tout comme chez nous», das ist beinahe wie: die Geliebte, von der man sich noch alles verspricht, plötzlich, ohne Übergang, auf seinem Sofa sitzen zu haben, noch am Mittag im Morgenrock und unfrisiert, in Frotteepumps, mit der Nagelfeile die erträumten Fingerspitzen scheuernd.
Schwärmerisch wird dagegen vom neuen Dichter gefordert: Er habe vor die Formen hinzutreten, das Herrliche niedergeworfen zu erleben, ja sich zu opfern im Schattenreich der Werke, «ich bin nichts» zu stammeln und schließlich doch alles dafür zu tun, daß er «eine größere Manier, dazusein» erlange.
«Wer Formen fühlt, ist ein Liebender und darf den großen Liebenden aller Zeiten an den Saum des Mantels rühren.» Formen sind freilich nicht die Container des Kulturtransports, sie sind die Substanz der Sehnsucht selbst, das Plasma der Überlieferung. Formen schützen wohl die Gattung, die Spezies der Kunstwerke, nicht aber das künstlerische Individuum, das ihnen vielmehr innestehen, sich ihnen einheilen muß, um zu werden und zu überleben.
Jedoch, wie wir nicht erst heute sehen, sterben vor den Formen die Konventionen aus, durch die das Verstehen und die Verständigen möglich werden.
Die klassische Altertumswissenschaft im 19. Jahrhundert brauchte zu ihren Glanzzeiten ganz einfach den Typus des stillen Homer-Lesers im Volk, den im Original lesenden bürgerlichen Humanisten. Allein seine Existenz, sein passives Bedürfnis, stand in einem förderlichen Verhältnis zu ihrer Leistung und öffentlichen Bedeutung. Ebenso geht etwa Wielands «Sermonen»-Übersetzung geradezu aus den Ansprüchen eines gebildeten Publikums hervor, in dem jeder seinen Horaz auswendig kannte, und entstand wie eine höchste und reife Laune aus dieser Konvention und zeitgenössischen Kennerschaft.
Daß er mit Vergleichbarem nicht mehr zu rechnen habe, sieht denn auch der junge Dichter-Übersetzer im ‹Gespräch›. Ja, der trotzig-stolze Enthusiasmus Borchardts scheint gerade aus dem Wirbelsog der Verständnisverluste, der ihn erfaßt, erst recht zu erstarken. Was also, wenn um Dichtung und Überlieferung keine schützende, mitliebende, mitschaffende Gemeinschaft sich mehr hält? Dann muß ein jeder die Antike aus sich selber neu erschaffen – «nur durch dein eigenes Blut bringst du den uralten Mund zum Sprechen». So laute die soldatisch-lyrische Weisung; und so verfahre denn die durch ebensoviel Mannesmut wie Beschwörkraft beschlossene Opfer-Kunst der Kunst. Obgleich ihm Pathos nie ausgeht und Erregung, schroffe Schwärmerei stets zu seinen schönsten Einsichten führen – denn: «ich glaube nicht, daß die Wahrheit … nüchtern an den Tag gebracht werden kann» –, wandelt sich schon bald die Leidenschaft, und das hochgestimmte Subjektive nimmt gegen die spirituelle Pflicht des Übersetzer-Dichters ab.
Zehn Jahre nach dem ‹Gespräch›, das er 1902 Hofmannsthal vorlas, schreibt er an den Freund: «Ich bekam vor drei oder vier Jahren ein Gefühl der Inanition, eines innerlichen Ausblassens und Erfrierens in Kunstformen, deren letzter Trieb nicht zur Gestaltung strebte sondern zur Dekoration, das zu einer wahren Krise führte … Ich habe in ihr die Reste des ‹Cant› meiner Generation abgelegt, den falschen Flitter, die falsche Vornehmheit, den falschen Snobism, den falschen Aristocratism –»
Mit der vollendeten Pindar-Übersetzung packt ihn dann ein unbeschreibliches Gefühl des Stolzes und des Glücks, nun hat er der «deutschen Sprachgemeinschaft», und nicht nur dem erlesenen Kenner, dem Freund, eine ganz neue Materie eröffnet, nachdem es ihn über Jahre ängstigte, «denken zu müssen daß ich alleine und gewissermaßen verstohlen auf dem vergrabenen Schatze hockte wie Reptilien in den Märchen. Ich wußte das es nicht zehn Menschen in unserer gesamten Kulturwelt gab die diese unglaubliche, unvergleichliche Poesie unmittelbar genossen und sich assimilierten …» Nicht den einsamen Verständigen kann die allzu große Gabe, sie muß dem ganzen Volk gehören, und der Überbringer hat das instinktive Ziel, «durch die Gesamtheit meiner Arbeit die Gesamtheit meines Volkes in seiner weltbestimmenden Funktion zu repräsentieren». Der Dichter tritt in den modernsten Tagen nicht anders als in den frühesten in sein Sänger-Amt, wird zum «Zeugen des Volkes» (Hölderlin) berufen. Er, aus der Mitte aller stammend, hat nun für alle zu sprechen. Als das «lebendige und wandelnde Gedächtnis der Welt» begegnet er seinem Volk, und es muß sich nun weisen, ob es «durch das Medium des Dichterischen sich seiner Erregungen oder seiner Erinnerungen … seiner Hoffnungen und seiner Satzungen bewußt wird».
Dies Volk ist gewiß ein sagenhaftes und nicht unter der Bevölkerung zu finden, auf Straßen und Sportplätzen nicht, die die beschäftigte Menge füllt; es ist vielmehr mit seinen Königen tief in den Berg gesunken und schlummert dort, bis seine Stunde kommt. Von dort, aus einmütiger Gemeinschaft steigen Heilkräfte zum alleinstehenden Dichter, von dort empfing er seine poetische Legitimität, und man muß annehmen, daß der Mythos, die fromme Fiktion ihm tatsächlich die nötige Stärke und Zuversicht verlieh, um dieses fast unbeachtete Gigantenwerk an Dichtung, Rede und Sprachschöpfung zustande zu bringen. Denn die Vorteile, die Rechte und die Stellung eines gelobten Dichters in seinem Volk wurden ihm weniger als jedem anderen zuteil.
Scharf und unduldsam werden die tatsächlichen Verluste markiert, bitterlich wird mit Schillers ‹Nänie› das vergehende Schöne, das Vollkommene, das stirbt, beklagt – aber unverzüglich wird darauf zu Wiedereroberung, zu Ausgleich und Wiedergutmachung geschritten. Kein Konzept kann ihm daher verwerflicher erscheinen als das vom ‹Untergang des Abendlands›. Mit Inbrunst beruft er gegen dergleichen Ideen-Stümperei die «Ewigkeit der Abendländer». Der poetische Fundamentalist kehrt gegen Geschichte und Vergehendes die gedenkende Macht der Dichtung, dem Zeitenwandel enthoben wie Religion. «Denn Denken ist ein heimliches Gedenken, und wir sind nicht was wir sind, sondern was wir wieder werden können.» Und dies Werden geschieht im Gegensinn zur Evolutionsgeschichte, «denn dem Einen zu, das alle Abwandlung wieder erbt, geht der ewig nach Integration, nie nach Differenzierung strebende Weg der Menschheit …»
Das Prozeßschema, das Linien von Fortschritt oder Verfall entwirft, kann nicht das letztgründliche der Geschichte sein. Sie vollzieht sich vielmehr – für den Fundamentalisten – im langwierigen Wechsel von gottnahen und gottfernen Zeiten. Das Heilige geht in ihr sowenig verloren wie Energie im Weltraum. Sein Kommen und Schwinden, Mythennähe und Profanität unterscheidet die Epochen. Auf das altionische priesterliche Griechenland folgt die entgötterte Hybris der attischen Demokratie – «der Abgrund von Revolution und Zerstörung, in der während des siebenten und sechsten Jahrhunderts das altgriechische Gestaltenerbe Seele und Sphäre und Sinn eingebüßt hat» (und als nur einer Retter der Geheimnisse, Retter der Frühe war: Pindar, der große antike Restaurator, der Bruder-Poet). Umgekehrt folgt etwa auf die frivole Aufklärung des 18. Jahrhunderts die fromme Reformation der Romantik. Gegen die «grinsende Puppenhaftigkeit» der degenerierten Vernunft beginnt mit Herder, mit der Entdeckung der Poesie als der «Muttersprache des Menschengeschlechts», die Verjüngung der europäischen Völkergemeinde, entsteht aus der Wiederberührung mit ihrer lyrischen Urzeit der neue Epochengeist.
Gleichwohl bleibt das 19. Jahrhundert eines der größten schismatischen der Weltgeschichte. Schuld daran ist allein der ihm «und nur ihm angehörende Begriff der Emanzipation», die ursprüngliche Quelle aller unserer fortzeugenden Irrtümer, da soziale Emanzipation stets nur Freigelassene und niemals Freie schaffen kann und da – nach der Dialektik der Borchardtschen Kulturgeschichte – auf den Gräbern aller geschichtlichen Kulturen steht, «daß Epochen der Freigelassenenherrschaft nicht der Beginn der Freiheit sind, sondern das Ende der Freiheit». Der Grundsatz der Emanzipation ist nämlich die unendliche Emanzipation, sie muß immer «neue Quanten von Emanzipierbarem finden». Dem Fortschrittsradikalismus – der Herrschaft des Kronos, der seine Kinder verschlingt – fallen nicht nur Religion und Brauchtum, sondern fällt unvermeidlich auch die Erinnerungskraft der Dichtung zum Opfer. Sie wird zur Literatur, zur politisierten – «eine ausschließliche Schöpfung des Ottocento» –, wird die Hörige des Primats der Politik, statt wie bis dahin «der Politik den Gehalt zu geben, wie von Dante und Petrarca zu Macchiavelli, über Milton und Voltaire zu Schiller, über die deutsche Romantik zu Hegel …»
Das singende Bewußtsein, das nur Arché und Hierarchie belobt, hätte sich im Zeitalter der Revolutionen kaum aufrechterhalten, wäre da nicht das goldene Interregnum, das nahe und wirkliche, das auch dem modernen Menschen bewiesen hat, daß Wiederanknüpfen und Innehalten in der Geschichte möglich sind: die deutsche Romantik nämlich, die große Pause zwischen 1789 und 1848, in der sie ihre Kolonien in ganz Europa errichtete.