

Buch
Die dreißigjährige Carli weiß nicht weiter. Das Architekturstudium ist nichts für sie, ihr Zimmer in einer Marburger Zweck-WG ebenso wenig, und ihr Job im Café erfüllt sie nicht. Einziger Lichtblick: ihre beste Freundin Fritzi. Und dann ist da noch Stammgast Fabrizio. Der italienische Herr erinnert Carli an ihre eigene mediterrane Herkunft, zu der sie jedoch kaum noch Bezug hat. Als Fabrizio eines Tages nicht mehr auftaucht und Carli kurz darauf zu seiner Testamentseröffnung geladen wird, ändert sich schlagartig alles für sie. Denn Fabrizio hat ihr eine kleine Spielzeugwerkstatt in Florenz vermacht. Völlig überrumpelt reist Carli ins Herz der Toskana und entdeckt dort – inmitten verwinkelter Gässchen und italienischer Köstlichkeiten – nicht nur ihre Liebe für das Land neu, sondern stößt dabei auch auf einen alten Brief …
Autorin
Pauline Mai, 1987 geboren, wuchs am Tegeler See in Berlin auf. Sie studierte Literaturwissenschaft und lernte auf Reisen durch Südfrankreich und Italien die herzliche Lebensart der Menschen, die malerischen Landschaften sowie das köstliche mediterrane Essen lieben. Heute lebt die Autorin zwar wieder in Berlin, das Fernweh ist ihr aber immer noch geblieben – wie auch der Wunsch, die besondere Atmosphäre dieser Sehnsuchtsorte mit ihren Lesern zu teilen.
Weitere Informationen unter: www.paulinemai.de
Von Pauline Mai bereits erschienen
Das Glück ist lavendelblau
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag
und www.facebook.com/blanvalet
Pauline Mai
Das Leben
leuchtet
sonnengelb
Roman
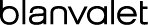
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 2021 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2021 by Pauline Mai
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Michael Gaeb
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
DN · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24362-3
V001
www.blanvalet.de
Für Lieselotte
Ich hätte die Espressomaschine im Schlaf bedienen können. Wirklich, würde mein Mitbewohner mich nachts wecken und rufen: »Carli, ein Notfall, Angela Merkel steht im Café und braucht sofort einen Cappuccino, sonst bricht der nächste Weltkrieg aus!«, ich wäre, noch träumend, zur Kaffeemaschine gewankt, hätte nach dem Kännchen gegriffen und die kühle Milch perfekt aufgeschäumt, das Kaffeesieb gefüllt, es eingedreht und den richtigen Knopf gedrückt. Und mit Sicherheit hätte ich auch noch ein hübsches Blättchen in die Milchhaube gezaubert – oder ein Herz, was bei einem drohenden Krieg vielleicht die passendere Botschaft senden würde.
Wenn man in einem Café groß geworden war, dort unzählige Nachmittage verbracht und die Großeltern genau im Blick gehabt hatte, mit ihren an der Kaffeemaschine werkelnden Händen, wie sie einen perfekt geschichteten Latte macchiato zauberten oder einen sahneliebenden Gast mit ihrem samtigen Milchschaum zum Milchcappuccino-Trinker konvertierten, wenn man schon mit fünf seine erste Sucht entwickelt hatte nach der wohl besten heißen Schokolade der Welt – dann hatte man vermutlich keine andere Chance, als irgendwann selbst das Jucken in den Fingern zu verspüren und sich an die silbern glänzende Maschine zu wagen. Mit zwölf durfte ich es zum ersten Mal versuchen, mit sechzehn hatte ich einen Schülerjob im Café. Vierzehn Jahre und ein abgebrochenes Studium später stand ich nun wieder hier. Was sich seither an mir verändert hatte, mal abgesehen von der Verschiebung meiner Sucht von heißer Schokolade hin zu Caffè Latte? Das war genau die Frage, die mir tagtäglich beim Aufwachen wie eine nervige Motte durch den Kopf flirrte und schleunigst von mir weggepustet wurde, mal mehr, mal weniger erfolgreich.
Fritzi, mit der ich mir die Schicht teilte, kam hinter die Theke gelaufen und stieß mich mit dem Ellbogen an, wobei sie beinahe meinen kostbaren ersten Kaffee des Tages verschüttete.
»Carli, dein Freund ist da.«
Ich verzog den Mund, sodass nur Fritzi es sehen konnte, als die vertraute Gestalt langsam durch die Tür des Cafés hereinschlurfte.
»Johan, machst du mir ein Croissant mit Marmelade fertig?«, rief ich durch die Öffnung der Durchreiche in die Küche und erhielt ein Grunzen zur Antwort. Auch in der Küche war wohl dringender Kaffeenachschub gefragt. Johan kochte besser als jeder andere, den ich kannte, selbst besser als Nonna, meine italienische Großmutter, und das hieß einiges. Allerdings litt er unter andauernder Grummeligkeit, die nur durch eine ausgewogene Kaffeeinfusion gemäßigt werden konnte.
Ich ließ also gleich zwei Espressi durch die Maschine laufen. Während sie ihren Dienst tat, drehte ich mich zum Gastraum um und ließ den Blick von Tisch zu Tisch wandern. Alles hier war in gedeckte Farben getaucht und hob sich darin von den luftigen, hellen Hipstercafés ab, die neuerdings überall aus dem Boden schossen. Doch auch wenn unser Café damit eher die ältere Schicht von Marburg anziehen mochte, verströmten die Wände mit ihren dunkelgrün geblümten Tapeten, die Möbel in tiefem Eichenbraun und das glänzende, wenn auch schon mitgenommen ächzende Holzparkett die Gemütlichkeit eines eingelebten Wohnzimmers. Die Deckenlampen aus Messing unter den grünen Schirmen waren eingeschaltet, sie tauchten die dunklen Möbel in warmes Licht und ließen dem Grau von draußen keinen Schlupfwinkel. Unterstützt wurden sie von den weißen Kerzen, die auf jedem der Tische in bronzenen Haltern brannten. Hinter den Fenstern zeigte sich das Marburger Wetter über dem Marktplatz wieder einmal von seiner unschönen Seite, was die Behaglichkeit hier drin jedoch nur verstärkte. Der Regen prasselte im regelmäßigen Rhythmus gegen die Scheiben, das Wasser lief in kleinen Bächen daran herab. Heute brauchte man eigentlich kein Buch und keine Zeitung, wenn man zu einem Kaffee und einem Stück Kuchen ins Café kam: Allein dieses kleine Naturschauspiel ließe sich ewig beobachten, ohne dass man sich langweilte.
Zwischen den Tischen wuselte Fritzi mit ihren langen blonden Haaren, die in einen Pferdeschwanz zurückgebunden waren, und der etwas zu eng sitzenden Schürze umher, nahm da einen Teller vom Tisch und dort eine neue Bestellung auf. Seitdem ich sie vor einem Jahr bei der Arbeit hier im Café kennengelernt hatte, waren wir zu besten Freundinnen geworden. Fritzi war ein paar Jahre jünger als ich und studierte Kulturwissenschaften, allerdings mit wenig Leidenschaft. Lieber verbrachte sie ihre Zeit mit dem Marburger Nachtleben und Dating-Apps. Wir waren uns nicht wirklich ähnlich, und vielleicht war es gerade das, was uns miteinander verband. In Gesprächen balancierten wir uns aus: Sie brachte die Leichtigkeit ein, die mir manchmal fehlte, während ich hin und wieder für die nötige Portion Realismus sorgte.
Das zischende Geräusch hinter mir versiegte, und ein intensives Kaffee-Aroma breitete sich aus, vermischte sich mit dem Duft nach frischen Croissants und dem ewig währenden Geruch nach altem Holz. Ich nahm die beiden dampfenden Tässchen und stellte Johan eines davon auf die Theke der Durchreiche. Ich suchte seinen Blick und fuchtelte wortlos mit beiden Zeigefingern zwischen ihm und der Tasse hin und her. Das entlockte ihm ein winziges Zucken der Mundwinkel, und mehr erhoffte ich mir ja gar nicht. Schon hatte ich mir die zweite Tasse und den Teller mit dem Croissant geschnappt und war auf dem Weg zu dem kleinen runden Tisch in der Ecke neben dem Zeitungsständer.
»Buongiorno«, sagte ich fröhlich, ohne eine Antwort zu erwarten, und stellte beides vor dem älteren Mann ab, der zum Dank nur nickte. Ganz, ganz selten, an wirklich guten Tagen, war ihm vielleicht mal ein gemurmelter Gruß auf Italienisch oder Deutsch zu entlocken, aber heute war wohl wieder mal keiner dieser Tage. Er war in etwa so alt, wie mein Großvater es wäre, lebte er noch. Und auch sonst erinnerten mich die Züge des Mannes ein wenig an ihn, nur dass mein Nonno so viel öfter gelächelt hatte. Seine trüben, rot geränderten Augen, die meist etwas verloren aus dem faltigen Gesicht hervorblickten, schafften nicht einmal einen Blick zu mir empor. Zu schwer schienen die einst schwarzen, nun grau melierten Augenbrauen zu wiegen. Er griff stattdessen nach der regionalen Zeitung, die Fritzi heute Morgen frisch auf den Bügel gezogen hatte, und vergrub das Gesicht dahinter. Nur die wenigen letzten Haarzipfel, die von seinem immer kahler werdenden Kopf abstanden, waren noch zu sehen. Ein wenig mitleidig betrachtete ich ihn noch einige Sekunden und biss mir auf die Lippe. Vielleicht war es Unsinn, aber ich meinte mittlerweile die Abstufungen seiner Traurigkeit unterscheiden zu können, schließlich hatte ich ihn an beinahe jedem Tag des letzten Jahres gesehen – und bedient, denn Fritzi schickte mich gern zu ihm, indem sie auf unsere »Gemeinsamkeit«, unsere italienischen Wurzeln, verwies. Jedoch schien nur sie das so zu sehen, denn der Mann war nicht erpicht auf Kontakt, weder zu mir noch zu sonst jemandem. Heute schien mir ein besonders übler Tag zu sein. Doch bevor ich weiter darüber nachsinnen oder ihn gar ansprechen konnte, wurde ich von zwei älteren Damen abgelenkt, die mich zu sich winkten.
Auf dem Weg zu ihrem Tisch streifte mein Blick das eingerahmte Foto über der Theke. Es zeigte ebendiese Theke, als sie noch den Glanz von frisch bearbeitetem, glänzendem Holz besessen hatte, und dahinter standen meine Großeltern. Sie waren jung, vielleicht Ende dreißig, ihr Haar hatte noch die stolze schwarze Farbe, ihr Teint war glatt und ihr Lächeln strahlend. Das Foto musste bei der Eröffnung des Cafés geschossen worden sein. Gut zehn Jahre zuvor waren sie als italienische Gastarbeiter nach Hessen gekommen, um in einer Pralinenfabrik zu arbeiten. Sie waren in Deutschland geblieben, hatten hier ihren Sohn – meinen Vater – großgezogen und schließlich ein eigenes Café eröffnet. Warum der neue Besitzer das Foto nicht abgenommen hatte, fragte ich mich immer wieder, ohne bei seiner ständigen Abwesenheit die Chance zu bekommen, ihm diese Frage zu stellen. Vielleicht meinte er ja, es trüge dazu bei, den nostalgischen Charme des Cafés und ein Gefühl von Authentizität zu erhalten. Ich mochte das Bild und fand es schön, es jeden Tag zu sehen, es erinnerte mich an die Nachmittage, an denen ich als Kind oft nach der Schule hier am Tisch gesessen hatte, während meine Eltern noch gearbeitet hatten. Dort hatte ich Stunden verbracht, in meine Hausaufgaben vertieft, puzzelnd oder lesend. Ich blickte mich um, das Café schien noch immer ein aus der Zeit gefallener Ort zu sein. Und doch hatte es an Leben eingebüßt, als meine Großeltern aus seinen Räumen verschwunden waren. Sie waren das Herz des Cafés gewesen, hatten die Stammgäste wohl mehr noch durch sich selbst als nur durch ihren guten Espresso und die sündigen Torten angezogen. Ihr Tod und der Verkauf an den neuen Eigentümer vor zwei Jahren hatte nicht das äußere Erscheinungsbild verändert, wohl aber die Seele des Cafés angekratzt. Von den damaligen Stammgästen kamen wenige noch so regelmäßig wie einst. Den neuen Besitzer sah man so gut wie nie in diesen Räumen. Und dass ich als Nachfahrin der Gründer nun hier arbeitete, war wohl kaum eine günstige Fügung, sondern mehr ein ironisch düsterer Schlag des Schicksals, den Alanis Morissette besingen könnte.
»Hallo, junge Frau!«
Ich sammelte mich und blickte auf zwei ungeduldige Augenpaare.
»Ähm, wie war das, bitte?« Schnell blätterte ich eine Seite des Blocks um. Die beiden Damen wechselten einen vielsagenden Blick.
»Wir nehmen einmal das große Frühstück für zwei, zwei Latte macchiato und einen Orangensaft. Bitte.« Das letzte Wort wurde giftig gezischt.
»Frisch gepresst?«, fragte ich so höflich wie zuvor.
»Nein, der ist eindeutig zu teuer.«
Ich nickte verständnisvoll und entfernte mich, während die beiden nahtlos in einen Disput über Orangenpreise verfielen.
An der Theke stand Fritzi und bereitete gerade einige Teekännchen für die japanische Touristengruppe am großen Fenstertisch vor. Während ich die Bestellung in die Kasse eintippte, warf sie mir einen Blick zu und ließ ihn dann zu dem Zeitungsleser wandern.
»Ist schon komisch, dass der jeden Tag hierherkommt, oder?«
»Hm? Ach, ich hab mich schon so an ihn gewöhnt, irgendwie gehört er mittlerweile einfach zum Inventar, findest du nicht?«
»Ja, schon. Ich arbeite jetzt drei Jahre hier, und jeden Tag sitzt er am selben Platz, trinkt seine Espressi und liest die Zeitung. Komisch ist das schon. Irgendwas hat man doch immer zu tun. Und hast du nicht erzählt, dass er sogar früher schon hier war, als das Café noch deinen Großeltern gehörte?«
»Ich glaube, ja. Nicht so regelmäßig wie jetzt, aber ich meine, ihn damals manchmal bedient zu haben. Er war halt ein Stammgast und hat sich gut mit meinen Großeltern verstanden, glaube ich.«
»Aber er muss doch mal irgendetwas anderes machen, als immer nur herumzusitzen und Zeitung zu lesen!«
Ich wartete, bis Fritzi alle Teekannen mit heißem Wasser aus der Kaffeemaschine gefüllt hatte, dann schnappte ich mir die Milchkanne und hielt sie unter den Aufschäumer, der geräuschvoll seine Arbeit tat.
»Wahrscheinlich ist er Rentner. Und Millionär«, sprudelte es aus mir heraus, als ich den Hahn wieder abgedreht hatte und in leisem Ton weiterreden konnte. »Zu Hause kümmern sich seine Angestellten um alles, putzen für ihn, verwalten sein Vermögen, gehen einkaufen. Und er kann hier sitzen und Zeitung lesen. Ein Traumleben!«
Fritzi lachte heiter auf. »Dafür guckt er aber immer ziemlich verdrießlich aus der Wäsche, wenn du mich fragst.«
»Na ja, wahrscheinlich ist es wahnsinnig langweilig, überhaupt nichts zu tun zu haben.«
Es war nicht das erste Mal, dass wir dieses Gespräch führten. In unserer Fantasie war der Zeitungsleser nicht nur schon Millionär gewesen, sondern auch ein Liebender, der hier Tag für Tag auf seine Angebetete wartete, die ihm vor fünfzig Jahren versprochen hatte, ihn irgendwann in diesem Café wiederzutreffen. Oder er war ein exzentrischer Schriftsteller, der die Nächte hindurch schrieb und die Tage über in den Zeitungen und bei den Cafébesuchern nach Inspiration suchte. Wann er schlief? Vielleicht mit offenen Augen hinter seiner Zeitung.
»Also, wenn ich nicht mehr hier arbeiten müsste, wüsste ich sehr wohl, was ich mit meiner Zeit anfangen würde!«, rief Fritzi, stemmte das Tablett mit den vielen gefüllten Kännchen auf den Arm und wandte sich mit einem letzten Schwung des Kopfes vom Tresen ab. Die grauen Ringe unter ihren Augen hatten mir schon längst verraten, dass sie die Nacht wohl wieder nicht in ihrem Bett verbracht hatte. Was Fritzi anstellen würde, wenn sie mehr freie Zeit hätte, wollte ich mir eigentlich gar nicht so genau ausmalen.
Ich platzierte die Kaffeetassen und Saftgläser auf mein Tablett und brachte sie den kritisch äugenden Damen, nur um ja schnell wieder von ihnen wegzufegen.
»Und zwar?«, fragte ich dann doch nach, als wir uns wieder am Tresen trafen und auf die von Johan zubereiteten Speisen für die Gäste warteten. Wie jede gute Bardame es in einer solchen Situation tun würde, schnappte Fritzi sich einen Lappen und wischte hierüber und darüber, während ich mich den ersten schmutzigen Gläsern zuwandte, damit bloß niemand auf die Idee käme, wir hätten nichts zu tun.
»Ich würde irgendwo in einer Hängematte in der Sonne liegen und Cocktails schlürfen, die mir von sexy Barkeepern gebracht werden.« Schon bei dem Gedanken daran brach sie in ein aufgedrehtes Kichern aus.
»In welcher Sonne? In Marburg gibt es ungefähr zwei Sonnenstunden im Jahr.«
»Quatsch, doch nicht in Marburg. Irgendwo in der Südsee würde ich liegen und mich knackig braun brennen lassen. Was würdest denn du machen, wenn du so viel Geld hättest, dass du nicht mehr arbeiten müsstest?«
Ich überlegte, die Hände im Spülwasser versenkt, der Blick gewohnheitsmäßig über die Tische wandernd und Ausschau haltend nach einer emporgereckten Hand. »Als Allererstes würde ich mir eine andere Wohnung suchen.«
»Oh, ja«, geriet Fritzi sofort ins Schwärmen, »du kommst mit mir in die Südsee, wo niemand so eine griesgrämige Miene zieht wie die da.« Sie deutete mit dem Kinn in Richtung der zwei älteren Frauen. Doch ich zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht auch hier in Marburg, Hauptsache aus dieser Schreckens-WG raus. Wo sollte ich denn sonst hin?«
»Hallo?« Fritzi hatte sich mir zugewandt und die Fäuste in die Seiten gestemmt, der Lappen hing schlaff herunter. »Wenn du schon nicht in die Südsee willst – deine Eltern haben doch ein Haus in der Toskana! Du sprichst perfekt Italienisch. Ich verstehe sowieso nicht, was du noch hier machst.«
»Du meinst also, ich sollte zu meinen Eltern ziehen und mich einfach voll und ganz von ihnen durchfüttern lassen?«, fragte ich sie lachend. Es stimmte, mein Vater hatte das Café nach dem Tod seiner Eltern verkauft, hatte mit meiner Mutter Deutschland den Rücken gekehrt und war in die Toskana gezogen, wo sie das alte Haus eines Onkels oder Großonkels, das lange leer gestanden hatte, aufgemöbelt hatten. Seither lebten sie zwischen Wein- und Olivenhängen mit eigenem ausladendem Gemüsegarten ihren Traum vom italienischen Landleben.
»Warum eigentlich nicht?« Auch Fritzi lachte nun, sie wusste ganz genau, dass so etwas für mich niemals infrage käme, zumal es klare Gründe gegeben hatte, warum ich früh von zu Hause ausgezogen war. Ein Hitzkopf in der Familie war schwierig genug, gleich drei waren eine Katastrophe. Außerdem gab es da noch diese riesengroße Lüge, die mir tagtäglich das Gewissen trübte und wie ein Elefant zwischen meinen Eltern und mir stand, wenn ich mit ihnen sprach.
»Da müsste erst einiges passieren, oder ich müsste um einiges verzweifelter sein, als ich es gerade bin, bevor es dazu käme«, wandte ich ein.
»Ich weiß, ich weiß. Auch wenn ich finde, du solltest endlich mit ihnen reden und Klarheit schaffen. Denn: Es ist Italien! Sonne, Meer, Pasta, Wein!«, schwärmte Fritzi. »Welche Gründe könnten besser geeignet sein, um endlich über den eigenen Schatten zu springen?« Mit einem Blick auf mich hielt sie inne. »Entschuldige, ich weiß, du redest nicht gern darüber.«
Während Fritzi zu einem Gast eilte, ließ ich erneut den Blick prüfend durch das Café gleiten und blieb an den Augen des Zeitungslesers hängen, die auf mich gerichtet schienen. Nein, ich irrte mich, er sah zwar in Richtung der Theke, doch sein Blick traf mich nicht ganz. Ich zuckte innerlich zusammen. Hatte er etwa gehört, wie wir über ihn geredet hatten? Aber das konnte eigentlich nicht sein, wir hatten ganz leise gesprochen, als es um ihn gegangen war. Erst beim Thema Italien hatte Fritzi die Stimme gehoben. Als ich ihn so beobachtete, während er sich erneut in die Zeitung vergrub, fiel mir wieder auf, wie mitgenommen er heute wirkte. Nicht nur griesgrämig und traurig wie sonst, sondern irgendwie fahl, das Gesicht eingefallen. Er schien körperlich angegriffen.
Doch da unterbrach mich die Küchenklingel in meinen Gedanken, und ich spurtete los, um den Gästen ihr Frühstück zu bringen. Die beiden Damen hielten mich noch einige Minuten auf Trab, schickten mich mit dem zu hart gekochten Frühstücksei zurück in die Küche, dabei war es auf die Sekunde perfekt zubereitet, ließen mich den Salzstreuer auswechseln, weil ihrer angeblich verstopft sei, und baten um mehr Brot, um es letztlich doch im Korb liegen zu lassen. Ich biss mir auf die Unterlippe, kniff mir selbst in den Arm und versuchte mir zwanghaft vorzustellen, wie ich die beiden später in einer bösen Karikatur festhalten würde, wenn ich endlich wieder an meinen Zeichenblock kam. Das Zeichnen war neben dem Kaffeemachen wohl mein einziges anderes Talent.
Als ich mich endlich der Getränkebestellung einiger anderer Gäste zuwenden konnte, kam mir Fritzi entgegen und unterdrückte ein Prusten.
»Ich übernehme die beiden«, sagte sie und drückte meinen Arm. »Du hast schon wieder deinen knallroten Kopf.«
Ich warf einen Blick in den Spiegel hinter der Theke, und wirklich: Meine Gesichtsfarbe ähnelte eindeutig der Himbeermarmelade auf dem Frühstücksteller, den Fritzi gerade an einen Tisch bringen wollte. Das ging mir leider immer so. Sobald ich mich über etwas oder jemanden aufregte, lief mein Kopf rot an, und woher das kam, ließ sich leicht feststellen. Man musste nur mal meinem Vater etwas Tabasco in den Kaffee geben, so wie ich es als Sechsjährige ausprobiert hatte, und sofort war das Experiment abgeschlossen. Ergebnis: Es vererbten sich nicht nur die dicken schwarzen Haare eines Vaters an die Tochter, sondern ebenso der Hitzkopf. Dass meine Mutter ihm in dieser Hinsicht in kaum etwas nachstand – oh, ja, das Gerücht von tellerschmeißenden Paaren? Kein Gerücht! –, hatte mir wohl keinerlei Chance gelassen, um den himbeerroten Kopf herumzukommen.
Während Fritzi sich den beiden Frauen widmete, bedeutete mir der Zeitungsleser mit einer Geste, ihm einen neuen Kaffee zu bringen. Ich bereitete einen Espresso zu, stellte ihn vorsichtig auf dem Tisch ab und wollte mich gerade wieder abwenden, als ich eine raue Stimme hörte.
»Du willst nach Italien gehen?«
Perplex starrte ich den Mann an, von dem ich, soweit ich mich erinnern konnte, noch nie mehr als zwei Worte am Stück gehört hatte. Seine Stimme klang nicht nur rau, sondern auch brüchig … eine Stimme, die nur selten benutzt wurde. Wie bei den kurzen Bestellungen, die ich bisher von ihm gehört hatte, drang auch jetzt ein südländischer Akzent durch, der mich an das italienisch gefärbte Deutsch meiner Großeltern erinnerte. Die kleinen dunklen Augen des Mannes waren auf mich gerichtet. Müde sahen sie aus, das wenige Weiß, das zu sehen war, wirkte verwässert.
»Nach Italien? Ich? Aber nein, nein, das haben Sie missverstanden.« Ich schluckte meine Überraschung herunter. »Meine Freundin und ich haben nur herumgeblödelt.«
»Aber deine Familie, sie ist in Italien?«
»Meine Eltern, ja. In der Toskana. Doch ich gehöre nicht dorthin. Mein Platz ist hier in Marburg.« Höflich lächelte ich und überlegte, wie ich das Gespräch am Laufen halten konnte. Schließlich warteten Fritzi und ich schon so lange darauf, mehr über das Leben dieses Mannes zu erfahren. Gerade wollte ich ihm eine Frage stellen, da veränderte sich etwas in seinen Augen: Der übliche abwesende, ja, abwehrende Blick wechselte zu einer Art Gutmütigkeit. Einen Augenblick lang war ich gefangen von der Wärme, die ich zum ersten Mal von ihm ausgehen spürte. Ob er mit angehört hatte, dass die Situation zwischen meinen Eltern und mir schwierig war? Anders konnte ich mir diesen Wechsel nicht erklären. Es schien mir, als ob er mich trösten wollte. Ein kleines, dankbares Lächeln breitete sich in meinem Gesicht aus, da wandte er den Blick schnell wieder von mir ab und seinem Kaffee zu. Der Moment war vorbei und damit auch die Chance, ihn nach seinem Leben zu fragen.
Erstaunt von der Begegnung, hatte ich den restlichen Tag ein wenig nachdenklich, aber ohne Zwischenfälle durchwandelt. Immer wieder hatte ich zu dem alten Mann sehen müssen, doch seine Augen blieben auf die Zeitung geheftet, bis er irgendwann am späten Nachmittag einige Münzen aus seiner Hosentasche zog und sie klimpernd auf den Tisch fallen ließ, um dann mit einem kurzen Nicken in meine Richtung aus dem Café zu schlurfen. Bildete ich es mir ein, oder ging er noch gebückter als sonst? Ich räumte die letzte Tasse auf das Tablett, zückte einen Lappen und wischte über den Tisch.
»Nach diesem Tag brauche ich unbedingt einen Drink!«, rief Fritzi quer durch den Gastraum. Ich blickte mich um, tatsächlich waren alle Gäste mittlerweile gegangen, die Tische standen unbelebt da und konnten nun endlich wieder in ihren Abendschlummer fallen. »Seid ihr dabei?«
Johans »Ohne mich« kam so schnell, da war Fritzis Frage noch nicht einmal komplett verklungen. Aber dass Johan seine Abende lieber mit seiner Familie verbrachte, wussten und verstanden wir. Fritzi richtete ihr strahlendes Lächeln auf mich. Doch ich schüttelte den Kopf.
»Sorry, aber ich will nur noch nach Hause und zeichnen, ich bin völlig kaputt.«
»Das kann nicht dein Ernst sein. Komm schon, bloß auf einen Drink.« Sie verfiel in diesen Ton, der irgendwo zwischen Betteln und Bestimmen lag und mich normalerweise sofort einfangen konnte – normalerweise, aber nicht heute. Ich winkte ab, und Fritzi schien zu merken, dass weitere Überredungsversuche sinnlos wären, also ließ sie davon ab und berichtete stattdessen endlich von ihrem Date am vergangenen Abend, während wir die Tische abwischten, die Gläser spülten und die Theke putzten. Johans Schnauben war hin und wieder bei den besonders schlüpfrigen Szenen aus der Küche zu hören, was mich nur noch mehr zum Lachen brachte. Und wieder einmal bewies Fritzi ihr Talent zur perfekten Choreografie des Erzählens, als sie mit einem »Also war es doch zu etwas gut, dass er weder meine Nummer hat noch weiß, wo ich wohne« die Cafétür hinter uns dreien mit zwei forschen Schlüsselumdrehungen abschloss. Dass wir in einer Stadt wohnten, in der man sich zwangsläufig mindestens zwanzigmal im Leben wiedertraf, ließ ich unerwähnt und drückte stattdessen Fritzi und Johan zum Abschied fest an mich, um mich auf den Heimweg zu machen.