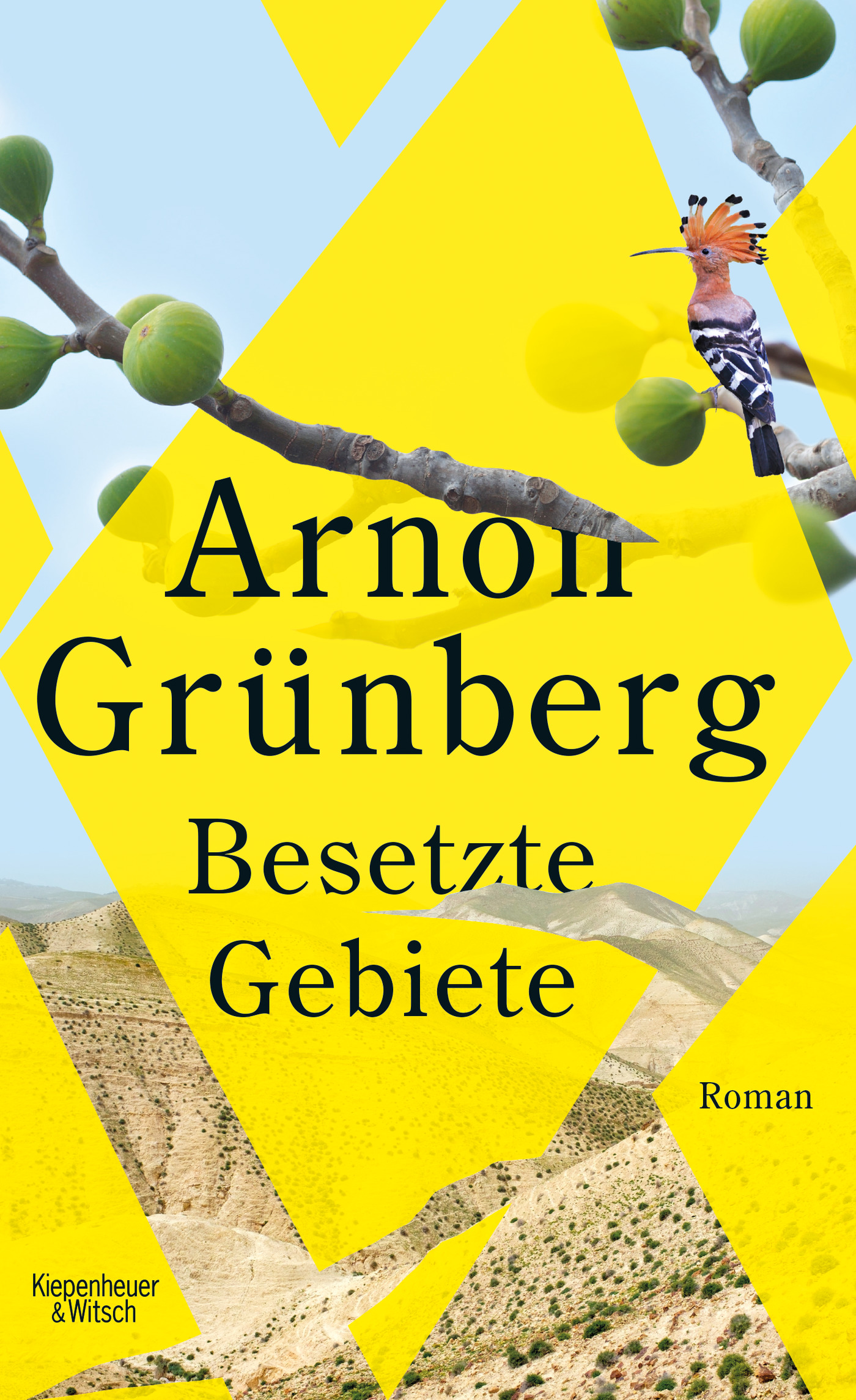
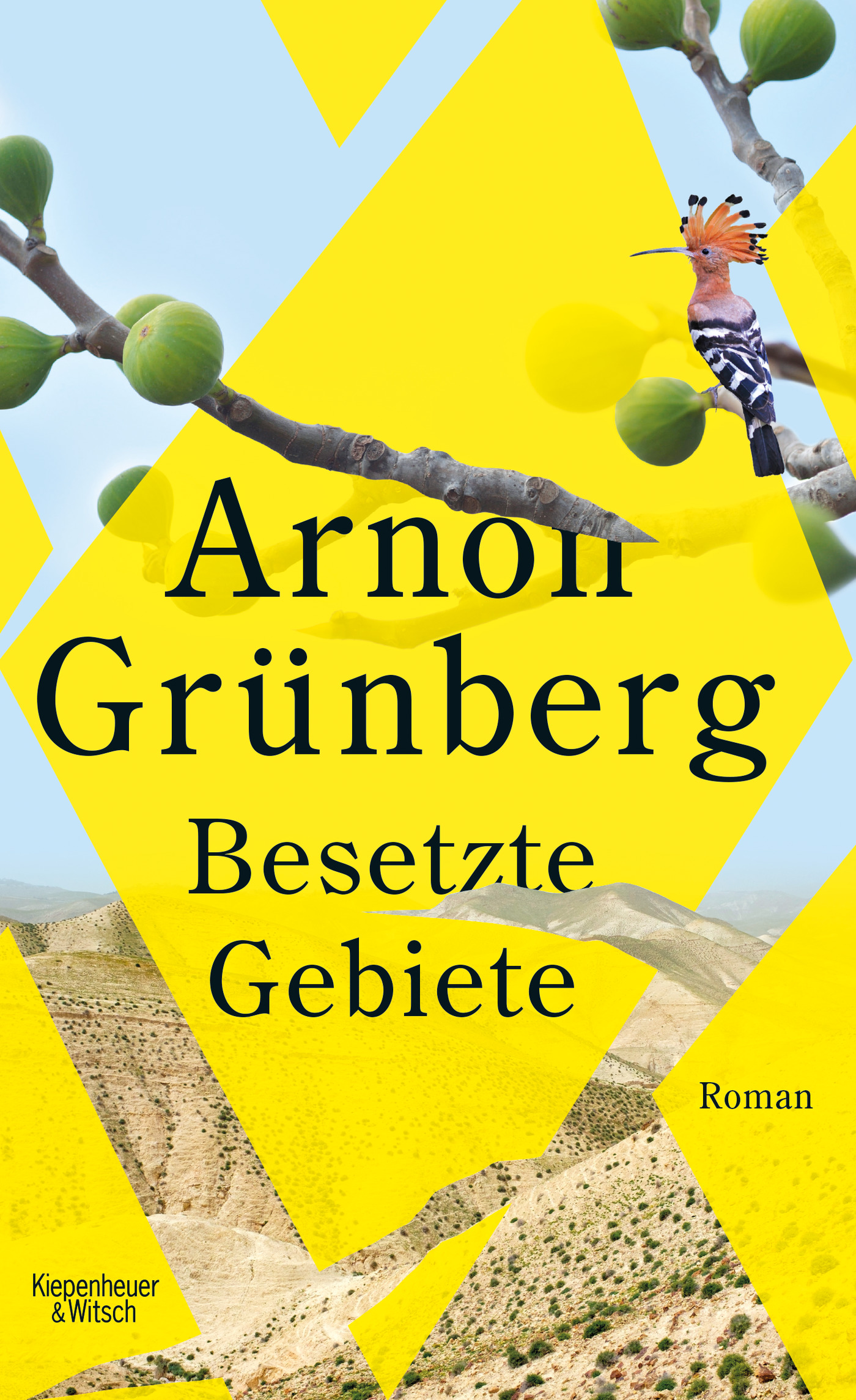
Die Übersetzung dieses Werkes wurde von der Niederländischen Stiftung für Literatur gefördert.

Für M.-L.
Könnte ich doch endlich sagen, was in mir ist.
Herausschreien: Leute, ich habe euch angelogen,
Als ich gesagt habe, es ist nicht in mir,
Wo ES doch immerzu da ist, Tag und Nacht.
›ES‹, Czesław Miłosz (nach der niederländischen Übersetzung von Karol Lesman)
»Du hast mich benutzt, du hast mich missbraucht, du hast meine Hilflosigkeit gerochen wie ein Bluthund eine Wunde, du hast mich zerfleischt, das hast du schon immer getan, Hilfebedürftige zerfleischen, zerreißen, weil du sie verachtest, weil du sie hasst – weil sie Hilfe brauchen, willst du sie kaputt machen, weil sie dich an deine eigene Hilflosigkeit erinnern, deine Schuld, weil du es nicht ertragen kannst, dass du nichts bist, genauso wenig wie alle, dass dein Leben bedeutungslos ist, schon allein darum musst du dich für andere verantwortlich fühlen, um dir selbst zu entkommen, und darum hasst du sie auch, weil dir das niemals gelingt, weil es stimmt, was sie sagen, dass es nichts zu retten gibt, und darum hasst du auch mich, vom ersten Moment an, als du mich gesehen, meine Stimme gehört hast, weil dir klar war, dass ich nicht zu retten bin, nicht so jedenfalls, wie du mich retten wolltest, und ich wusste es, intuitiv, aber ich hatte Hoffnung, wider besseres Wissen habe ich gehofft, du wärst anders, anders als all die anderen Helfer, die Aasgeier, Hyänen, die schon seit meiner Schulzeit um mich herum lauern, die ich verjagt hatte, weil ich dich liebte, mehr, als du dir vorstellen kannst, mehr, als du sehen wolltest, mehr, als du jemals erkannt hast, darum hatte ich Hoffnung, darum hab ich dich damals gefragt: ›Bist du schon mal vom Tod verführt worden, Doktor?‹ Nur wer die Versuchung des Todes gespürt hat, weiß, was Liebe ist, tief in mir drin wusste ich, wer du bist, aber das war mir egal, denn das Gefühl war stärker, diese Idee, alles Mögliche hab ich mir weisgemacht, von dir zu bekommen: Verständnis, Zärtlichkeit, Ewigkeit, Nähe, das sollen wir Menschen dir zufolge doch tun, uns alles Mögliche weismachen, nur um am Leben zu bleiben, ich dachte: Wenn ich mich dir hingebe, wie ich mich dem Tod hatte hingeben wollen, dann verstehst du das, dann geht dir auf, dass die Wahrheit der Liebe die Wahrheit des Todes ist, und ich hab mich dir zu Füßen geworfen, weil ich dir vertraut habe, weil ich dachte, du kennst trotz allem die größte Versuchung von allen, aber du kennst nur das dreckige, graue, alltägliche Leben, ich bin nicht wütend, nicht auf dich, ich bin wütend auf mich, du kannst nichts dafür, dass du ein feiger Bluthund bist mit ein paar Pillen, alternativer Therapie und Musiktherapie im Angebot und sonst nichts, du denkst, das Leiden hätte dich vergessen, für dich gäbe es nur das Leiden der anderen, aber du willst nicht sehen, was alle anderen sehen, was jeder weiß: Du bist genauso klein und leidend wie alle, ich vertraue dir immer noch – auch wenn du mich nicht willst, nicht wirklich jedenfalls –, deinem Blick und dieser salbungsvollen Stimme, die behauptet, alles zu verstehen, und die sagt: ›Alles wird gut‹, aber du verstehst gar nichts und gar nichts wird gut, du hast mir das Einzige genommen, was ich noch hatte: meinen Schmerz, du meintest, der Schmerz würde mir nicht guttun, es wäre nicht mein Schmerz, ich müsste ihn mit meiner verdammten Familie teilen, du hast meinen Schmerz gelindert, bis ich überhaupt nichts mehr fühlte, für wen hältst du dich, mir meinen Schmerz zu nehmen, was, denkst du, ist der Mensch ohne Schmerz, du hast das bekämpft, was du mein Selbstmitleid nanntest, du wolltest mich widerstandsfähig machen, sind wir auf der Welt, um widerstandsfähig zu sein, willst du mir und deinen anderen Patienten das sagen? Alles, was mir auf der Welt Halt gab, hast du mir genommen und schlechtgemacht, du hast mich zum Leben verführt, und jetzt frage ich dich, Doktorchen: Nennst du das Leben, hast du nicht gewusst, was nach dem Schmerz kommt, wusstest du’s nicht oder wolltest du es nicht wissen, bist du hier, um alle mit dem Elend anzustecken, dem Elend, das du Heilung nennst, du hast mich gekidnappt und ausgenutzt und das ›alternative Therapie‹ genannt, weil du wusstest, dass ich entführt werden wollte, aber ich wollte keine Hilfe, ich wollte kein Almosen, ich wollte Liebe, und jetzt hab ich jemanden kennengelernt, der mir die Augen geöffnet hat, dein Albtraum ist Wahrheit geworden, ich hab jemanden kennengelernt, und der hat alles aufgeschrieben, die ganze Geschichte, alles wird an die Öffentlichkeit kommen, und unser Geheimnis wird kein Geheimnis mehr sein, du wirst zur Verantwortung gezogen, du Arschloch, du wirst dich vor Menschen verantworten müssen, die selbstsicherer und weniger hilflos sind als ich, liebes Arschloch, Kadoke, endlich wird über dich gerichtet, und du hast es verdient, ich will dich beschützen, so wie du mich früher, die Rollen sind vertauscht, jetzt bist du abhängig von mir, du musst lernen, was Abhängigkeit bedeutet, sonst ändert sich nie etwas, halt mich zurück, wenn du kannst, binde mich fest, wenn du es wagst, mein therapieloses Leben beginnt jetzt, deine Heilung ist eine Hölle, ihr habt die Welt entzaubert, jede Gemeinschaft zerstört, selbstverliebt nimmst du in Anspruch, im Namen der Wahrheit zu sprechen, aber im Namen der Wissenschaft habt ihr aus dem Menschen eine Laborratte gemacht und aus der Welt eine Müllhalde, ich liebe jemand anderen, weil du nicht zulässt, dass jemand dich liebt, aber ich kann dich nicht vergessen und werde dafür sorgen, dass auch du mich nicht vergisst, endlich sehe ich dich so, wie du bist, und bald werden das auch andere sehen, und ihnen werden die Augen aufgehen: Du bist der Vernichter der Schönheit, und diese Vernichtung wird dich teuer zu stehen kommen, aber im letzten Moment werde ich dich vom Schafott zerren, ich, Michette, ich will, dass du endlich siehst und fühlst, komm endlich in meinen Kopf, und nicht wie ein Tourist, denn deine Art Hilfe ist bloßer Tourismus, komm in meinen Kopf als ein Leidensgenosse, wenn du dich traust, wenn du bereit bist, alles hinter dir zu lassen und aufzugeben.«
Michette hat ihre Tirade beendet, sie setzt sich aufs Bett neben ihren Psychiater und legt den Arm um ihn. So bleiben sie eine Weile sitzen, bis Kadoke aufsteht und aus dem Fenster schaut. »Wir sind schon seit Langem Leidensgenossen, du und ich«, sagt er.
Sie schüttelt den Kopf. »Du tust, als stündest du über dem Leiden, und weigerst dich, diese Haltung aufzugeben.«
Er geht zum Bett zurück. »Du darfst dich nicht mit deinem Schmerz identifizieren, das ist eine ungesunde Strategie, so ungesund wie das Identifizieren mit deiner Diagnose, du darfst nicht sagen: ›Ich bin mein Schmerz.‹ Leiden ist keine olympische Disziplin, nichts, was dem Leben einen Sinn gibt.«
»Aber man kann aus der Not eine Tugend machen. Das darf man doch, oder, Doktorchen?« Sie lächelt, triumphierend, so scheint es, und zum ersten Mal hat er das Gefühl, dass er diesen Kampf verlieren wird, auf jeden Fall nicht gewinnen. In dieser Welt gibt es kein »Unentschieden«.
»Du fehlst mir, du bist noch da, aber du fehlst mir schon jetzt«, sagt Michette.
»Ja«, antwortet Kadoke.
Die ganze Nacht und den ganzen Morgen hat es geregnet, von dem ständigen Rauschen konnte er nicht schlafen, aber jetzt hat es aufgeklart, ideales Wetter für einen Strandspaziergang, frische Luft schnappen, wie die Leute das nennen. Sie befinden sich in Michettes kleinem, nicht besonders komfortablem Zimmer im Hotel »Meerjungfrau«, das ihren Eltern gehört. Dieses Zimmer ist ihr Zuhause, in diesem Hotel ist sie aufgewachsen, hier ist sie zuerst der Liebe begegnet, hat gelernt, Schnitzel zu braten, in Kadokes Augen hat sie sich stabilisiert.
»Du lässt Wut zu«, sagt Kadoke, als er wieder neben ihr sitzt. »Lange Zeit konntest du das nicht, hast es nicht gewagt. Du konntest es nur, indem du dir wehtust. Dieser Wutausbruch ist also ein Fortschritt, ein Zeichen, dass es dir besser geht. Obwohl ich mich frage, warum du jetzt gerade wütend auf mich bist und auf wen deine Wut sich eigentlich richtet.«
Die Meerjungfrau, ein merkwürdiger Name für ein heruntergekommenes Hotel, das seine Pforten eigentlich schon längst hätte schließen müssen, das aber Vater, Mutter und Tochter zusammenhält. Seit anderthalb Jahren wohnt hier auch Kadokes Mutter, als eine Art Ex-Meerjungfrau. Umsorgt und betreut von Michette, die sich vor ungefähr einer Woche die Haare geschnitten und dezent rot gefärbt hat, ein Rot, das ihre natürliche Farbe sein könnte.
»Ich bin wütend auf alles«, sagt sie. »Auf alles und jeden. Ich kann mit dir nicht kommunizieren, unser Gespräch ist zu Ende. Du hast mich verwüstet und diese Verwüstung ›Heilung‹ genannt. Du machst mich fertig, du glaubst nicht, wie fertig ich bin.«
Die Patientin als Altenpflegerin, das war seine alternative Therapie gewesen. Er war nicht unzufrieden darüber, doch jetzt kommen ihm Zweifel. War es eine gute Idee, sie hierherzubringen? Zurück zu den Leuten, die sie auf die Welt gesetzt, unter ihrer Krankheit gleichfalls gelitten haben, die sich nach ihrer Genesung sehnten. Er hatte keine andere Möglichkeit gesehen, evidenzgestützte Therapie ist ein Luxus, den man nicht immer hat, manchmal muss man improvisieren, beim Menschenretten und auch sonst.
»Was genau an deinem Leben ist denn verwüstet?«
Sonne und Meer, Wind und Regen – das Hotel »Meerjungfrau« war ihm als der schnellste Weg zu Struktur, Reinheit und Ruhe erschienen. Zu Stabilität.
»Alles«, erklärt Michette. »Es ist deine Anwesenheit. Ich hab keine Kraft mehr, mit dir zu diskutieren, ich entlasse dich als meinen Therapeuten, mit anderen Worten: Ich verlasse dich. Ich habe mich in jemand anderen verliebt. Ich liebe jemanden. Weißt du, was diese drei Worte bedeuten? Ich liebe jemanden, ich hab es geheim gehalten, weil ich wusste, du würdest es mir kaputt machen, wie du all meine Fantasien kaputt gemacht hast, bis keine Fantasien mehr da waren, bis auf deine fantasielose Fantasie. In der habe ich eine Weile gelebt, aber das ist jetzt zu Ende. Ich werd dir was singen, ich habe ein Lied geschrieben, wenn du das hörst, verstehst du mich vielleicht.« Sie nimmt ein Heft, klappt es auf, schlägt mit der Rechten den Takt und beginnt: »Wie konntest du mich nur so tief verletzen, jetzt endlich kann ich mich dir widersetzen.«
Das Singen war Teil der Musiktherapie, mit der Kadoke es zuletzt versucht hatte und die ziemlich erfolgreich zu sein schien. Kadoke senkt ein wenig den Kopf, aber nicht demütig, nur, um sich besser zu konzentrieren. »Wissen deine Eltern, dass du weggehen willst?«, fragt er.
In den vergangenen Wochen, Monaten eigentlich, war es ruhig im Hotel, beinahe friedlich, vielleicht hatte diese Ruhe ihn eingelullt, hat er gewisse Dinge nicht wahrgenommen, die er hätte sehen müssen.
Michette steckt sich ein Kaugummi in den Mund. Sie wischt sich die Hände an ihrer Jeans ab.
»Das Lied ist zu Ende – für dich«, sagt sie, »wie es weitergeht, brauchst du nicht zu wissen. Mir ist klar geworden, dass du mich niemals geliebt hast. Endlich weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man wirklich geliebt wird, wenn jemand dir zuhört, deinen Schmerz wirklich sieht. Wenn es dich geben darf. Liebe heißt da sein zu dürfen.«
Kadoke mustert kurz ihre Handgelenke und Unterarme. Sie hat die Ärmel des Pullovers hochgeschoben, keinerlei Hinweis auf einen Rückfall, kein Pflaster, keine neuen Narben. »Auch ohne Liebe darf es dich geben«, sagt er.
Michette kaut mit geschlossenem Mund, aber vernehmlich.
»Er hat alles aufgeschrieben«, erklärt sie. »Auch über dich. Es ist beinahe fertig. Er hat mir zugehört, wie du das niemals getan hast, und mich nicht verurteilt. Mach dich auf was gefasst, Doktorchen.« Sie lächelt, leicht provozierend, aber vor allem hochmütig.
Den anderen provozieren, für manche Leute ist das ein Genuss. Nicht für Kadoke, für ihn besteht die Kunst darin, mit diesen Provokationen umzugehen, sie zu parieren wie einen Messerangriff. Die alternative Therapie hat eine Grenze überschritten, nicht, dass zwischen ihm und Michette je etwas vorgefallen wäre, aber er hat die ärztlichen Regeln missachtet. Die Grenzüberschreitung war eine Notlösung gewesen.
»Es steht dir jeden Moment frei zu gehen, so war das die ganze Zeit schon.«
Das Wort »austherapiert« damals hatte ihn erschüttert, und dieser Moment hatte zu dem geführt, was viele seiner Kollegen einen Fehltritt nennen würden, einen Kardinalfehler sogar. Er hatte diese junge Frau, seine Patientin, als Altenpflegerin für seine Mutter engagiert, zuerst bei der Mutter zu Hause, dann im Hotel von Michettes Eltern an einem windgebeutelten Strand in der Provinz Zeeland.
»Ich war abhängig von dir, ich hab dich geliebt, und niemand verlässt einen geliebten Menschen, du bist ein Zuhälter, Doktorchen, aber ich hatte nur einen Kunden, das muss ich zugeben, deine alte, halb tote Mutter.«
Kadoke lässt seinen linken Schuh wippen, einen dunkelblauen Slipper.
»Wenn du denkst, du musst gehen und woanders geht es dir besser, dann solltest du das unbedingt tun.«
»Hör doch auf mit deinen Phrasen!«, ruft Michette. »Hörst du mir überhaupt zu? Ich liebe jemand anderen. Er hat über uns geschrieben. Er ist berühmt, vielleicht hast du schon mal was von ihm gelesen, er weiß, was zwischen uns geschehen ist, jedes Detail, und ein paar Dinge, die er nicht wusste, hat er sich vorgestellt, und sie stimmten auch noch, unglaublich, was? Aber du hast einen anderen Namen bekommen, keine Angst, kein Mensch wird dich erkennen, na ja, manche vielleicht schon, Kollegen, Verwandte. Wenn ich den Namen lese oder höre, muss ich jedes Mal lachen, er ist so lustig. Manche Dinge sind natürlich erfunden, im Buch hast du ein Kind und Papatage, diese Papatage sind so witzig beschrieben, du wirst auch lachen. Für dich wären solche Papatage der Horror.«
Im Flur hört Kadoke ein Geräusch, jemand schlurft am Zimmer vorbei. Michettes Vater vermutlich, er liebt es, durch die Flure seines Hotels zu schlurfen, auch wenn es fast leer ist.
»Du hast also«, erwidert Kadoke, den Kopf in den Händen, den Blick auf die Schuhe gerichtet, »du hast eine Beziehung. Willst du mir das sagen? Dazu habe ich dich doch immer ermuntert: Du musst tun, was für gesunde Frauen in deinem Alter normal ist, und dazu gehört auch eine Liebesbeziehung.«
»Ach, hör doch auf«, ruft Michette und rennt ans Fenster, sie ist barfuß. »Ich gehe hier weg, das will ich dir sagen, für deine Mutter musst du ab jetzt allein sorgen. Ich komme nie mehr zurück.«
Wieder lacht sie, wie eben, als sie von den Papatagen erzählte.
Hiermit hat er nicht gerechnet, vor sechs Tagen war er zum letzten Mal hier, da war alles noch, wie es sein sollte. Michette war etwas reserviert in letzter Zeit, aber das hatte er als gutes Zeichen gesehen, sie löste sich von ihm, ihre Abhängigkeit wurde weniger, Kadoke mehr und mehr überflüssig.
Und mindestens genauso wichtig: Auch der Gesundheitszustand seiner Mutter war stabil. Ruhig und friedlich, irgendwie war das hier das Paradies, soweit man sich das Paradies als ein verlassenes Hotel in Zeeland vorstellen kann, voller Patienten mit diversen Störungen und einer Handvoll verirrter Touristen, vielleicht ebenfalls Patienten, zumindest heimlich.
Michette schlüpft in ihre Socken und Turnschuhe und ergreift eine Einkaufstüte, in der offenbar ein paar Kleidungsstücke stecken. Das Heft mit ihren Liedern legt sie dazu. »Ich hab Papa und der Frau, die behauptet, meine Mutter zu sein, einen Brief geschrieben, dass ich mit wem zusammenziehe, dass mit der alternativen Therapie Schluss ist, dass deine Mutter aber von mir aus bis zum Ende ihrer Tage hierbleiben kann.«
Sie macht ein paar Schritte auf ihn zu. Kadoke steht auf, offenbar ist dies der Moment des Abschieds. Michette hat schon so oft Abschied genommen, von ihm, vom Leben, von ihren Eltern, doch Kadoke erkennt, dass dieser Abschied anders ist als all die anderen Male, als sie behauptete, nie mehr wiederzukommen. Was ist der Unterschied zwischen dieser jungen Frau und seinen anderen Patienten? Sie ist sein Fehltritt, darum schneiden ihre Worte ihm so ins Fleisch.
Gefühle durchströmen ihn, die sonst selten an die Oberfläche kommen, eine Kombination von Antipathie und Zuneigung, leichtem Ekel und Rührung.
»Ich werd deine Mutter vermissen«, sagt sie. »Irgendwie war es doch … eine lange Zeit. Ich hab mich an sie gewöhnt. Auf ihre Weise ist sie echt lieb. Dich werd ich auch vermissen, auch wenn du das größte Arschloch bist, dem ich jemals begegnet bin.«
Er schaut ihr in die Augen. Wie viel Abstand braucht ein Mensch? Was ist professionelle Distanz und was Selbstschutz?
Sie umarmt Kadoke, immer fester presst sie sich an ihn, schlägt ihm die Fingernägel in den Rücken, durch seinen Pullover, springt ihn an wie ein wütendes Kind. »Arschloch«, sagt sie, »Idiot, du bist so was von abgefuckt.« Sie beißt ihm in den Hals. Dann lässt sie ihn los.
»Bist du dort, wo du hingehst, auch nicht gefährdet?«, fragt er.
Michette antwortet nicht, sie stapft aus dem Zimmer, schaut sich nicht mehr um.
Am liebsten würde Kadoke ihr hinterherlaufen, doch er beherrscht sich, Selbstbeherrschung sieht er als die höchste Tugend. Er setzt sich aufs Bett, betrachtet das kleine Zimmer, aus dem Michette nunmehr verschwunden ist. Sie lässt nichts zurück bis auf den Duft ihres Parfüms.
Mutter sitzt an ihrem kleinen Schreibtisch am Fenster, ein paar Tabletten und eine Tasse Tee vor sich, sie schaut auf den menschenleeren Strand. Neben den Tabletten liegt ihre Perücke. Sie ignoriert ihren Sohn. Wenn sie wütend ist, tut sie, als würde sie ihn nicht sehen.
»Da bin ich, Mutter«, sagt Kadoke nach einer Weile. Er nimmt sich einen Stuhl, setzt sich neben sie, streichelt ihr über den Arm. »Alles in Ordnung? Warum hast du die Perücke nicht auf?«
»Nein«, sagt sie.
»Nein was?«
»Nein, nichts ist in Ordnung. Nichts. Nein, nein, nein. Ich hab meine Perücke abgenommen.« Sie spricht abgehackt, ohne ihn anzusehen, als rede sie nicht mit ihm, sondern mit einem Abwesenden, vermutlich mit Gott, dem großen Abwesenden in ihrem Leben.
»Was ist denn los, Mama?«
Sie schüttelt den Kopf. »Ist sie weg?«
»Wer?«
»Das Mädchen.«
»Michette? Ja, Michette ist weg. Wir müssen eine neue Lösung für dich finden. Ohne sie kannst du nicht hierbleiben.«
Mutter reibt sich die Augen. Kadoke sieht, dass sie weint.
»Sie hat mich verraten«, sagt sie.
Kadoke schüttelt den Kopf. »So würde ich das nicht nennen – sie ist gegangen. Sie hat ihr eigenes Leben, und das nimmt sie jetzt in die Hand. Das war doch Sinn der Übung.«
Mutter friemelt an ihrer Perücke herum, als wolle sie Fusseln entfernen, und Kadoke streichelt ihr weiter über den Arm.
»Sie hat mich verraten«, ruft Mutter plötzlich, fast wimmernd. Jetzt blickt sie ihm in die Augen. »Sie hat zu mir gesagt: ›Ich gehe, ich hab mich verliebt, ich werde ein neues Leben beginnen.‹ Von einem Moment auf den anderen. Einfach so.«
»Das ist ihr gutes Recht. Du bist so viel älter als sie. Du bist nicht ihr Freund.«
»Es ist nicht loyal«, sagt Mutter.
»Loyalität ist kein Gefängnis. Michette darf gehen, wann immer sie will.«
»Was ist mit deinem Hals? Du hast da einen roten Fleck.«
»Es hat mich was gebissen.« Kadoke hält seine Mutter im Arm, so gut es geht, drückt sie an sich.
»Ich will hier nicht weg.«
»Wenn Michette nicht innerhalb von vierundzwanzig Stunden zurückkommt – und wie gesagt: ich glaube nicht, dass das geschieht –, müssen wir eine andere Lösung für dich finden. Dann fahren wir nach Hause. Das Haus steht noch, alles ist noch genau so, wie du es zurückgelassen hast. Die Nachbarin. Deine Freunde. Die Familie. Die noch übrig sind zumindest. Ich werde dein Bett vorbereiten. Du wirst wieder zu Hause wohnen.«
Sie starrt eine Weile vor sich hin, sie hat sich beruhigt.
»Ich hab kein Zuhause, Freunde habe ich schon lange nicht mehr, und die Nachbarin kann mir den Buckel runterrutschen. Und Familie? Übrig gebliebene Familie? Es ist keiner mehr übrig. Bis auf dich, du bist der Rest. Diese Woche hat eine Frau angerufen, sie hat behauptet, eine Verwandte meiner Mutter zu sein, ob sie vorbeikommen könnte, aber ich habe ihr ausrichten lassen, dass ich keinen Besuch will, dass sie nicht herzukommen braucht. Sie haben sich nie um uns gekümmert, jetzt können sie sich das auch sparen. Zu spät. Zuschauen, wie ich krepiere, das wollen sie. Alle lassen mich im Stich. Aber ich beklage mich nicht. Hörst du mich klagen?«
»Nein«, antwortet Kadoke. »Du beklagst dich nicht.«
»Hast du mich jemals klagen hören?«
»Nein«, sagt Kadoke. »Niemals.«
Sie wendet sich von ihm ab, schluckt schnell und routiniert ihre Tabletten. »Mach mich bald tot, bitte«, fleht sie. »Das hier ist kein Leben.«
In der Küche steht Michettes Vater und schneidet Zwiebeln. Jeden Vormittag kommt ein Zimmermädchen – nun ja, Mädchen, die Frau ist fast sechzig – und kümmert sich um die paar vermieteten Zimmer. Die Küche jedoch schmeißt Michettes Vater außer in der Hochsaison gänzlich allein.
»Deine Tochter hat sich verabschiedet«, sagt Kadoke.
Der Vater lässt sich in seiner Arbeit nicht stören, er würdigt den Psychiater keines Blickes.
»Ich fahre nach Amsterdam zurück«, fährt Kadoke fort, »aber morgen komme ich wieder. Ohne Michette kann meine Mutter nicht hierbleiben, das sehe ich ein.«
Keine Antwort. Der Vater nimmt die nächste Zwiebel.
Im Laufe der Monate hat Kadoke eine Beziehung zu ihm aufgebaut, kompliziert, aber eine Beziehung, der Vater ist weniger argwöhnisch und hat Vertrauen zu seiner alternativen Therapie gewonnen, das ist zumindest Kadokes Eindruck. Selbst Michettes Mutter, die ihn anfangs nicht einmal sehen wollte, ist ein klein wenig aufgetaut, was in der Praxis bedeutet, dass die ihn grüßt, wenn sie ihm irgendwo im Hotel begegnet.
Als der Vater mit der Zwiebel fertig ist, zeigt er auf einen Brief neben den noch unzerkleinerten Knollen, einer Paprika und ein paar Tomaten auf der Anrichte. »Hast du ihn gelesen?«, fragt er. Der Brief ist auf blauem Papier mit Katzenpfötchen-Motiv geschrieben. Kadoke erkennt Michettes Handschrift, er sieht das Wort »Papa«.
»Der Brief ist nicht an mich«, sagt er.
Der Vater schnieft demonstrativ, auch nach Jahren lassen die Zwiebeln seine Augen immer noch tränen.
»Willst du ihn lesen?«
Kadoke schüttelt den Kopf.
»Sie zieht mit diesem Typen zusammen«, sagt der Vater. »Er ist ein paarmal hier gewesen. Ein alter Mann mal wieder, fast schon Rentner. Wär ja auch zu schön gewesen. Er wird ihr nicht guttun, ich hab ihn im Fernsehen gesehen. Man kann ihm nicht trauen. Und sie ist wütend – auf dich, auf mich und ihre Mutter. ›Ich hatte eine Scheißkindheit und eine Scheißmutter‹, schreibt sie. ›Mein Psychiater war ein Scheißpsychiater, aber jetzt weiß ich, dass ihr auch nichts dafür könnt. Nennen wir diese Erkenntnis Genesung‹. Ist das so, Doktor? Ist diese Erkenntnis Genesung?«
Kadoke starrt gebannt auf die Zwiebeln. »Sie ist wütend«, erklärt er, »aber das ist ein Fortschritt: Sie lässt Wut zu, ohne sich selbst zu verletzen. Manchmal fasst sie ihre Wut poetisch in Worte, manchmal etwas weniger poetisch.«
»Dass sie ihre Mutter ›Scheißmutter‹ nennt, soll ich also einen Fortschritt finden?«
»Es klingt vielleicht komisch, aber in diesem Fall ist das wohl so.«
Kadokes Aufgabe hier ist erfüllt, ob er sie gut erfüllt hat, ist eine andere Frage. Vermutlich nicht, aber es hätte schlimmer ausgehen können, viel schlimmer. Seine Zeit in der »Meerjungfrau« geht zu Ende, trotz alledem stimmt ihn das wehmütig, Liebe ist auch Gewöhnung, er hat diesen Ort lieb gewonnen. Auch ihm gegenüber hat Michette von ihrer »Scheißfamilie« gesprochen und gesagt, Ärzte wie er hätten die Menschen zu Laborratten gemacht. Einen Moment lang fühlte er sich versucht, ihr zu widersprechen, aber jetzt ist es zu spät. Sie ist weg.
»Kennst du den Mann?«, fragt Michettes Vater.
»Wen?«
»Diesen Freund.«
»Nicht persönlich. Aber es hat keinen Sinn, Michettes Entscheidungen von vornherein schlechtzureden. Vertrauen wir darauf, dass sie ohne uns auskommt, dass sie intuitiv weiß, was gut für sie ist. Sie versucht, eine Liebesbeziehung aufzubauen. Das habe ich ihr immer geraten.«
Der Vater wischt sich die Hände an der Schürze ab.
»Was hast du eigentlich für sie getan? Ich hab schon vor Monaten gespürt, dass das so endet. Und du? Was hast du gespürt?«
Kadoke schaut Michettes Vater an, als sei er für ihn ein komplett Fremder. »Ich glaube«, sagt er, »wir alle zusammen haben sehr viel für sie getan, wir haben sie am Leben gehalten.«
»Er ist als Hotelgast gekommen«, erklärt der Vater. »Dieser Mann. Hatte eine Lesung hier in der Gegend und den letzten Zug versäumt. Da hat er hier übernachtet. So hat es angefangen. Ich dachte, das wüsstest du.«
Der Vater wischt das Messer an einem Geschirrtuch ab.
»Nein«, erwidert Kadoke. »Das wusste ich nicht.«
»Du bist doch ihr Therapeut? Ihr Psychiater. Wieso wusstest du das nicht?«
»Ich bin kein Spion«, antwortet Kadoke. »Wenn sie mir etwas nicht sagen will, ist das ihre Entscheidung.«
Der Vater schüttelt voll Unverständnis den Kopf, auch wütend vermutlich. »Sie hat ihn beim Frühstück bedient«, sagt er, »ich habe es kommen sehen, schon am ersten Tag, aber was sollte ich machen?«
»Ein Vater ist kein allwissender Gott, der seine Tochter vor jedem Fehltritt behüten kann, und ein Psychiater ist das für seinen Patienten auch nicht. Wenn sich diese Beziehung als Irrtum herausstellt, wird der hoffentlich nicht tödlich.«
»Was bist du für ein Therapeut«, murmelt der Vater, »sie nennt ihre Mutter ›Scheißmutter‹ – ›kein Problem!‹ –, sie fängt eine Beziehung mit einem Mann an, dem ich keine zehn Meter über den Weg traue, ganz abgesehen von seinem Alter, und auch das: ›kein Problem!‹. Wann ist irgendwas eigentlich wirklich ein Problem? Wenn sie tot ist?«
Wieder starrt Kadoke auf die geschnittenen Zwiebeln. »Die Ziele, die wir uns gesetzt haben – du, deine Tochter, deine Frau, ich –, bestanden darin, dass Michette lernt, selbstständig vernünftige Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Ziel ganz erreicht haben, aber wir sind dem Ziel nahegekommen. Dass ihre Entscheidungen dir nicht gefallen, kann ich verstehen, aber das ist eine andere Geschichte.«
Der Vater nimmt eine Paprika und zerkleinert jetzt die.
»Gestern«, sagt er, »hat sie hier in der Küche ein Lied über dich gesungen. Auf den Text wäre ich nicht stolz, wenn ich du wäre.« Der Vater zeigt auf die Gitarre in der Ecke.
»Als Psychiater lernt man, wenig bis nichts persönlich zu nehmen«, sagt Kadoke, »sie darf über mich singen, was immer sie will. Sie hat gern gesungen in letzter Zeit.«
»›Wenig bis nichts‹! Für mich ist es aber was Persönliches, wenn sie ihre Kindheit eine Scheißkindheit nennt und ihre Mutter eine Scheißmutter. Sie ist längst erwachsen. Muss man immer alles verstehen, beschönigen, gut finden?«
»Nicht alles. Aber wenn du die Situation jetzt mit früher vergleichst, musst du doch den Fortschritt zugeben. Kleine Schritte vorwärts, ab und zu einen Schritt zurück, das nennen wir Erfolg, das hab ich von Anfang an so gesagt. Mehr als das habe ich nie versprochen.«
Die Paprika ist zerkleinert, der Vater widmet sich jetzt den Tomaten. »Was kannst du noch für sie tun?«, fragt er. »Nicht viel, oder?«
»Sie sagt, dass sie meine Therapie nicht mehr braucht. Diese Entscheidung respektiere ich. Wir müssen nicht immer mit dem Schlimmsten rechnen.«
»Womit soll ich denn sonst rechnen?«, fragt Michettes Vater. »Jetzt ist sie bei diesem Mann, diesem Schriftsteller, ich rechne jede Sekunde mit dem Schlimmsten.«
Das weiß der Psychiater – dass der Vater ständig mit dem Schlimmsten rechnet.
Kadoke muss ihn noch um einen Gefallen bitten, es ist ihm unangenehm. »Immer mit dem Schlimmsten zu rechnen, ist vielleicht verführerisch«, sagt er, »aber wir dürfen dieser Versuchung nicht nachgeben. – Kannst du in den nächsten vierundzwanzig Stunden ein bisschen auf meine Mutter aufpassen? Michettes Arbeit kurz übernehmen, ihr die Tabletten geben, beim Essen helfen? Ich hoffe, ich verlange nicht zu viel. Morgen komme ich und hol sie. Aber ich muss zu Hause erst noch ein paar Dinge in Ordnung bringen.«
Michettes Vater legt das Messer weg, wendet sich Kadoke nun direkt zu und sagt: »Sieht so das Ende deiner alternativen Therapie aus? Mit mir als Altenpfleger für deine Mutter.« Er lächelt unbeholfen. »Vielleicht habe ich von der Therapie wirklich zu viel erwartet. Vielleicht war ich nicht realistisch. Es gab eine Zeit, als wir sämtliche Messer und Scheren und Chlorreiniger vor Michette in Sicherheit bringen mussten.«
»Ich glaube«, erwidert Kadoke, »wir erwarten ständig zu viel von Therapie, sei sie nun alternativ oder nicht. Momentan brauchst du wenigstens nichts mehr vor Michette zu verstecken.«
Der Vater zuckt mit den Schultern, gibt Öl in eine Pfanne. Kadoke hört ihn noch murmeln: »Scheißpsychiater!«
Mutters Rücktransport nach Amsterdam ist ein für alle Beteiligten einschneidendes Ereignis. Zuerst wollte Mutter gar nicht nach Zeeland, jetzt will sie nicht wieder fort, und Michettes Vater sagt: »Ich denke, es ist wohl definitiv: Michette kommt nicht zurück.«
»›Definitiv‹ vermutlich nicht«, erwidert Kadoke, »aber für längere Zeit, so lange, dass ich meine Mutter nicht hierlassen kann.«
Zum Glück hat Mutter nicht viel Gepäck. In Erwartung ihres Endes hat sie die meisten Sachen schon weggeworfen.
Schweigend fahren sie nach Amsterdam. Mutter ist eingeschnappt, und als sie am Nachmittag an ihrem vertrauten Esstisch sitzt, beginnt sie zu klagen. »Was hast du mit meinem Haus hier gemacht?«, fragt sie. »Es stinkt nach Schweißfüßen.«
»Ich rieche nichts«, erwidert Kadoke, doch nach ein paar Minuten muss er zugeben, dass tatsächlich ein merkwürdiger Geruch im Haus herrscht. »Ich werde mal richtig gut lüften«, verspricht er.
»Und dieses Durcheinander!«, fährt Mutter fort. »Als hätten hier wilde Tiere gehaust, keine Menschen.«
»Du musstest ja ziemlich Hals über Kopf zurückkommen, ich hatte nicht viel Zeit, alles wieder nach deinem Geschmack herzurichten.«
Er setzt Tee auf, sucht einen Pullover für seine Mutter gegen die Kälte. Als er zurückkommt, hat sie ihre Perücke abgenommen und die Tabletten, die vor ihr auf dem Tisch lagen, auf den Boden geschmissen.
»Was soll das?«, fragt Kadoke. »Du bist doch kein kleines Kind.«
»Es hat zu lange gedauert«, antwortet sie.
»Was?«, fragt Kadoke. »Was hat zu lange gedauert?«
»Dieser Unsinn.«
»Was für ein Unsinn?«
»Das hier«, sagt sie und zeigt auf die Perücke. »Jetzt, wo ich wieder zu Hause bin, merke ich es. Wo ist Mutter? Wo ist sie?«
»Du bist Mutter«, sagt Kadoke.
Sie schüttelt den Kopf, und der Sohn macht sich daran, die Pillen am Boden zusammenzusuchen.
»Für wen machen wir das?«, fragt sie. »Für wen veranstalten wir diese Komödie? Solange das Mädchen da war, hatte ich ein Publikum, aber jetzt, wo sie weg ist, merke ich, dass auch sie es nie richtig geglaubt hat. Warum hast du mich so lang zum Narren gehalten und mitgespielt, warum hast du mich nicht vor mir selber beschützt, mich diese Komödie aufführen lassen?«
Kadoke vermisst eine letzte Tablette. Er sucht weiter.
»Diese Farce!«, ruft Mutter. »Hörst du? Ich bin nicht Mutter. Ich will es auch nicht mehr sein. Ich kann es nicht mehr. Sie ist tot. Mausetot.« Wieder wirft sie die Tabletten auf den Boden.
Immer noch auf den Knien, nimmt Kadoke ihre Hand und sagt: »Hör auf. Ich weiß, das sind einschneidende Veränderungen für dich, aber so geht das nicht. Du kannst dich nicht aufführen wie ein rebellisches kleines Kind, Mädele. Du musst bleiben, wer du bist.«
»Aber das hier bin ich nicht!«, ruft Mutter. »Für das Mädchen war ich es, sie hat mich nie anders gekannt, aber für mich und für dich doch nicht? Sei ehrlich, warum haben wir das hier gemacht?«
»Ich konnte nicht anders«, sagt Kadoke, immer noch auf dem Boden. »Du warst so depressiv damals nach Mutters Tod. Der Schmerz hatte dich völlig gelähmt, beinah wärst du untergegangen, ich hätte alles getan, um das zu verhindern. Ich habe deinem Wunsch nachgegeben, sonst nichts.«
In fortgeschrittenem Alter hatte Kadokes Vater beschlossen, eine Frau zu werden oder besser gesagt, sich in seine verstorbene Frau zu verwandeln. Nach einigem Zögern hatte Kadoke erkannt, dass er ihn dabei unterstützen musste, und allmählich war aus dem alten Mann die alte Mutter geworden, die Komödie zur Wirklichkeit.
»Ich suche immer noch eine von deinen Entwässerungstabletten«, sagt Kadoke.
»Lass doch diese Tabletten! Ich bin nicht deine Mutter. Darüber reden wir jetzt. Deine Mutter ist tot, und ich bin dein Vater und will auch nicht mehr leben. Mach mich doch tot, bitte.«
Hatte er ihren Wunsch erfüllt oder doch nur seinen eigenen? Hätte er sie, als sie noch sein Vater war, sterben lassen sollen? Sie damals aufgeben? Kommt der Tod jetzt zu spät?«
Kadoke steht auf, streichelt der Mutter über den fast kahlen Kopf. Jetzt, ohne Perücke, aber noch immer im Kleid, bekommt das Wort »Farce« eine andere Ladung. Warum auf den Verfall herabsehen? Mit welchem Recht? Außer dem der Gesundheit, der Jugend?
»Du kennst meinen Beruf, ich darf Leute nicht totmachen, ich versuche, sie am Leben zu halten. Es gibt eine Diskussion, wann man Menschen gehen lassen muss, ich habe dazu so meine eigenen Gedanken, vielleicht sogar eine Überzeugung, obwohl ich das Wort nicht so mag, es ist mir zu kompromisslos. Wenn du das wirklich willst, können wir darüber reden, aber ich glaube nicht, dass das schon so weit ist, vor einer Woche jedenfalls wolltest du es noch nicht.«
Er kann es nicht leugnen: Mutter sieht erbärmlich aus, eine Schauspielerin in der Garderobe, im vollen Bewusstsein einer völlig missratenen Premiere.
»Da habe ich nur so getan.«
»Du hast so getan, als wolltest du leben?«
Sie nickt. »Dir zuliebe«, sagt sie mit leiser Stimme, als beichte sie ein Vergehen, »und dem Mädchen zuliebe.«
»Dann kannst du es jetzt doch auch mir zuliebe tun? Ich suche mal weiter nach der Entwässerungstablette. Kannst du mir inzwischen versprechen, nicht wieder alles auf den Boden zu schmeißen? Kannst du versuchen, nicht so zu wüten?«
»Aber ich bin wütend!«, ruft Mutter. »Das Mädchen hat mich im Stich gelassen.« Sie nimmt die Perücke und wirft sie durchs Zimmer. Für jemanden, der sterben will, steckt noch viel Leben in ihr.
»Michette ist nicht unser Eigentum«, erwidert Kadoke von unter dem Tisch, und einen Moment gibt Michettes Abwesenheit ihm einen Stich. Er hat für zwei Menschen gelebt, jetzt ist Michette weg, und Mutter will keine Mutter mehr sein, sie will sogar sterben. »Ich finde eine andere Betreuerin. Und natürlich bist du nicht zu alt für noch eine Verwandlung, das hätte ich nicht sagen dürfen. Wenn du wieder Vater sein willst, werde ich dir helfen. Vielleicht ist das für alle ja sogar einfacher. Weißt du noch, die Betreuerin damals, die es nicht aushalten konnte, dass du eine Mutter … eine Mutter mit Pimmel warst?« Er hat die Entwässerungstablette gefunden.
»Ich bin keine Mutter mit Pimmel«, ruft Mutter. »Hör auf mit dem Unsinn. Mir sind die Augen aufgegangen.«
Kadoke kommt unter dem Tisch hervor. Dort liegt dicker Staub. Er klopft ihn sich von der Hose und wischt die Tablette sauber.
»Es war eine Varieténummer, mein Junge, all die Jahre haben wir eine Varieténummer aufgeführt.«
Kadoke nimmt ihr Gesicht in die Hände. »Mutter«, sagt er. Oder sollte er Vater sagen? »Es war keine Varieténummer, wir haben es für uns getan, es gibt viele Methoden, die Toten am Leben zu halten, du hast dich für eine unübliche entschieden. Du darfst die Vergangenheit nicht als Irrtum abtun, als eine ›Nummer‹, tu dir diese Selbstquälerei doch nicht an. Die Wahrheit ist: Ich habe gesehen, wer du geworden warst, ich hatte vergessen, wer du davor warst, für mich warst du kein Mann mehr.«
Er lässt ihr Gesicht los, setzt sich ihr gegenüber, doch ihrem Blick merkt er an, dass er sie nicht überzeugt hat. Für sie ist das Leben nichts als Vernichtung, ein paar Varieténummern und ein Sohn, der vielleicht auch kaum mehr ist als solch eine Nummer.
Vier Tage später klingelt im Haus von Kadokes Mutter das Telefon, dem Haus, wo Kadoke offiziell immer noch nur vorübergehend wohnt, wo aber das Vorübergehende und das Ewige einen Bund eingegangen sind. Er ist eingeschlafen, auf dem Schoß ein Buch über Spinoza, das er von einem Kollegen bekommen hat. Mutter, inzwischen mehr und mehr Vater, liegt auf dem Sofa.
Über einen Nachbarn, dessen Frau intensiver Hilfe bedarf (zur Toilette bringen, ins Bett legen und wieder herausheben, mit ihr spazieren gehen), hat Kadoke eine vorübergehende Altenpflegerin gefunden.
Sie heißt Rianne, stammt aus Ede und ist sehr christlich-religiös, sie behauptet, heutzutage sei das exotisch, und schon bei ihrem ersten Gespräch sagte sie zu Kadoke: »Ihr seid das auserwählte Volk, und ich bin stolz darauf, Menschen aus eurem Volk zu helfen. Ich komme gerne zu euch, ich bin aktives Mitglied von ›Christen für Israel‹, jedes Quartal kaufe ich Kerzen und Seife, das geht alles als Spende in euer Land. Wenn ich so um mich herumschaue, habt ihr das Land dringend nötig.«
Kadoke fragt nicht, was sie beim Umsichherumschauen denn so alles sieht. Dass Vater längere Zeit Mutter gewesen ist, behält er ebenfalls für sich. Rianne wird es schon noch herausfinden, und anderenfalls macht es auch nichts.
Vater trägt jetzt keine Kleider und Perücken mehr, was aber nicht heißt, dass er sich wieder völlig in einen Mann zurückverwandelt hätte. Wie schon seit Jahren zwischen Leben und Tod, schwebt er jetzt zwischen Frau und Mann.
Auf seinem Handy sieht Kadoke, dass Michette angerufen hat. Als sie sich zum zweiten Mal meldet, will er sie wegdrücken, geht dann aber doch ran. Vater liegt schlafend auf dem Sofa.
»Wie geht’s?«, fragt Michette.
Er reibt sich mit dem Handrücken über die Bartstoppeln. »Was kann ich für dich tun?« Es ist keine ernsthafte Frage, er versucht, das Gespräch so sachlich wie möglich zu halten, es zu beenden, ehe es wirklich begonnen hat. Die Michette-Periode liegt hinter ihm, er hat seinen Kopf aus der Schlinge gezogen, die verbotene Therapie ist vorüber.
Eine leichte Enttäuschung konstatiert er in sich gleichwohl, als er jetzt ihre Stimme hört. Man kann seinen Psychiater im Stich lassen, das ist normal, ja vielmehr der Zweck jeder Beziehung zwischen Therapeut und Patient, doch bei jemandem, den man betreut, geht das nicht so einfach von heute auf morgen. Stellvertretend für seinen Vater fühlt Kadoke sich trotz seiner professionellen Distanz von der ehemaligen Patientin verraten. Achtlos beiseitegeschoben.
»Vielleicht möchtest du ihn kennenlernen«, sprudelt Michette ohne weitere Einleitung los, »vielleicht möchtest du lesen, was er über dich geschrieben hat, oder interessiert es dich nicht? Ich dachte, vielleicht wäre es nett, wenn du weißt, was er aus dir gemacht hat.« Sie lacht wie ein kleines Mädchen, eine Art Kichern.
Ist das Leben im Kern Egoismus? Muss, wer das Leben wirklich spüren will, seine Verantwortung und Pflichten abstreifen, und sei es nur kurz? Leben, als sei der andere nicht mehr als ein Requisit – ist das wirklich so viel einsamer, so viel schlechter als leben, als könne der andere immer und überall einen moralischen Appell an einen richten, einen Appell, dem man sich nicht verweigern darf? Für einen Moment kommt es ihm so vor, als habe Michette etwas begriffen, was er nie hat einsehen wollen.
Kadoke ändert die Sitzposition, legt die Beine auf den Tisch, nimmt sie aber sofort wieder herunter. Während Vaters Abwesenheit machte er es sich oft so gemütlich. Jetzt jedoch ist es anders, Vater ist wieder da. Auch als der noch Mutter war, ging er immer sehr schonend mit dem Mobiliar um, gerade weil es schon Jahrzehnte alt ist.
»Soll ich dir ein Stück daraus vorlesen?«, fragt sie.
Ohne auf Antwort zu warten, liest sie mit ihrer harten, durchdringenden Stimme einige Sätze vor, und Kadoke erkennt einen Dialog zwischen sich und Michette. Im Buch heißt sie Fleur. Ein Name, der nicht zu ihr passt.
»Das interessiert mich nicht«, sagt er, als sie einen Moment pausiert. »Die Therapie ist beendet. Auf deinen Wunsch.«
»Um es etwas dramatischer zu machen, hat er uns ein Verhältnis verpasst«, erwidert sie mit ungebrochenem Enthusiasmus, als habe sie ihn nicht verstanden. »Er meinte: Der Mann muss wirklich eine Grenze überschreiten, nicht nur ein bisschen. Das ist Drama, das ist Literatur. Und ich spüre, das ist seine wahre Natur, das Überschreiten von Grenzen ist seine Wahrheit.«
»Ich weiß nicht, was Literatur ist«, erklärt Kadoke, »und über meine Wahrheit will ich hier nicht diskutieren. Wie gesagt, ich habe kein Interesse.«
»Soll ich dir die Korrekturfahnen vorbeibringen? Er fände es schön, wenn du das Manuskript liest. Vielleicht entdeckst du noch ein paar Fehler, sein Psychiater soll glaubwürdig sein, sagt er. Du musst aber schnell lesen, es ist ziemlich eilig.«
Vater ist wach geworden, er atmet schwer, wälzt sich herum. Kadoke wirft einen prüfenden Blick auf ihn und antwortet: »Dann bring sie vorbei, aber wirf sie nur ein, erwarte nicht, dass ich sie korrigieren werde.« Es hört sich an, findet er selbst, wie die Pointe eines schlappen Witzes.
Er rechnet damit, dass sie weiter um ein Treffen quengelt, sich mit seinen förmlichen Antworten nicht zufriedengibt, seiner professionellen Distanz, wie sie es noch niemals getan hat, aber sie antwortet: »Okay, dann mache ich das so. Aber du fehlst mir, du Arschloch.« Ohne auf Antwort zu warten, legt sie auf.
Kadoke geht zu seinem Vater, stellt ihm Kaffee und Kekse zurecht, und während er noch dabei ist, klingelt Rianne. Sie versorgt Vater liebevoll, christlich, er kann es nicht anders nennen, und zwischendurch überreicht sie dem Sohn eine Broschüre von »Christen für Israel«. »Damit du siehst, was wir so machen. Diesmal habt ihr eine Zuflucht, diesmal könnt ihr wo hin – das hat Gott so gewollt. Dass ihr dorthin geht. Das ist Gottes Plan.«
»Ja«, sagt Kadoke und nimmt die Broschüre, obwohl er das mulmige Gefühl hat, Rianne wäre es am liebsten, er würde sich schleunigst dorthin davonmachen und nicht Gottes Plan sabotieren, indem er einfach in Amsterdam wohnen bleibt.
Als Rianne nach einer knappen halben Stunde mit Vater fertig ist, kontrolliert sie die Wochenration Tabletten aus der Apotheke, obwohl das absolut unnötig ist.
»Das hat die Apotheke doch schon haarklein gemacht«, sagt Kadoke.
Rianne wirft ihm einen ziemlich vernichtenden Blick zu: »Ich vertraue auf den Herrn, aber nicht den Apotheken – die Leute, die dort arbeiten, haben keine Ahnung. Ich spreche aus Erfahrung.«
Kadoke hält es für das Beste zu schweigen, und Rianne setzt ihre Kontrolle fort. Als sie endlich zufrieden ist, wäscht sie sich gründlich die Hände, und Kadoke begleitet sie zur Haustür.
»Lies dir die Broschüre gut durch«, sagt sie, »dann siehst du, was wir alles für euer Land tun.« Kadoke verspricht, die Informationen gründlich zu studieren. Im Flur sieht er, dass Michette das Manuskript schon eingeworfen hat. »Ich war zweimal dort«, erklärt Rianne weiter, »jetzt spare ich für meine dritte Reise. Herrlich finde ich es da. In eurem Land. Echt herrlich.«
Kadoke macht Abendessen für Vater und sich, Linsensuppe mit Würstchen, die Linsensuppe stammt aus der Dose, Vater hasst alles, was aus der Dose kommt, aber nun ja. Nach dem Essen starrt Vater vor sich hin, und der Sohn blättert durch die Fahnen, liest hastig und zunehmend verärgert. Fantasielos findet er das Ganze, die Wirklichkeit war viel nuancierter, vor allem interessanter. Im Roman heißt er »Walvisch«. Er wird als durchgedrehter Psychiater beschrieben, von dem man nicht versteht, was ihn reitet. Immer wieder greift dieser fiktive Psychiater zur Flasche. Michette wird zu einem manipulativen Lustobjekt degradiert, je länger er liest, desto mehr fühlt er sich verraten. »Verrat« ist noch untertrieben, er fühlt sich missbraucht. Er weiß nicht, vom wem er sich mehr verraten fühlt, von Michette oder dem Schriftsteller, dem sie ihre Geschichte erzählt und der seinen Roman daraus gemacht hat. Er weiß nur, dass sein Vertrauen missbraucht worden ist, dieser Walvisch wird restlos vernichtet, schändlich, wie er sich verhält, ein Mann ohne Würde. Zu guter Letzt schwängert er Fleur, was dazu führt, dass er einen Nervenzusammenbruch bekommt und in eine Anstalt muss.
Vermutlich ist dies Michettes letzter verzweifelter Versuch, seine Aufmerksamkeit zu erringen, er schließt nicht einmal aus, dass auch der Schriftsteller nur eine Schachfigur in einem sorgfältig geplanten Manöver ist, das vor allem ihn, Kadoke, treffen soll. Er pfeift den Gedanken sofort zurück. Es ist eitel und hochmütig, sich im Zentrum des Denkens und Fühlens einer Patientin zu wähnen, die gleiche Art Eitelkeit und Hochmut, die er bei seinen Kollegen verachtet.
Kadoke wirft den Stapel Papier in den Küchenmülleimer. Dass viele Dinge, rein sachlich betrachtet, stimmen – die Mutter, die eigentlich ein Vater ist, das Hotel in Zeeland, die alternative Therapie –, verstärkt das Gefühl, missbraucht worden zu sein. Vom Lesen ist ihm schlecht geworden. Er legt sich ins Bett und beschließt, unterdrückt wütend diesmal, dass das Kapitel Michette ein für alle Mal abgeschlossen ist. Das war es. Der Fehltritt war gestern, heute beginnt der Rest seines Lebens.