Sabine Hofmann
Trümmerland
Roman
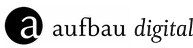
Martha lebt mit ihrer zwölfjährigen Tochter Hella und ihrer Einquartierung Edith, einer schillernden jungen Frau, in einem Bochumer Arbeiterviertel. In den Ruinen einer Zeche stößt Hella eines Abends auf einen Sterbenden. Sie drückt ihm die Augen zu und nimmt seinen Mantel an sich, in dem sie wenig später kostbare Bezugsscheine für Butter entdeckt. Martha und Edith beschließen, einen Butterhandel aufziehen, damit geraten die Frauen schnell in die Bredouille. Auf der einen Seite beginnen Mordermittlungen und die polizeiliche Schwarzmarktbekämpfung rückt ihnen gefährlich nahe, auf der anderen Seite geraten sie in das Visier von Schiebern und Kriegsverbrechern. Nachdem Edith nur knapp einer Polizeikontrolle entgangen ist, verkaufen die beiden Frauen die Butterscheine an den Schwarzmarktkönig Kasulke, um sich die heiße Ware vom Hals zu schaffen. Doch damit sind sie nicht aus dem Schneider. Denn bald darauf wird Hella bedroht, und Kasulke und dessen Gehilfe werden ermordet.
Sabine Hofmann wurde 1964 in Bochum geboren und studierte Romanistik und Germanistik. Gemeinsam mit Rosa Ribas schrieb sie drei Kriminalromane über die Nachkriegszeit im Spanien. Zurzeit fasziniert sie die Beschäftigung mit der deutschen Nachkriegszeit als Bodensatz ihrer Kindheitserinnerungen – der Geschichten und Erlebnisse von Eltern, Großeltern, die ihre eigene Kindheit prägten. Sie lebt mit Mann, Kind und Kater in Erbach im Odenwald.
Sabine Hofmann
Trümmerland
Roman
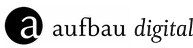
Freitag, 9. März 1946
Wenigstens ließ sich heute der Mond blicken. Fett, rund und silbern pappte er am Himmel über dem abgeknickten Gerüst des Förderturms und beleuchtete das Zechengelände. Das Förderrad hing schon seit dem ersten Bombenangriff auf halb acht, vor dem milchigen Himmel sah es aus wie ausgestanzt. Die oberen Fenster im Verwaltungsgebäude waren scharf geränderte, helle Löcher, weil Dach und Rückwand weg waren und der Mond direkt durch die Fensteröffnungen schien.
Der helle Schein war günstig. Das Trümmerfeld und der Pfad zwischen den Schuttbergen waren bestens zu sehen. Die Schatten dagegen waren kohlrabenschwarz. Das war auch günstig, so konnte ihn niemand entdecken, wie er da in seinem Versteck in der dicksten Schwärze hockte. Von dem Schuppen war auch nur noch die Hälfte übrig, aber in dem Winkel zwischen den letzten beiden Mauern war er für jeden unsichtbar, der den Pfad entlangkam.
Der Vollmond erinnerte ihn immer an das Zweimarkstück, das er von seinem Großvater zu jedem Geburtstag bekommen hatte. Früher, als er noch klein war. Ein silbriges Geldstück mit dem Bild eines alten pausbäckigen Mannes auf der Rückseite.
»Lass doch den Hindenburg, den ollen Döskopp, der hat uns den ganzen Schlamassel eingebrockt«, hatte die Großmutter jedes Mal geknurrt, wenn er das Geldstück drehte und wendete, damit es im Licht der Lampe blinkte. Dabei hatte sie das Gesicht in tausend Falten verzogen, dass es aussah wie ein Stück zerknülltes Butterbrotpapier, und gesagt, dass das Kroppzeug, das heute regierte, noch viel schlimmer wäre, und der Großvater hatte gesagt, dass sie still sein solle, wegen der Nachbarn.
Die Großeltern hatte es bei einem Luftangriff erwischt. Luftmine, Volltreffer. Aus die Maus. Nach der Entwarnung war er mit seiner Mutter und seiner Schwester aus dem Luftschutzkeller gekommen. Sie freuten sich, dass die Häuser in ihrer Straße alle noch standen. Aber das Viertel am Güterbahnhof, wo die Großeltern wohnten, hatte einiges abbekommen. »Die ham ihre Bomben auf die Bahngleise geschmissen«, erklärte ein Nachbar. »Is aber ’ne ganze Menge danebengegangen.«
Seine Mutter packte ihn und seine kleine Schwester, und sie liefen los, die Mutter vorneweg, Emil knapp neben ihr. Die Kleine zerrte sie an der Hand den ganzen Weg über hinter sich her. Sie hetzten in einem Affenzahn durch die Stadt, überall waren Leute unterwegs. Viele von ihnen rannten auch, weil sie nach jemandem suchten oder weg von den einstürzenden Häusern und den Feuern wollten, die an vielen Stellen noch loderten. In manchen Straßen sah es aus wie in einem Möbelgeschäft. Die Leute hatten Matratzen und Stühle aus ihren brennenden Häusern geholt und auf der Straße abgestellt. Ein älterer Mann saß im Schlafanzug in einem grünen Ohrensessel neben den Straßenbahnschienen in der Bongardstraße und schaute sich mit weit aufgerissenen Augen die kaputte Stadt an. »Kann doch allet nich’ wahr sein«, murmelte er.
In der Rottstraße war das Gemisch aus Rauch und Mörtelstaub so dicht, dass das Atmen wehtat und sie kaum was sahen. Dafür war der Krach umso lauter. Das Martinshorn des Rettungswagens, Leute, die sich etwas zuriefen, eine alte Frau, die direkt neben ihnen irgendwas auf Polnisch betete. Zumindest hörte es sich so an wie ein Gebet, leiernd und immer wieder dasselbe.
Da, wo das Haus der Großeltern gestanden hatte, war nur noch ein Trümmerhaufen. Die vordere Seite des Hauses war weggerissen, Mauern und Balken waren hinuntergekracht, aber die Rückwand des Hauses stand noch. Im ersten Stock konnte er die Wohnzimmertapete mit den braun-beigen Blumen und sogar das Foto von Opas Fußballmannschaft sehen, als ein Windstoß für einen Augenblick den Staub und den Rauch wegblies.
Die Großeltern waren nicht aufzufinden. Die Mutter fragte die Nachbarn, laut und mit schriller Stimme, doch keiner hatte sie gesehen, weder im Luftschutzkeller noch auf der Straße. Schließlich war er es, der den Großvater fand. Nicht den ganzen Großvater. Nur einen seiner karierten Pantoffeln und die papierweißen Füße mit den blauen Adern. Sie guckten unter einem Haufen aus Dachpfannen, Backsteinen und Holz hervor und sahen in dem ganzen Durcheinander merkwürdig heil aus. Seine kleine Schwester steckte den Kopf in die Rockfalten seiner Mutter und heulte wie ein Schlosshund. Er kniete sich hin, um seinem Großvater den runtergefallenen Pantoffel über den Fuß zu ziehen. Seine Mutter fauchte ihn an: »Hör auf zu flennen, den braucht er jetzt nicht mehr, du Blödmann.«
Er war damals schon alt genug gewesen, um zu kapieren, dass Erwachsene wütend wurden, wenn sie nicht mehr weiterwussten.
Die Großeltern waren nun seit drei Jahren tot, und die Geldstücke, die früher so schön geblinkt hatten, waren kaum was wert. Auf dem Schwarzmarkt bekam man dafür nicht einmal eine Scheibe Brot. Er selbst war ein ganzes Stück größer geworden und fand, dass er mit seinen sechzehn Jahren jetzt auch erwachsen war.
Er zog die Decke, die er sich mitgebracht hatte, fester um sich. Langsam wurde es kalt.
Die Stelle, die er sich am Nachmittag ausgeguckt hatte, war wirklich nicht übel, nah bei dem Trampelpfad und weit entfernt von den unübersichtlichen Zechengebäuden mit ihren tiefen Schatten. Und er hatte im Blick, was ihn interessierte: den Pfad und vor allem den Eingang in den Luftschacht, den er vor zwei Wochen mit Büschen und Gestrüpp getarnt hatte.
Noch tat sich nichts, das Trümmerfeld lag still da. Er sah zu den Zechengebäuden hinüber, wo der Pfad begann. Das größte, die Kohlenwäsche, hatte einen Volltreffer abbekommen. In der Mitte des Gebäudes klaffte ein breiter Riss, eine riesige Zacke, die jetzt hell vom Mondlicht war. Wenn er die Augen zusammenkniff, konnte er durch die Zacke hindurch die Umrisse des Stahlwerks auf der anderen Seite der Gleise sehen.
Auf dem Pfad bewegte sich jemand und kam in seine Richtung. Der nächtliche Besucher tappte im dunklen Schatten eines Schuttbergs und war kaum auszumachen. Erkennen konnte Emil ihn erst, als er wieder in einen der vom Mond beleuchteten Flecken gelangte. Es war einer von den beiden Männern, die ihm vor zwei Tagen nachgegangen waren. Ein großer Kerl, sicher fast einen Kopf größer als er selbst. Breite, kräftige Schultern, auch wenn sie ein bisschen nach vorn hingen. Kurz geschorene Haare. Auf dem Rücken trug er einen Rucksack.
Der Mann blieb stehen und begann sich langsam um die eigene Achse zu drehen, den Kopf nach vorne gestreckt, als wolle er sich nicht die geringste Kleinigkeit entgehen lassen. In der Hand hielt er eine Eisenstange.
Emil hielt unwillkürlich die Luft an und drückte sich an die Wand des Schuppens, auch wenn er sich im selben Augenblick sagte, dass er im Dunkeln so gut wie unsichtbar war.
Der Mann blickte jetzt in seine Richtung. Emil senkte die Lider, damit das Weiß seiner Augäpfel nicht in einem verirrten Lichtstrahl aufblitzte. Als er die Augen wieder öffnete, sah er, dass der Kerl sich erneut in Bewegung gesetzt hatte, Ziegelstaub knirschte unter seinen Schritten.
Dann tat er genau das, was Emil befürchtet hatte. Er steuerte auf den Schuppen zu. Dreh um, dachte Emil. Du hast dich geirrt. Es ist nicht hier. Doch das half nichts, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, der Mann kam schnurstracks auf ihn zu.
Ohne zu zögern, ging er an ihm vorbei. So nah, dass Emil sich nur ein bisschen hätte strecken müssen, um ihm ein Bein zu stellen. Er nahm Kurs auf den Einstieg zum Luftschacht und kniete sich dort nieder. Emil reckte sich, um zu sehen, was er tat. Der Mann schob das dürre Gestrüpp beiseite.
Es stimmte also. Sie hatten ihn doch beobachtet und den Einstieg gefunden.
Die gemauerte Öffnung lag nackt im Mondlicht, der Mann setzte sich auf den Mauerrand und schaute hinein. Dann langte er in seinen Rucksack und holte eine Taschenlampe hervor. Er leuchtete in den Schacht hinunter und schaltete das Licht wieder aus. Richtig, dachte Emil. Kein flackerndes Licht auf dem Gelände, sonst hast du bald die Bullen von der Schwarzmarktbekämpfung oder eine Patrouille der Militärpolizei am Hals. Der Mann hängte sich die Lampe um, schob seinen Körper über den Rand und verschwand im Schacht.
Wenn er irgendwas Schweres über den Eingang schieben würde, damit der Kerl dort ein für alle Mal auf Nimmerwiedersehen verschwand? Etwas Schweres, das den Schacht abdeckte. Klappe zu, Affe tot. Und er wäre ihn für immer los. Aus die Maus. Doch das war Unsinn. Bis er etwas gefunden hätte, um den Schacht dicht zu machen, und es auf die Öffnung gewuchtet hätte, wäre der Kerl längst herausgeklettert. Außerdem würde das sein Problem nicht wirklich lösen, weil der Mann im Schacht noch einen Kumpel hatte.
Emil stand auf und streckte sich. Im Grunde hatte er genug gesehen. Genug, um zu wissen, dass er richtiglag. Dummerweise richtiglag.
Er bewegte die starren Beine und sah hinüber zur Gussstahlfabrik. Aus ein paar Schloten kam Qualm, und den Lärm des Hammerwerks konnte er bis hierher hören. Seit Kurzem wurde dort wieder gearbeitet. Wer jahrelang da malochte, schlurfte jeden Abend todmüde nach Hause. Grau im Gesicht und im Kopf dumpf und taub, weil der Hammer im Kopf weiterdröhnte, und nach ein paar Jahren ging die Schwerhörigkeit nicht mehr weg. Aber nicht mit ihm. Er würde einen Teufel tun und da schuften wie blöd. Nicht mit ihm. Er hatte etwas anderes vor. Und das würde ihm der Kerl im Schacht nicht vermasseln. Er musste sich bloß etwas einfallen lassen.
Ein wenig später tauchte der Kopf des Mannes wieder über der Öffnung auf. Er kletterte hinaus. Wie Emil befürchtet hatte, trug er etwas. Etwas Schweres. Etwas, das ihm gehörte. Emil biss sich auf die Lippen, um nicht laut zu fluchen.
Dienstag, 12. März 1946
Vom Pfad aus war der Körper in der Senke nicht zu sehen. Hella hätte ihn auch nicht entdeckt, wenn sie nicht auf der Suche nach Trümmerholz auf dem Gelände der Zeche herumgeklettert und nah an den Rand des Bombentrichters herangekommen wäre.
Die Zeche war gleich beim ersten Angriff getroffen worden. Die meisten Gebäude waren zerstört, und es war gefährlich, sich dort zu bewegen. Weil immer noch etwas einstürzen konnte und weil sich merkwürdige Leute da herumtrieben. Gesocks, sagte Hellas Mutter. Zwielichtige Gestalten, sagte Edith. Aber wenn sie mutig war und sich geschickt anstellte, konnte sie aus den zerstörten Gebäuden mit ihren wackeligen Wänden und brüchigen Fußböden das eine oder andere herausholen. Sie musste nur vorsichtig genug über frei liegende Eisenträger und Rohre balancieren und aufpassen, wohin sie trat, damit sie keine bröseligen Mauerstücke oder kaputte Balken erwischte. Auch wenn es verboten war und ihre Mutter regelmäßig schimpfte, wenn sie ihre Funde zu Hause auf den Küchentisch legte. Schimpfte und sich dann doch freute über das Holz, die Kohlen oder ein Stück Teerpappe. Manchmal strich sie ihr schnell über die Zöpfe, um dann wieder in einem ihrer Kochtöpfe herumzurühren oder Gemüse zu schälen.
Was Hella fand, behielten sie, oder sie tauschten es ein, wenn sie es nicht brauchen konnten. Viel bekamen sie nicht dafür. Ein paar Steckrüben, zwei oder drei Hände voll Mehl. »Aber immerhin«, sagte ihre Mutter dazu. »Immerhin.«
Der Mann in dem Bombentrichter lag auf dem Rücken, das eine Bein war merkwürdig nach außen verdreht, und der rechte Arm hing quer über der Brust. Die Füße ragten in die trübe Pfütze am Grund des Bombentrichters.
Hella blickte vom Rand der Mulde auf ihn hinab. Wahrscheinlich war er ausgeglitten und gefallen. Die dicken Leitungsrohre, die an manchen Stellen über das Gelände liefen, ließen sich prima als Wege benutzen. Es war weitaus einfacher, auf ihnen entlangzulaufen, die Arme zur Seite ausgestreckt wie ein Seiltänzer, als über die Schuttberge zu klettern. Allerdings waren sie auch tückisch. Bei Regen wurden sie rutschig. Gerade auf der anderen Seite des Kraters lag eine solche Rohrleitung.
Der Mann öffnete die Augen und versuchte den Kopf zu heben. Hella hatte das Gefühl, dass sein Blick wie der Lichtkegel eines Scheinwerfers direkt auf sie fiel. Sie drehte sich um, weil sie hoffte, dass er jemanden neben oder hinter ihr ansah. Doch dort war niemand. Sie war gemeint.
Er bewegte die Lippen. Was er sagte, konnte Hella nicht verstehen, doch seinem Gesichtsausdruck nach schien er sie um Hilfe zu bitten. Oder war das eine Falle? Vielleicht würde er ihr eins über den Kopf geben, sobald sie nah genug herangekommen wäre. Oder ihr etwas antun, wie die erwachsenen Frauen immer sagten und dabei die Stimme senkten. Doch das war Quatsch. Wenn er jemandem eine Falle stellen wollte, würde er sich nicht in einen Bombenkrater weitab vom Pfad legen und stundenlang darauf warten, dass irgendjemand vorbeikam, der auf seinen Trick hereinfiel.
Sicherheitshalber überprüfte sie, ob die mit Sand gefüllte Socke noch in ihrer Anoraktasche steckte. Sie betastete das gestrickte Gewebe und schob den Sand darin mit dem Daumen hin und her. Dann kletterte sie vorsichtig hinunter und hockte sich neben den Mann.
Ein dünner Faden Blut war aus seinem Mund gelaufen und hatte einen hellroten Strich auf das glatt rasierte Kinn gezeichnet. Der Mann fing wieder an zu sprechen, doch sie konnte nichts anderes als das stockende Röcheln hören, das Blasen aus trüber Spucke auf seine Lippen trieb. Hella beugte sich zu ihm hinab. Er schien sich anzustrengen. Die Lippen verzogen sich, aus seinem Mund kam ein Zischen. Hella neigte ihren Kopf so weit hinunter, dass ihr Ohr fast seinen Mund berührte und sie die schwachen Atemstöße an ihrer Ohrmuschel spürte. Warme, eilige Atemstöße. Aus dem Atmen wurde ein Gurgeln, und Hella hob den Kopf. Sie sah, dass die Blasen um seinen Mund herum mehr geworden waren. Er gurgelte noch einmal, dann hörte er auf zu atmen, und seine blauen Augen starrten in den Himmel über ihm.
Hella schluckte. Es war nicht das erste Mal, dass sie sah, wie jemand starb. Der Erste war einer von den Leuten aus dem Lager gewesen, die in ihrem Viertel Bomben entschärfen mussten. Es war ein älterer Mann, er hatte sich plötzlich an die Brust gegriffen und war in seinem gestreiften Anzug, der aussah wie ein Schlafanzug, zusammengesackt. Einer der Aufseher, die den Trupp aus dem Lager begleitet hatten, hatte versucht, ihn mit Schlägen und Tritten wieder zum Aufstehen zu bewegen, aber das hatte nicht geklappt. Der Mann war einfach liegen geblieben. Am Ende hatten seine Kollegen ihn hochgehoben und eilends weggetragen, während die beiden Aufseher die Passanten verscheuchten.
Die andere Tote war Tante Bertha gewesen. Sie hatte in der Wohnung über ihnen gewohnt und war die Schwester ihrer Großmutter. Tante Bertha war krank gewesen, und eines Morgens hatte sie tot im Bett gelegen. Hellas Mutter hatte der Tante die Augen geschlossen, das Kinn mit einem Tuch hochgebunden und sie gewaschen. »Der letzte Liebesdienst, weißt du«, hatte sie Hella erklärt.
Vermutlich sollte sie dem Mann jetzt zumindest die Augen zudrücken, dachte Hella, auch wenn sie ihn nicht kannte. Doch dafür würde sie ihn anfassen müssen.
Sie trat einen Schritt zurück und betrachtete ihn. Er schien nicht besonders alt zu sein, sein Gesicht war glatt, und bevor er den Trichter hinuntergerutscht war, mussten seine hellbraunen Haare ordentlich gekämmt gewesen sein.
Die Kleidung dagegen sah alles andere als ordentlich aus, das Hemd hing aus der Hose, die Sachen waren lehmverschmiert, es waren jedoch neue, gute Sachen. Sie waren noch nicht einmal geflickt, soweit sie sehen konnte.
Hella beugte sich zu ihm herab und lauschte. Sie hörte keine Atemgeräusche mehr, sein Brustkorb bewegte sich nicht, und selbst die Härchen in seinen Nasenlöchern standen still.
Sie richtete sich für einen Moment auf und blickte sich um. Sie sah die Ränder des Trichters, die Reste der Zechengebäude und was von dem Förderturm noch übrig geblieben war. Einen kurzen Moment dachte sie daran, Hilfe zu holen.
Neben dem Toten lag ein Mantel. Hella vermutete, dass er ihn ausgezogen hatte, weil es ihm zu warm geworden war. Der Mantel war aus einem weichen Stoff, beim genauen Hinschauen konnte sie die flaumigen Fasern entdecken, die da und dort aus dem Gewebe herausstachen. Sie streckte die Hand aus und berührte den Stoff. Er fühlte sich an, wie er aussah: weich, dicht und warm.
Der Mantel gehörte dem Toten, so viel war klar. Ihn mitzunehmen hieß, den Toten zu bestehlen. Andererseits brauchte der Mann den Mantel nicht mehr. Vermissen würde er ihn nicht.
Ihre Mutter könnte daraus einen Mantel oder eine Jacke für sie nähen. Der aus einer alten Zeltbahn geschneiderte Anorak war ihr an den Ärmeln schon längst zu kurz, und im Winter hatte sie trotz der zwei Wollpullover darunter gefroren.
Ob der Tote wohl ein Kind hatte? Oder eine Frau? Eine Frau, die den Mantel auch umnähen konnte. Oder eintauschen konnte. Hella warf einen Blick auf seine Hände. Keine Ringe. Keine Frau, keine Verlobte.
Sie selbst könnten den Mantel auch tauschen. Gegen irgendetwas zu essen. Etwas, was sie lange nicht mehr gehabt hatten. Mehl, das nicht dumpf und muffig roch oder in dem Würmer herumkrochen, die ihre Mutter heraussieben musste. Oder Kartoffeln. Gelbe Kartoffeln ohne die schwarz gefaulten Stellen, die man eigentlich nicht essen sollte, aber die sie doch aßen, weil sie Hunger hatten. Ganz viele Kartoffeln, dachte Hella, so viele, dass man erst einmal glaubte, es wären genug für immer.
Der Mantel lag zur Hälfte unter dem Mann. Sie müsste ihn etwas hochheben, um ihn mitnehmen zu können.
Sie sah dem Toten wieder ins Gesicht.
»Tausch«, sagte sie. »Ich schließe dir die Augen und falte dir die Hände, und du gibst mir deinen Mantel. Du brauchst ihn ja nicht mehr. Oder?«
Hella zog ihm mit dem Daumen die Lider über die Augäpfel, sie fühlten sich weich und warm an, wie ein Stück Fensterleder, das man lange in der Hand gehalten hat.
Dann packte sie den Mann an Schulter und Hüfte und rollte ihn auf die Seite. Sie bemühte sich, nicht besonders genau hinzuschauen. Die Wunde, die der Tote an der rechten Schläfe hatte, sah sie trotzdem. Er schien tatsächlich gefallen zu sein, hatte sich den Kopf angeschlagen und war anschließend wohl in den Bombentrichter gerutscht.
Sie ließ den Toten wieder auf seinen Rücken sinken, faltete ihm die Hände und rückte sie auf seiner Brust zurecht, bis sie in der Mitte lagen. Tausch ist Tausch.
Sie warf ihm noch einen prüfenden Blick zu, bevor sie ihren Anorak öffnete und sich den Mantel um den Leib wickelte. Wenn man etwas hatte, das gut und teuer war, sollte man es nicht unbedingt zeigen. Wenn man es zeigte, konnte es ziemlich schnell wieder futsch sein.
Die Knöpfe ließen sich kaum schließen. Diesmal war es ein Vorteil, dachte Hella, dass sie ziemlich dünn war, nix auf den Rippen hatte, wie ihre Mutter immer sagte.
Sie kletterte den Rand des Bombentrichters hoch. Oben angekommen, stieg sie auf die Eisenleitung und schaute noch einmal zurück auf den Toten, der mit seinen gefalteten Händen dalag wie das tote Schneewittchen im Sarg.
Ihr Blick fiel auf die Schuhe, die in der Pfütze lagen. Sie waren zwar triefnass, aber sie sahen neu aus. Neue Schuhe waren eine Seltenheit, kaum jemand besaß welche. Allerdings wäre es gegen die Abmachung. Von Schuhen war nicht die Rede gewesen. Tausch ist Tausch, dachte Hella und machte sich auf den Weg nach Hause.
Dienstag, 12. März 1946
Martha deckte den Tisch. Teller, Löffel. Ihr müder Kopf gab ihrem ebenso müden Körper Befehle. Brot. Brotmesser. Wo war das Brotmesser? In der Schublade, wo es hingehörte. Martha holte es hervor und kniff die Augen zusammen, um Maß zu nehmen. Dünne Scheiben, nicht zu dünn, sonst kriegte man sofort wieder Hunger. Einen halben Finger breit, nicht mehr und nicht weniger. Sie blickte auf ihren kleinen Finger, mit dem sie Maß genommen hatte. Der Nagel war rissig und die Haut rot, Staub und Schmutz hatten sich so tief in die Fingerrillen gegraben, dass sie auch mit Schrubben nicht mehr weggingen. Nicht gerade schön, dachte sie. Aber immerhin sorgten die Hände schon seit einigen Jahren für sie und Hella.
Heute hatte sie Glück gehabt. In der Bäckerei hatte es gerade eine Lieferung Brot gegeben, wie meistens am Dienstag. Die Schlange davor war noch nicht sehr lang gewesen, so dass die Gefahr, nach zwei Stunden Warterei leer auszugehen, nicht allzu groß war. Also hatte sie sich angestellt, eine gute Stunde in der Märzsonne gewartet, die Lebensmittelmarken über die Theke gereicht und einen halben Laib in Empfang genommen.
Sie hob das Brot hoch und schnupperte daran. Es roch nicht so wie früher, und es gab nicht nach, wenn man mit dem Handballen draufdrückte. Das lag daran, dass sie Maismehl in den Teig mischten, manchmal auch Sägespäne. Doch es war Brot, und sie konnte froh sein, dass sie es ergattert hatte.
Sie schnitt drei Scheiben ab und schlug den Rest in ein Tuch ein. Eine Scheibe für jede, nicht mehr, und Brennnesselsuppe, um den Magen zu füllen.
Martha ließ sich auf einen der Küchenstühle sinken und legte die schmerzenden Füße auf einen anderen. Kaum saß sie, fielen ihr die Augen zu.
Einen Augenblick später schreckte sie hoch, weil ihr der Kopf in einer schweren Bewegung auf die Brust gesackt war. Im selben Moment hörte sie, dass eine Klinke heruntergedrückt wurde und die Tür zur Wohnküche sich hinter ihrem Rücken öffnete. Sie wandte sich um. Hella war nach Hause gekommen.
»Tag, Mama.«
Martha rieb sich die Augen und blickte ihre Tochter an. Das Kind sah aus wie eine kleine Tonne, der Anorak war kurz davor aufzuspringen.
»Guck mal, was ich gefunden habe.«
Das Mädchen nestelte an den Knöpfen seines Anoraks. Einer war verloren gegangen, und Edith, die bei solchen Sachen geschickt war, hatte eine Eichel mit Stoff überzogen und den abhandengekommenen Knopf ersetzt.
Hella wickelte sich ein Kleidungsstück ab, das sie um die Körpermitte geschlungen hatte.
»Der Stoff ist ganz weich. Weich und warm. Ich hab’ mich fast totgeschwitzt.«
Das Kleidungsstück aus dunkelgrauem Wollstoff, das Hella nun ausbreitete und über die Rückenlehne eines Küchenstuhls legte, entpuppte sich als ein kurzer Herrenmantel.
»Wo hast du den denn her?«
»Gefunden. In den Trümmern. Auf dem Zechengelände.«
In den Trümmern lagen keine Kleidungsstücke herum. Außerdem hatte Hella auf dem Zechengelände nichts verloren.
»Ich hab’ dir doch gesagt, dass du dich da nicht rumtreiben sollst.«
Martha hörte selbst, wie müde sie klang. Hella suchte in den Trümmern nach allem, was man verwerten konnte. Sie hatte es ihr tausendmal verboten, denn Plündern stand unter Strafe, zudem war es in den Ruinen gefährlich.
Andererseits erschien Hella oft mit einem brauchbaren Stück. Den Kochtopf mit der Delle, in dem jetzt die Suppe köchelte, hatte Hella angeschleppt. Und häufig kam sie mit Holz, das aus zerstörten Schuppen, Fensterrahmen oder Verschlägen stammte.
Hella verdrehte die Augen.
»Ja, ich weiß. Aber ich wollte Trümmerholz suchen, und Klara hat gesagt, dass kürzlich eine Wand abgesackt ist und man leichter an einen Schuppen kommt, wo noch was zu holen ist. Man muss nur mutig und geschickt sein.«
Martha verkniff sich den Hinweis darauf, dass absackende Wände genau das waren, was die Ruinen gefährlich machten. Stattdessen fragte sie: »Wo hast du den Mantel denn« – sie machte eine Pause – »gefunden?«
Hella kam nicht dazu zu antworten. Die Küchentür, die auch gleichzeitig ihre Wohnungstür war, öffnete sich. Edith kam. Sie warf Hella und Martha eine Kusshand zu, schnupperte und ging zum Herd.
»Oh, Brennnesselsuppe!«
Edith betrat jeden Raum, als wäre er eine Bühne. Martha, für die jeder Raum ein Ort war, an dem sie Dinge in Ordnung bringen musste – flicken, aufräumen, reparieren, sauber machen –, gingen Ediths Auftritte auf die Nerven, gleichzeitig gefielen sie ihr aber auch. Sie waren unnütz, leicht und ein hauchdünner Luxus, wie eine Seidenschleife, die man sich gebügelt ins Haar band, wo doch eine einfache Gummiflitsche ausreichte.
Noch im Mantel hob Edith den Topfdeckel hoch.
»Brennnesselsuppe. Gesund und nahrhaft.«
Edith sah wie meistens elegant aus. Unter ihrem Mantel, den sie nun aufknöpfte, kam ein Kleid hervor, genäht aus einem Posten Fallschirmseide, den sie wer weiß wo aufgetrieben hatte. Ihre Schuhe, die sie beim Hereinkommen achtlos neben der Küchentür abgestreift hatte, so dass der eine auf dem Spann des anderen balancierte, hatten schief gelaufene Absätze, doch sie glänzten dank einer Mischung aus Kohlenstaub und Getriebeöl, die sie anstelle von Schuhcreme verwendete. Auf ihren sorgfältig ondulierten Locken saß ein Hütchen, das so aussah, als wollte es jeden Moment herunterfallen. Dass es das nicht tat, lag an den Hutnadeln, die Edith gerade vor dem Spiegel herauszog.
Edith hatte im letzten Februar mit einem Papier des Wohnungsamtes vor ihrer Tür gestanden. Sie war Anfang 45 aus Ostpreußen gekommen und hatte nach Verwandten in Bochum gesucht. Was sie gefunden hatte, war ein zerbombtes Haus und ein geplünderter Keller. Keiner der Nachbarn hatte ihr sagen können, was aus ihren Leuten geworden war.
Martha hatte sehr gut gewusst, dass eine Wohnung wie ihre – bis auf ein paar zersprungene Fensterscheiben zum Hof hin heil, Wohnküche, ein Zimmer, eine Kammer, Toilette im Haus, aber einen halben Stock tiefer – in diesen Tagen für zwei Personen viel war und sie daher um eine Einquartierung nicht herumkommen würde. Das Wohnungsamt verteilte die Ausgebombten und die Flüchtlinge aus dem Osten auf Wohnungen in den noch übrig gebliebenen Häusern. Man konnte froh sein, wenn man mit den neuen Mitbewohnern halbwegs zurechtkam. Wenn sie keine Krankheiten einschleppten. Oder die halbe Nacht schrien, weil sie irgendetwas nicht vergessen konnten. Edith hatte keine Krankheiten, soweit sie sehen konnte, und sie schrie auch nicht in der Nacht.
Edith hatte damals in der Tür gestanden, ihr die Einweisung gezeigt, freundlich gelächelt und auf einen Sack zu ihren Füßen gedeutet. Ohne ihr Lächeln zu erwidern, war Martha beiseitegetreten, um sie hereinzulassen. Edith hatte den Sack in die Küche geschleppt. Sie hatte sich vor den Herd gekniet, ihre feinen Handschuhe ausgezogen und den Inhalt des Sacks in die Kohlenkiste geschüttet. Ein ganzer Schwung Eierkohlen war aus dem Sack gerumpelt und hatte die leere Kiste zur Hälfte gefüllt.
Anschließend hatte sie das Päckchen Zucker aus der Tasche gezogen, ein Viertelpfund Zucker. Martha hatte genickt, als ob sie noch etwas zu bestimmen gehabt hätte.
Seit etwas über einem Jahr wohnten sie jetzt zu dritt. Edith war in die Kammer gezogen, in der Hella geschlafen hatte, und Hella hatte sich im Ehebett ihrer Mutter einquartiert. Eine Seite stand leer, seit Karl eingezogen worden war. Karl hatte lange behauptet, dass er sicher nie an der Reihe sein würde. Kriegswichtiger Betrieb, schließlich machten sie Radsätze für Lokomotiven und Waggons, die dringend gebraucht wurden, Räder sollen rollen für den Sieg. 42 war er dann doch dran gewesen. Ostfront. Jetzt war er irgendwo in Russland, der letzte Feldpostbrief war im Februar 44 aus Odessa gekommen. Ob er noch lebte, wusste Martha nicht. Für gewöhnlich vermied sie es, darüber nachzudenken.
Im Laufe der Zeit fand sie heraus, dass sie es im Großen und Ganzen mit Edith nicht schlecht getroffen hatten. Sie beteiligte sich zuverlässig an den Kosten des Haushalts, sie war ruhig, las in den Büchern, die sie in ihrem Koffer mitgebracht hatte. Einen Teil ihrer Miete bezahlte sie in Lebensmitteln, die sie irgendwie organisierte.
Edith setzte den Topfdeckel wieder auf den Topf.
»Brennnesselsuppe! Lange nicht mehr gegessen!«
Hella lachte.
»Ja, wahnsinnig lange. Seit gestern Abend nicht mehr!«
Edith hob theatralisch die Hände zur Decke.
»Himmel, vierundzwanzig Stunden ohne Brennnesselsuppe!«
Sie hängte ihren Mantel an den Kleiderhaken der Tür und drehte sich schwungvoll wieder zu ihnen um.
»Was ist das? Habt ihr Besuch?«
Sie hatte den Herrenmantel entdeckt.
»Hella hat ihn mitgebracht. Aus den Trümmern.«
Noch während sie den Satz aussprach, fragte sich Martha wieder, woher Hella den Mantel hatte. Gestohlen? Eingetauscht? Hella hatte nichts zum Tauschen. Außer – Martha dachte kurz an die dreizehn-, vierzehnjährigen Mädchen, die sich am Bahnhof herumdrückten, die Lippen rot angemalt, Wimpern und Augenbrauen mit Kohle geschwärzt. Sie warf einen Blick auf Hella mit ihren geflochtenen Zöpfen und ihrem Strickpullover mit dem Norwegermuster. An Ärmel und Bund hatte sie noch einige Zentimeter mit einer andersfarbigen Wolle angestrickt, weil das Mädchen in die Höhe schoss und die zahnstocherdünnen Arme und Beine immer länger wurden.
»Ich habe ihn bei jemandem gefunden und ihn mitgenommen.«
»Du hast jemandem den Mantel weggenommen?«
Martha sah ihre zwölfjährige Tochter verblüfft an.
»Und er hat dich gewähren lassen?«
»Er konnte ja nichts mehr dagegen machen.«
Hella erzählte von dem Toten.
»Er ist wahrscheinlich gefallen und hat sich den Kopf aufgehauen. Er wollte mir noch was sagen, aber das habe ich nicht verstanden. Dann ist er gestorben.«
Das Kind sprach gelassen. Fast geschäftsmäßig, dachte Martha.
»Weißt du, ich habe den Mantel genommen und ihm dafür die Augen geschlossen. Und die Hände gefaltet. Ein Tausch. Er braucht den doch sowieso nicht mehr.«
Martha wischte sich erschöpft über die Stirn. Man nahm sich, was man brauchen konnte. Kochgeschirr aus einer ausgebombten Wohnung, ohne lange zu fragen, ob die Eigentümer eines Tages zurückkommen würden. Die Kartoffeln aus einem verlassenen Schrebergarten. Die Kaninchen, die den Bombenangriff überlebt hatten, bei dem ihre Besitzer gestorben waren. Man nahm seinen Anteil, wenn die Jungen hinter dem Gussstahlwerk auf die Waggons der Güterzüge kletterten und die Kohlen herabwarfen, damit andere Kinder sie aufsammeln konnten. Man nahm einem Dreijährigen, der allein auf den Stufen vor seinem Haus saß, jedoch nicht die halbe Brotscheibe mit Maggi und Margarine weg, auch wenn man größer und stärker war und Hunger hatte, und man klaute einer älteren Frau, die von einer Hamsterfahrt zurückkam, nicht den Rucksack mit ihren Einkäufen.
»Fühl doch mal, Mama.«
Hella fasste ihre Hand und fuhr mit einer knappen Streichelbewegung darüber, bevor sie sie auf den Stoff legte. Martha warf einen kurzen Blick auf Hellas Hand, ihre Finger hatten denselben Drall nach rechts wie ihre eigenen. Nur waren sie kleiner, weißer und zierlicher, so wie vieles an Hella eine kleinere und zierlichere Ausgabe von Martha war: die braunen Haare, das runde Gesicht, die gerade Nase.
Widerwillig befühlte Martha den Stoff. Schurwolle, Vorkriegsware. Die Sache mit dem Mantel gehörte in die erste Sparte, entschied sie, dem Toten tat es nicht weh. Sie seufzte.
Edith nahm ebenfalls ein Stück Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger.
»Nicht schlecht. Darf ich?«
Edith hob den Mantel an den Schultern hoch und hielt ihn vor sich.
»Nicht gerade der allerneuste Schick, aber gute Qualität.«
Sie wandte sich an Martha.
»Vielleicht könntest du der Kleinen einen neuen daraus nähen. Zieh doch mal an, Hella.«
Hella schlüpfte in den Mantel und knöpfte ihn zu. Ihr Hals ragte aus dem dunklen Stoff hervor und sah noch magerer und blasser aus als sonst. Die Schulternähte hingen auf halbem Weg zwischen Schultern und Ellenbogen, ihre Hände verschwanden komplett in den langen Ärmeln, der Saum reichte ihr bis an die Waden. Wie eine große Krähe mit hängenden Flügeln stand sie in der Küche.
Edith sah Martha an.
»Oder du könntest ihn gegen etwas anderes eintauschen. Wahrscheinlich würde es für einen kleineren Mantel, der dem Mädchen passt, und noch etwas anderes reichen.«
»Kartoffeln. Ein ganzer Sack. Oder Eier«, rief Hella. »Oder Kaffee, Mama. Stell dir vor, richtigen Bohnenkaffee.«
Bohnenkaffee – Martha hatte plötzlich den Geruch von Kaffee in der Nase. Das Kind wusste genau, wo es bei seiner Mutter ansetzen musste. Trotzdem überhörte Martha Hellas Vorschläge, genauso wie sie die Stimme in ihrem Kopf überhörte, die nach dem Besitzer des Mantels fragte.
Sie griff mit beiden Händen an die Seitennähte des Mantels und zog den Stoff zur Seite, bis er spannte. Rechts und links von Hellas Taille war der Mantel an jeder Seite mindestens fünfundzwanzig Zentimeter zu weit.
»Eigentlich zu schade zum Umschneidern. Viel zu viel Abfall«, murmelte sie.
Sie ließ die Seitennähte los und hörte ein leises Knistern. Irritiert befühlte sie den Stoff an der Stelle, die eigentlich die Taille seines Trägers bedecken sollte und die bei Hella knapp oberhalb des Knies saß. Es knisterte wieder.
»Hier steckt was im Futter.«
»Vielleicht Geld!« Wieder Hella.
Geld. Für Geld konnte man kaum etwas kaufen. Es sei denn, es waren Dollar oder britische Pfund.
»Zieh aus, ich guck mal, wie ich am besten rankomme.«
Hella ließ den Mantel von ihren Schultern gleiten. Ohne das Kleidungsstück wirkte sie auf einmal noch viel magerer. Sie reichte ihn ihrer Mutter. Tatsächlich, an der linken Knopfleiste war das Futter mit groben Stichen angenäht worden. Martha holte eine Rasierklinge aus ihrem Nähkästchen, trennte die Naht vorsichtig auf und fuhr mit der Hand in das Futter.
Ihre Hand kam mit ein paar Blättern wieder zum Vorschein. Fünf gelbe, amtlich aussehende Formulare und ein Zettel, der offenbar aus einem Notizbuch herausgerissen war.
Martha faltete die gelben Blätter auseinander und las »Städtisches Wirtschaftsamt«.
Edith schaute ihr über die Schulter.
»Bezugsscheine. Jeder für einen Zentner Butter.«