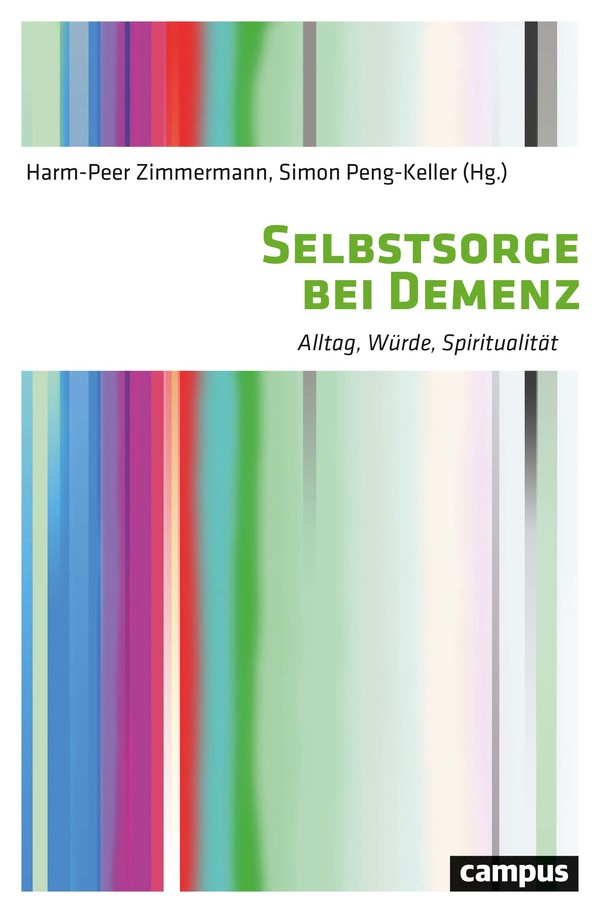
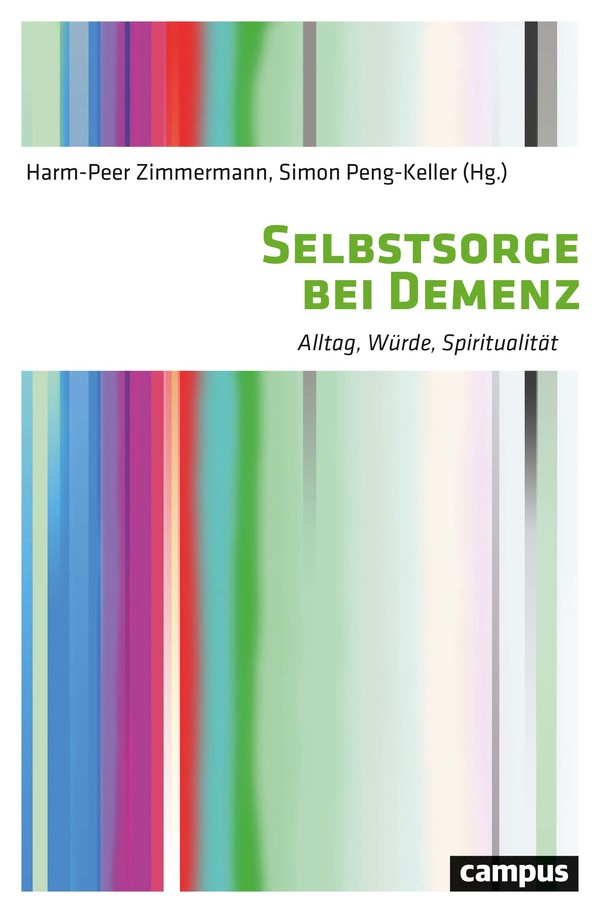
Harm-Peer Zimmermann, Simon Peng-Keller (Hg.)
Selbstsorge bei Demenz
Alltag, Würde, Spiritualität
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Dieser Band erkundet Möglichkeiten der Selbstsorge bei Demenz. Die Beiträge untersuchen alltägliche Dimensionen des Umgangs mit dieser Erkrankung. Sie haben das Ziel, Lebenslagen von Betroffenen und von ihren Angehörigen zu verbessern. Dafür nehmen sie unterschiedliche Perspektiven und Schwerpunkte ein. Alle Beiträge sind jedoch einem Forschungs- und Praxiskontext verpflichtet, der das Person-Sein und die Würde von Menschen mit Demenz betont. Der Band spricht sich grundlegend dafür aus, von Demenz betroffene Menschen nicht nur als Sorge- oder Pflegebedürftige wahrzunehmen, sondern sie auch als Personen anzuerkennen, die ihr Leben und ihr Umfeld aktiv (mit)gestalten.
Vita
Harm-Peer Zimmermann ist Professor für Populäre Literaturen und Medien am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich.
Simon Peng-Keller ist Professor für Spiritual Care an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich.
Harm-Peer Zimmermann, Simon Peng-Keller: Vorwort
Begriffliche Annäherungen und perspektivische Rahmungen
Alltagspraktiken, Selbstvertretung und Würde
Die Bedeutung von Sprache, Erzählung und Spiritualität
Die Rolle des Umfeldes
1. Begriff und perspektivische Rahmungen
Harm-Peer Zimmermann, Simon Peng-Keller: Selbstsorge bei Demenz. Annäherungen an einen neuen Leitbegriff
Heinrich Grebe: Selbstsorge von Menschen mit Demenz ‒ ein Überblick
Thomas Fuchs: Die leibliche Kontinuität des Selbst ‒ Leibgedächtnis und Selbstsorge in der Demenz
Burkhard Plemper: Für-, Vor- oder Selbstsorge? Kritische Anmerkungen zur Sorge
2. Alltagspraktiken, Selbstvertretung und Würde
Valerie Keller: Selbstsorge bei Demenz ‒ vom erschütterten Selbstbild zur Suche nach Ganzheit
Nina Wolf: »Weißt du, er hat nie gesagt, jetzt musst du mal auf dich schauen, dir geht es nicht gut« ‒ die Sorge um sich als gemeinsame Aufgabe
Andrea Radvanszky, Nikola Biller-Andorno: Demenz ‒ die Sorge um das Sein in der Welt
Sebastian J. Moser, Paul-Loup Weil-Dubuc: Unsichtbare Selbstsorge? Neurodegenerative Erkrankungen zwischen biomedizinischer »Überbelichtung« und In-der-Welt-Sein
Peter Muijres: Selbstsorge und dyadisches Coping ‒ Dignity Therapy im Kontext einer beginnenden Demenz
3. Die Bedeutung von Sprache, Erzählung und Spiritualität
Jürgen Steiner: Sprache als Teil des Selbst – Sprachtherapie als Stützung des Selbst
Franzisca Pilgram-Frühauf: »… irgendetwas, was beheimatet?« Selbstsorge und Spiritualität in narrativen Formen
Malte Völk: »Was haben wir doch für ein reiches Leben gehabt!« ‒ Tagebücher und Autobiografien als Mittel der Selbstsorge bei Demenz
Dorota Sadowska: Opa ist nicht ganz so wie die anderen Opas ‒ zur Darstellung von demenzbetroffenen Großeltern im modernen Kinderbuch
4. Die Rolle des Umfeldes
Autorinnen und Autoren
Harm-Peer Zimmermann, Simon Peng-Keller
Selbstsorge bei Demenz – wie soll das gehen? Zumal vielfach geschrieben steht, dass fortgeschrittene Phasen dieser Erkrankung von zunehmender Teilnahmslosigkeit, ja von Apathie gekennzeichnet seien. Steht es nicht so in allen einschlägigen Symptomkatalogen? Und was heißt das überhaupt: »Selbstsorge«? Ist es nicht vielmehr so, dass diese Krankheit dazu führt, dass man sich am Ende selbst vergisst? Wie sollte ein Mensch im Zustand solcher Selbstvergessenheit noch für sich selbst sorgen können? Wäre es nicht sogar zynisch, von ›Selbstsorge‹ zu sprechen angesichts einer Krankheit, deren Schrecken gerade darin besteht, dass sie das Selbst infrage stellt, es auszuhöhlen oder zu zerrütten droht?
Mit diesem Band möchten wir den Begriff der ›Selbstsorge‹ in den Mittelpunkt interdisziplinärer Überlegungen für ein Leben mit Demenz stellen. Wir haben damit selbstverständlich etwas ganz anderes im Sinn als das, was heute etwa neoliberale Konzepte des Selbst vorschlagen. Keineswegs wollen wir Narrative des aktiven und erfolgreichen Alterns nun etwa auch noch auf eine Personengruppe übertragen, die in besonderer Weise schutzbedürftig ist. Uns geht es nicht um ein »singuläres« oder gar »unternehmerisches Selbst«, das noch die Demenz positiv und produktiv wendet und damit womöglich den Rückzug des Sozialstaates und der Solidargemeinschaft aus der Verantwortung für ihre hochgefährdeten Mitglieder rechtfertigt. Auch deshalb möchten wir den Begriff ›Selbstsorge‹ stark machen, weil er sperrig ist und störrisch, weil er quer liegt zu allen leichtfertigen Reden vom active and successful aging.
Zugleich aber möchten wir zeigen, dass demenziell erkrankte Menschen keineswegs bloß passive Nutznießer von Sorgetransfers sind, sondern dass sie aktiv sind und eine Stimme haben, die gehört werden sollte: Was berichten Menschen mit Demenz über ihre Erfahrungen und Gefühle? Wie deuten, gestalten und organisieren sie ihren Alltag? Dazu gehört nicht zuletzt, das eigene Leben mit Demenz zu akzeptieren und die Hilfe anderer Menschen anzunehmen, sei es diejenige von Angehörigen, sei es diejenige von Nachbarn, Freund*innen und Mitbetroffenen oder schließlich diejenige von professionellen Pflegefachpersonen.
›Selbstsorge‹ – mit diesem Begriff plädieren wir für eine Perspektive beyond loss. Anstatt immer wieder aufs Neue Verluste, Einschränkungen oder gar den Verfall der Persönlichkeit bei Demenz anzuzeigen, geht es uns darum, die Aufmerksamkeit auf Ressourcen und Potenziale zu richten, auf Kompetenzen, die auch rezeptiver Art sein können. Vielleicht kommt ›Selbstsorge‹ in späten Phasen der Demenz zum Ausdruck in einem kleinen Händedruck, einem eigenwilligen Atemzug oder in einer Atmosphäre, die erahnen lässt, dass hier ein Mensch anwesend ist und lebt, der für Inspirationen nach wie vor zugänglich ist.
Der vorliegende Band ist aus zwei miteinander verbundenen Forschungsprojekten entstanden, die zwischen 2017 und 2021 am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft und an der Professur für Spiritual Care der Universität Zürich durchgeführt wurden. Das erste Projekt widmete sich unter dem Titel Selbstsorge bei Demenz im Horizont von Spiritual Care und Kulturwissenschaft dem Thema dieses Bandes, während das zweite Projekt mittels einer randomisierten Studie untersuchte, ob die von Harvey M. Chochinov entwickelte »würdezentrierte Therapie« auch von Menschen mit einer leichten Demenzerkrankung und ihren Angehörigen als hilfreich erlebt wird und zur Stärkung des Würdegefühls, der Hoffnung und der Lebensqualität beiträgt.
Auf dieser Basis stellt der vorliegende Band erstmals den Begriff ›Selbstsorge‹ in den Mittelpunkt interdisziplinärer Überlegungen für ein Leben mit Demenz. Er möchte Hintergründe und Reichweiten von Selbstsorge ausloten, die insbesondere Praktiken der Alltagsbewältigung, die Erhaltung der Persönlichkeit und Würde sowie Wege der Spiritualität von Menschen mit Demenz betreffen. Dafür haben wir eine Reihe namhafter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen, die ihre Forschungen auf die Themenbereiche Alltag, Würde, Spiritualität mit Demenz richten und dafür plädieren, Menschen mit Demenz als handelnde Personen ernst zu nehmen. Ebenso kommen auf den folgenden Seiten auch Fachpersonen zu Wort, die vor dem Hintergrund langjähriger professioneller und ehrenamtlicher Tätigkeiten das Thema dieses Bandes mit Perspektiven aus der Praxis anreichern. In vier Themenschwerpunkten soll es also einerseits um die Theorie, andererseits um die Praxis der Selbstsorge gehen: 1. begriffliche Annäherungen und perspektivische Rahmungen, 2. Alltagspraktiken, Selbstvertretung und Selbsthilfe, 3. die Bedeutung von Sprache, Erzählung und Spiritualität, 4. die Rolle des Umfeldes.
Im ersten Themenschwerpunkt geht es um gedankliche Rahmungen aus kulturwissenschaftlicher, theologischer, phänomenologischer und soziologischer Perspektive. Zunächst unternehmen Harm-Peer Zimmermann (Zürich) und Simon Peng-Keller (Zürich) eine Annäherung an den Begriff »Selbstsorge«. Dafür wird der »personzentrierte Ansatz« in der Demenzforschung, der bereits das Gefühl der »Selbstwirksamkeit« betont, um die Dimensionen »Bezogenheit« (Relationalität) und »Selbsttranszendenz« und »Spiritualität« erweitert. Der Gedankengang läuft darauf hinaus, Selbstsorge als etwas zu verstehen, was im affektiv-pathischen Selbstverhältnis im Angesicht von anderen verankert ist. – Heinrich Grebe (Marburg) analysiert sodann 80 Publikationen aus dem Feld der Demenzforschung und erörtert, in welch unterschiedlichen Kontexten und Gestalten Menschen mit Demenz um sich selbst Sorge tragen. Der Beitrag versucht, die alltagspraktische Bandbreite des begrifflich-interpretativen Konstrukts »Selbstsorge bei Demenz« abzustecken. In kritischer Absicht zeigt der Text unter anderem auch, inwiefern Selbstsorgepraktiken Demenzbetroffener auf soziale Diskriminierungen reagieren.
Thomas Fuchs (Heidelberg) entwickelt eine Auffassung von Personalität und Selbstsorge, die ihre Grundlage in der Leibphänomenologie hat. Danach ist unser primäres Selbstsein wesentlich lebendig und leiblich. Dieser Grund geht, so wird gezeigt, auch bei Demenzerkrankungen nie vollständig verloren. Mehr noch: Auf diesen Ressourcen, die im leiblichen Gedächtnis verankert sind, beruhen weitreichende Möglichkeiten der Selbstsorge, ohne dass es dazu erst einer expliziten, sprachlich vermittelten Interaktion bedürfte. – Burkhard Plemper (Hamburg) bettet die Frage der Selbstsorge bei Demenz in eine kritische Diskussion des Sorgebegriffs ein. Die Tour d’Horizon widmet sich zunächst Ambivalenzen der Fürsorge für Menschen mit Demenz. Dann geht es um Herausforderungen im Kontext von Vorsorgemaßnahmen Demenzbetroffener. Endpunkt der Darstellung ist eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Voraussetzungen, ideellen Rahmungen und emanzipativen Potenzialen einer Selbstsorge bei Demenz.
Im zweiten Themenschwerpunkt geht es um das alltägliche Leben mit Demenz in Würde und um Möglichkeiten der Selbstvertretung. Valerie Keller (Zürich) stellt Selbstsorgebestrebungen vor, die auf Verunsicherungen reagieren, wie sie durch Verluste alltagsrelevanter Fähigkeiten und Verhaltensweisen hervorgerufen werden Es wird aufgezeigt, wie Menschen mit Demenz (gemeinsam mit anderen) ein Selbstbild entwickeln können, das ihnen einerseits Halt und Orientierung im alltäglichen Handeln gibt und ihnen andererseits ermöglicht, sich selbst positiv wahrzunehmen und dem eigenen Leben Sinn zu geben.
Der Beitrag von Nina Wolf (Zürich) nimmt eine Genderperspektive ein und diskutiert anhand von Erfahrungsberichten betreuender Töchter, warum es zu Ungleichverteilungen von Sorgeverantwortung innerhalb von Familien kommt. Obwohl viele Frauen in ihrem Sorgehandeln nach wie vor Rollenbildern folgen, zeigt der Beitrag aber auch auf, wie und unter welchen Rahmenbedingungen Ungleichgewichte austariert und gesellschaftliche Wertvorstellungen neu verhandelt werden können. – Andrea Radvanszky (Zürich) und Nikola Biller-Andorno (Zürich) zeigen sodann: Wenn bei Demenzerkrankten kulturell geformte Sinngehalte und Symbolisierungen »vergessen« werden, hat Selbstsorge, die die Sorge um andere stets miteinschließt, nicht nur eine gestaltende Seite, sondern sie wird fundamental restringiert. Fürsorgeethisch muss es also immer auch um die Ausgestaltung einer asymmetrischen, irreziproken Sozialbeziehung gehen. Dieser Zusammenhang wird aus der Perspektive von Demenzerkrankten und pflegenden Angehörigen empirisch herausgearbeitet.
Welche Auswirkungen medizinische Rahmenbedingungen und Leitvorstellungen auf Selbstsorgepraktiken haben, untersuchen Sebastian J. Moser (Tübingen) und Paul-Loup Weil-Dubuc (Paris). Den wachsenden Möglichkeiten, demenzielle Erkrankungen in allen Vorstufen sichtbar zu machen, steht eine Selbstsorge in Gestalt des Unsichtbarmachens des eigenen Leidens gegenüber. Die Grundlage dieses Beitrags ist eine französische Initiative, in der Betroffene und Sozialwissenschaftler*innen gemeinsam einen Text zu Möglichkeiten und Grenzen einer »wohlwollenden Gesellschaft« verfassten. – Peter Muijres (Zürich) schließlich gibt einen Einblick in die Studie Dignity Therapy bei Demenz und bezieht sie auf die Thematik der Selbstsorge. Sie zeigt sich in diesem Zusammenhang in therapeutisch unterstützen Formen der Erinnerung und der Gestaltung eines oft prekären biografischen Übergangs. Herausgearbeitet wird dabei auch die Rolle der Lebenspartner und eingespielter und neu zu findender Formen »dyadischen Copings«.
Der dritte Themenschwerpunkt richtet die Aufmerksamkeit auf Stimmen von Menschen mit Demenz, wie sie in Tagebüchern, Briefen und anderen narrativen Formen, aber auch im alltäglichen Sprechen und in spirituellen Äußerungen zum Ausdruck kommen. Überdies finden sich diese Stimmen sogar in Kinderbüchern repräsentiert.
Aus der Perspektive des Logopäden weist Jürgen Steiner (Zürich) darauf hin, dass auch das In-Anspruch-Nehmen eines therapeutischen Angebots eine Form der Selbstsorge darstellt. Der Beitrag beleuchtet Wege, sprachlich-kommunikative Möglichkeiten unter erschwerten Bedingungen zu fördern und zu stützen. Betont wird dabei ein ressourcenzentrierter Ansatz, der davon ausgeht, dass auch unter demenziell veränderten Lebensbedingungen Lernprozesse vielfältiger Art möglich sind. – Unter einer erzähltheoretischen Perspektive widmet sich Franzisca Pilgram-Frühauf (Zürich) unterschiedlichen Dimensionen und Formen narrativer Selbstsorge. Den Rahmen hierfür bildet die von Harvey M. Chochinov entwickelte Dignity Therapy, die Menschen mit einer beginnenden Demenz Gesprächs- und Erinnerungsräume ermöglicht. In den lebensgeschichtlichen Erzählungen entfaltet sich eine Symbolsprache, die zeigt, wie in den Suchbewegungen der Spiritualität, der Sehnsucht nach Beheimatung, auch ein verletzliches Selbst zur Selbstsorge fähig ist.
Malte Völk (Zürich) widmet sich zwei Tagebüchern, die von Frauen mit einsetzenden demenziellen Symptomen verfasst worden sind, und untersucht sie im Hinblick auf ihre Bedeutung für Praktiken der Selbstsorge. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Relevanz von schriftlicher Selbstreflexion sowie auf der Verschränkung von Sorge und Selbstsorge im Wechselspiel von schriftlicher und mündlicher biografischer Erzählung. – Dorota Sadowska (Warschau) untersucht drei Kinderbücher, die Demenz am Beispiel von Großeltern thematisieren. Die Autorin fragt, ob es in diesen Geschichten und auch ihren Illustrationen gelingt, stereotype Vorstellungen von Demenz abzubauen und an ihrer Stelle Verständnis, Akzeptanz und Offenheit zu entwickeln. Gezeigt wird, dass Kinderliteratur sehr hilfreich sein kann, auch Vorstellungen von Selbstsorge zu etablieren.
Selbstsorge bedarf immer auch eines fördernden Umfeldes. Dieser Aspekt bildet den vierten Themenschwerpunkt. Im Sinne eines Erfahrungsberichts zeichnet der Beitrag von Reingard Lange (Wien) die Entwicklung der Promenz-Initiative nach, aus der eine partizipativ geleitete Selbsthilfeorganisation von Menschen mit Demenz erwachsen ist. Möglichkeiten von Selbstsorge werden dabei innerhalb konkreter Spannungsfelder aufgezeigt. Diese bestehen zum Beispiel zwischen Selbsthilfe und Öffentlichkeitsarbeit, Organisationsentwicklung und alltäglichen Begegnungen, und sie machen eine sorgfältige Klärung von Rollen unabdingbar. – Jenni-Marie Ratten (Melbourne) untersucht, wie Sorgeumfelder für Muslime mit Demenz in Deutschland verbessert beziehungsweise umfassend aufgebaut werden können. Gemeint sind damit Umfelder, die über den engeren Kreis der Familie hinausreichen. Zu diesem Zweck berichtet die Autorin über Erfahrungen und Vorschläge von Menschen, die bereits jetzt für diese Betroffenengruppe sorgen und insbesondere auf sprachliche, kommunikative, kulturelle und religiöse Aspekte achten.
Stefanie Wiloth (Heidelberg) und Birgit Kramer (Heidelberg) stellen mit den sogenannten Rathausgesprächen eine Methode vor, die pflegenden Angehörigen den Austausch mit kommunalen Entscheidungsträgern, Gesundheitsfachleuten und der Bürgerschaft ermöglicht. Anhand von detaillierten Inhaltsanalysen vermögen sie aufzuzeigen, dass der öffentliche Dialog die Selbstsorgefähigkeit der Angehörigen stärkt, gleichzeitig aber auch auf politischer Ebene Lernprozesse anregt und Impulse für adäquate Unterstützungsangebote gibt. – In einem Gespräch richten die Geriaterin Irene Bopp-Kistler (Zürich) und der Seelsorger und Theologe Ralph Kunz (Zürich) abschließend ihre Aufmerksamkeit auf Ressourcen eines Menschen mit Demenz, die ihm Resilienz und Lebensmut ermöglichen. Dabei richten sie ihr Augenmerk auf Impulse, die einerseits von der Pflege und kurativen Medizin, andererseits aus einem offenen System der Beziehungen kommen, das sich nicht zuletzt um die Seele eines Menschen mit Demenz sorgt.
Wir danken Porticus Düsseldorf für die Unterstützung der Forschungsprojekte Selbstsorge bei Demenz im Horizont von Spiritual Care und Kulturwissenschaft und Dignity Therapy for patients with early stage dementia. Empirical and narratological studies in the context of spiritual care. Unseren Mitarbeiter*innen Valerie Keller, Franzisca Pilgram-Frühauf und Heinrich Grebe danken wir für Anregungen und Ideen, für organisatorische Hilfen und für vielfältige Unterstützung, nicht zuletzt bei der Durchsicht und Lektorierung der Beiträge dieses Bandes.
Zürich, im Frühling 2021
Simon Peng-Keller
Harm-Peer Zimmermann