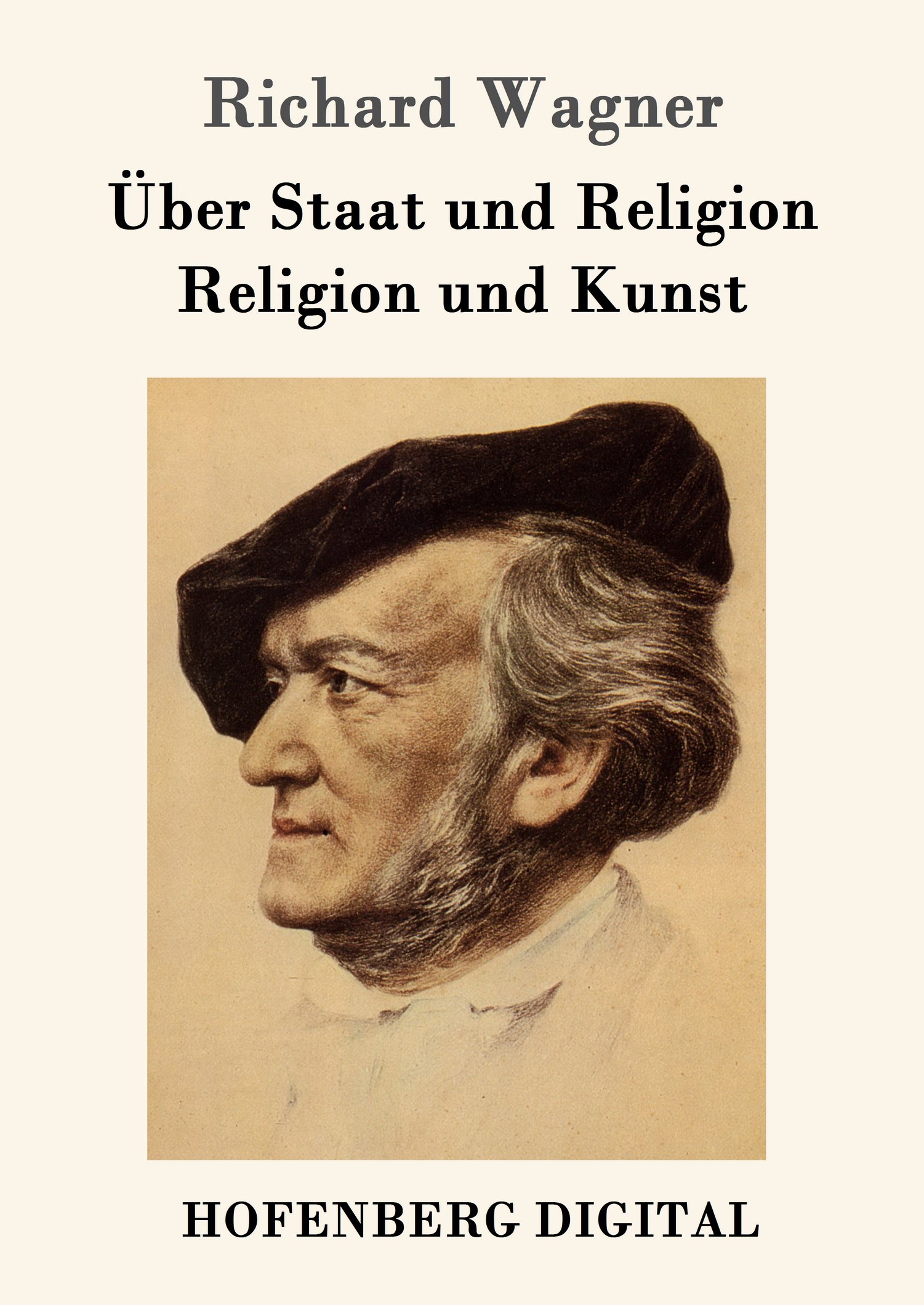
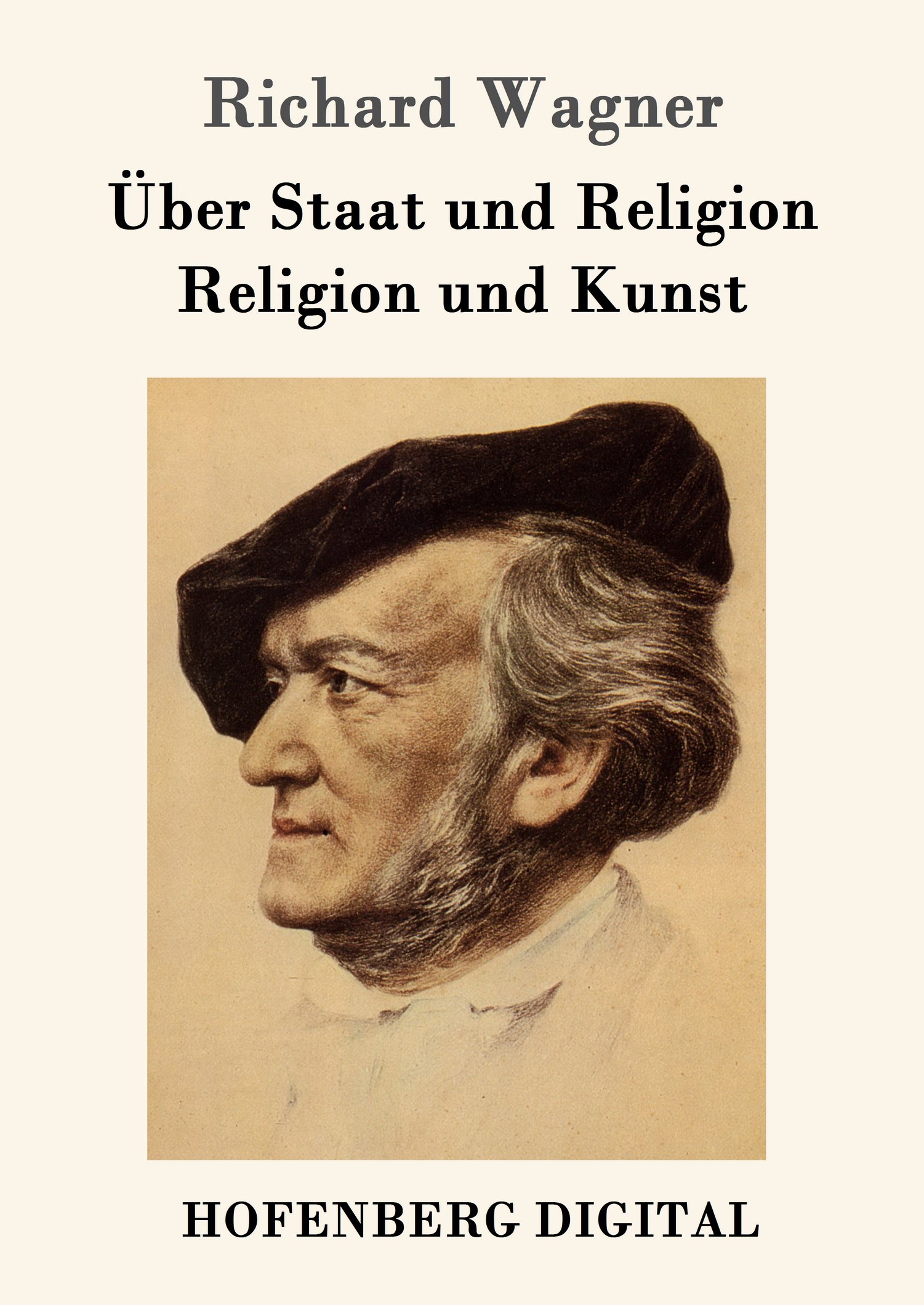
Richard Wagner: Über Staat und Religion / Religion und Kunst
Neuausgabe.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth, Berlin 2017.
ISBN 978-3-86199-959-1
Dieses Buch ist auch in gedruckter Form erhältlich:
ISBN 978-3-8430-4847-7 (Broschiert)
ISBN 978-3-8430-4852-1 (Gebunden)
Die Sammlung Hofenberg erscheint im Verlag der Contumax GmbH & Co. KG, Berlin.
Über Staat und Religion
Entstanden 1864 im Auftrag des Königs Ludwig II. von Bayern. Hier nach: Richard Wagner: Sämtliche Schriften und Dichtungen. Band 8, Leipzig: Breitkopf und Härtel, o.J. [1911]. Die Eigentümlichkeit der Orthographie wurde bei der vorliegenden Ausgabe beibehalten.
Religion und Kunst
Entstanden 1880 in Neapel. Hier nach: Richard Wagner: Sämtliche Schriften und Dichtungen. Band 10, Leipzig: Breitkopf und Härtel, o.J. [1911].
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind über http://www.dnb.de abrufbar.
Ein hochgeliebter junger Freund wünscht von mir zu erfahren, ob und in welcher Art meine Ansichten über Staat und Religion, seit der Abfassung meiner Kunstschriften in den Jahren 1849 bis 1851, sich geändert haben.
Wie ich vor mehreren Jahren durch die Aufforderung eines mir befreundeten Franzosen veranlaßt wurde, meine Ansichten über Musik und Dichtkunst nochmals zu überdenken und, sie zusammenfassend, übersichtlich darzustellen (was in dem Vorworte zu einer französischen Prosa-Übersetzung mehrerer meiner Operndichtungen geschah)1, ebenso dürfte es mir nicht unwillkommen sein, nach jener anderen Seite hin meine Gedanken noch einmal zu einem klaren Abschlusse zu sammeln, wenn nicht eben hier, wo eigentlich Jeder eine berechtigte Meinung zu haben glaubt, eine bestimmte Äußerung, je älter und erfahrener man wird, immer schwieriger fiele. Hier zeigt es sich eben wieder, was Schiller sagt: »ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst«. Vielleicht kann man aber von mir sagen, daß ich die Kunst schon besonders ernst genommen habe, und dieß mich befähigen dürfte, auch für die Beurtheilung des Lebens unschwer die rechte Stimmung zu finden. In Wahrheit glaube ich meinen jungen Freund am besten über mich zurecht zu weisen, wenn ich ihn vor Allem darauf aufmerksam mache, wie ernst ich es eben mit der Kunst meinte; denn in diesem Ernste liegt gerade der Grund, der mich einst nöthigte, mich auf scheinbar so weit abliegende Gebiete, wie Staat und Religion, zu begeben. Was ich da suchte, war wirklich immer nur meine Kunst, – diese Kunst, die ich so ernst erfaßte, daß ich für sie im Gebiete des Lebens, im Staate, endlich in der Religion, eben eine berechtigende Grundlage aufsuchte und forderte. Daß ich diese im modernen Leben nicht finden konnte, veranlaßte mich, die Gründe hiervon in meiner Weise zu erforschen; ich mußte mir die Tendenz des Staates deutlich zu machen suchen, um aus ihr die Geringschätzung zu erklären, welche ich überall im öffentlichen Leben für mein ernstes Kunstideal antraf.
Gewiß war es aber für meine Untersuchung charakteristisch, daß ich hierbei nie auf das Gebiet der eigentlichen Politik herabstieg, namentlich die Zeitpolitik, wie sie mich trotz der Heftigkeit der Zustände nicht wahrhaft berührte, auch von mir gänzlich unberührt blieb. Daß diese oder jene Regierungsform, die Herrschaft dieser oder jener Partei, diese oder jene Veränderung im Mechanismus unseres Staatswesens, meinem Kunstideale irgend welche wahrhaftige Förderung verschaffen sollte, habe ich nie gemeint; wer meine Kunstschriften wirklich gelesen hat, muß mich daher mit Recht für unpraktisch gehalten haben; wer mir aber die Rolle eines politischen Revolutionärs, mit wirklicher Einreihung in die Listen derselben, zugetheilt hat, wußte offenbar gar nichts von mir, und urtheilte nach einem äußeren Scheine der Umstände, der wohl einen Polizeiaktuar, nicht aber einen Staatsmann irre führen sollte. Dennoch liegt in dieser Verwechselung des Charakters meiner Bestrebungen auch mein eigener Irrthum verwickelt: indem ich die Kunst so ungemein ernst erfaßte, nahm ich das Leben zu leicht; und wie sich dieß an meinem persönlichen Schicksale rächte, sollten auch meine Ansichten hierüber bald eine andere Stimmung erhalten. Genau genommen war ich dahin gelangt, in meiner Forderung den Schiller'schen Satz umzukehren, und verlangte meine ernste Kunst in ein heiteres Leben gestellt zu wissen, wofür mir denn das griechische Leben, wie es unserer Anschauung vorliegt, als Modell dienen mußte.
Aus allen meinen gedachten Anordnungen für den Eintritt des Kunstwerkes in das öffentliche Leben geht hervor, daß ich diese mir als einen Aufruf zur Sammlung aus der Zerstreuung eines Lebens vorstellte, welches im Grunde nur als eine heitere Beschäftigung, nicht aber als eine ermüdende Arbeitsmühe gedacht werden sollte. Nicht eher nahmen daher die politischen Bewegungen jener Zeit meine Aufmerksamkeit ernster in Anspruch, als bis durch den Übertritt derselben auf das rein soziale Gebiet in mir Ideen angeregt wurden, die, weil sie meiner idealen Forderung Nahrung zu geben schienen, mich, wie ich gestehe, eine Zeit lang ernstlich erfüllten. Meine Richtung ging darauf, mir eine Organisation des gemeinsamen öffentlichen, wie des häuslichen Lebens vorzustellen, welche von selbst zu einer schönen Gestaltung des menschlichen Geschlechtes führen müßte. Die Berechnungen der neueren Sozialisten fesselten demnach meine Theilnahme von da ab, wo sie in Systeme auszugehen schienen, welche zunächst nichts Anderes als den widerlichen Anblick einer Organisation der Gesellschaft zu gleichmäßig vertheilter Arbeit hervorbrachten. Nachdem auch ich zunächst das Entsetzen getheilt, welches dieser Anblick dem ästhetisch Gebildeten erweckt, glaubte ich jedoch bei tieferem Einblicke in den so gebotenen Zustand der Gesellschaft etwas ganz Anderes wahrnehmen zu müssen, als was gerade selbst jenen rechnenden Sozialisten vorgeschwebt hatte. Ich fand nämlich, daß, bei gleicher Vertheilung an Alle, die eigentliche Arbeit, mit ihrer entstellenden Mühe und Last, geradesweges aufgehoben sei, und statt ihrer nur eine Beschäftigung übrig bliebe, welche nothwendig von selbst einen künstlerischen Charakter annehmen müßte. Anhalt zur Beurtheilung dieses Charakters der an die Stelle der Arbeit getretenen Beschäftigung bot mir, unter Anderem, der Ackerbau, welchen ich mir, von allen Gliedern der Gemeinde bestellt, eines Theils bis zur ergiebigeren Gartenpflege entwickelt, anderen Theils als, nach Tages- und endlich Jahreszeiten vertheilte gemeinsame Verrichtungen, welche, genau betrachtet, den Charakter von stärkenden Übungen, ja Vergnügungen und Festlichkeiten annahmen, vorzustellen vermochte. Indem ich nach allen Richtungen diese Umbildung der ständischen und bürgerlichen, einseitigen Tendenzen der Arbeit zu einer Allen naheliegenden, universelleren Beschäftigung mir darzustellen suchte, ward ich mir andererseits bewußt, auf nichts unerhört Neues zu sinnen, sondern nur den ähnlichen Problemen nachzugehen, welche ja selbst unseren größten Dichter so freundlich ernst beschäftigten, wie wir dieß in »Wilhelm Meisters Wanderjahren« antreffen. Auch ich bildete mir daher eine mir möglich dünkende Welt, die, je reiner ich sie mir gestaltete, desto weiter von der Realität der mich umgebenden politischen Zeittendenzen abführte, so daß ich mir sagen konnte, meine Welt werde eben genau da erst eintreten, wo die gegenwärtige aufhörte; oder da, wo Politiker und Sozialisten zu Ende wären, würden wir anfangen. Ich will nicht läugnen, daß diese Ansicht sich selbst zur Stimmung erhob: die politischen Verhältnisse des Beginnes der vergangenen fünfziger Jahre hielten alles in einer Spannung und Bangigkeit, die mir ein gewisses Behagen erwecken konnten, welches dem praktischen Politiker wohl mit Recht bedenklich erscheinen mochte.
Wenn ich zurückdenke, glaube ich mich nun davon freisprechen zu dürfen, daß die Ernüchterung aus der bezeichneten, einer geistigen Berauschung nicht unähnlichen Stimmung, erst und nur durch die Wendungen, welche die europäische Politik nahm, hervorgerufen worden sei. Dem Dichter ist es eigen, in der inneren Anschauung des Wesens der Welt reifer zu sein, als in der abstrakt bewußten Erkenntniß: zu eben jener Zeit hatte ich bereits die Dichtung meines »Ringes des Nibelungen« entworfen und endlich ausgeführt. Mit dieser Konzeption hatte ich mir unbewußt im Betreff der menschlichen Dinge die Wahrheit eingestanden. Hier ist Alles durch und durch tragisch, und der Wille, der eine Welt nach seinem Wunsche bilden wollte, kann endlich zu nichts Befriedigenderem gelangen, als durch einen würdigen Untergang sich selbst zu brechen. Es war die Zeit, wo ich mich ganz und einzig wieder nur meinen künstlerischen Entwürfen zuwandte, und so, dem Leben aus vollstem Herzen seinen Ernst zuerkennend, dahin mich zurückzog, wo einzig »Heiterkeit« herrschen kann. –
Gewiß wird nun selbst mein junger Freund nicht erwarten, daß ich eine eigentliche Darstellung meiner seitdem gebildeten Ansichten über Politik und Staat gebe: unter allen Umständen würden diese keine praktische Bedeutung haben können, und sie würden in Wahrheit nur meine Scheu, mit Dingen dieser Art fachmäßig mich zu befassen, auszudrücken haben. Es kann ihm somit nur daran liegen, zu erfahren, wie es in dem Kopfe eines zum Künstler organisirten Menschen meiner Art, nach Allem was er empfunden und erfahren, aussehen mag, sobald er zum Nachdenken über ihm so abliegende Gegenstände bewogen wird. Der Meinung, als ob ich hiermit Geringschätzung ausgedrückt haben wollte, würde ich dann aber sofort zu begegnen haben, und Alles, was ich nun hervorzubringen hätte, würde eigentlich nur ein Zeugniß dafür sein, daß ich dahin gelangt bin, den großen, ja peinlichen Ernst der Sache vollkommen zu würdigen. Auch der Künstler kann von sich sagen: »mein Reich ist nicht von dieser Welt«, und ich vielleicht mehr als irgend ein jetzt lebender muß dieß von mir sagen, eben des Ernstes willen, mit dem ich meine Kunst erfasse. Das Harte ist es nun eben, daß wir mit diesem außerweltlichen Reiche mitten in dieser Welt stehen, die selbst so ernst und sorgenvoll ist, daß ihr flüchtige Zerstreuung einzig angemessen dünkt, während das Bedürfniß nach ernster Erhebung ihr fremd geworden ist. –
Das Leben ist ernst und – war es von je.
Wer hierüber ganz aufgeklärt werden will, betrachte nur, wie zu jeder Zeit und unter immer sich neu gestaltenden, dennoch aber nur sich wiederholenden Formen, dieses Leben und diese Welt großen Herzen und weiten Geistern Anlaß zur Aufsuchung der Möglichkeit ihrer Verbesserung ward, und wie gerade die Edelsten, d.h. diejenigen, denen nur am Wohle der anderen Menschen lag, und die ihr eigenes Wohl willig dafür aufopferten, stets ohne den mindesten Einfluß auf die dauernde Gestaltung der Dinge blieben. Aus der großen Erfolglosigkeit aller solcher erhabenen Anstrengungen ergiebt sich dann deutlich, daß diese Weltverbesserer in einem Grundirrthume befangen waren, und an die Welt selbst Forderungen stellten, die nicht an sie zu stellen sind. Sollte es auch möglich erscheinen, daß Vieles zweckmäßiger unter Menschen eingerichtet werden könnte, so wird uns aber aus jenen Erfahrungen ersichtlich, daß die Mittel und Wege, hierzu zu gelangen, nie von dem einzelnen Geiste im Voraus richtig erkannt werden, wenigstens nicht in der Weise, daß er sie der Masse der Menschen mit Erfolg wiederum zur Erkenntniß bringen könnte. Bei näherer Prüfung dieser Verhältnisse gerathen wir endlich in Erstaunen über die ganz unglaubliche Schwäche und Geringfügigkeit der allgemeinen menschlichen Intelligenz, zuletzt aber in eine beschämende Verwunderung darüber, daß wir hierüber in Erstaunen gerathen konnten; denn eine richtige Erkenntniß der Welt hätte uns von Anfang her belehrt, daß das Wesen der Welt eben Blindheit ist, und nicht die Erkenntniß ihre Bewegung veranlaßt, sondern eben ein völlig dunkler Drang, ein blinder Trieb von einzigster Macht und Gewalt, der sich gerade nur so weit Licht und Erkenntniß verschafft, als es zur Stillung des augenblicklich gefühlten drängenden Bedürfnisses noth thut. Wir erkennen nun, daß Nichts wirklich geschieht, was nicht eben nur aus diesem unfernsichtigen, durchaus nur dem augenblicklich gefühlten Bedürfnisse entsprechenden Willen hervorgeht, und Politiker von praktischem Erfolge somit von jeher nur diejenigen waren, welche genau bloß dem augenblicklichen Bedürfnisse Rechnung trugen, nie aber fern liegende, allgemeine Bedürfnisse in das Auge faßten, welche heute noch nicht empfunden werden, und für welche daher der Masse der Menschen der Sinn in der Weise abgeht, daß auf ihre Mitwirkung zur Erreichung derselben nicht zu rechnen ist.
Persönlichen Erfolg, und großen, wenn auch nicht dauernden Einfluß auf die Gestaltung der äußeren Weltlage, sehen wir außerdem dem gewaltsamen, leidenschaftlichen Individuum zugetheilt, welches, unter geeigneten Umständen, dem Grundwesen des menschlichen Dranges, gleichsam elementarisch es entfesselnd, somit der Habgier und Genußsucht, schnelle Wege zur Befriedigung anweist. Der Furcht vor von dieser Seite her zugefügter Gewaltsamkeit, sowie einiger hieraus gewonnener Grunderkenntniß des menschlichen Wesens, verdanken wir den Staat. In ihm drückt sich das Bedürfniß als Nothwendigkeit des Übereinkommens des in unzählige, blind begehrende Individuen getheilten, menschlichen Willens zu erträglichem Auskommen mit sich selber aus. Er ist ein Vertrag, durch welchen die Einzelnen, vermöge einiger gegenseitiger Beschränkung, sich vor gegenseitiger Gewalt zu schützen suchen. Wie in der Natur-Religion den Göttern ein Theil der Feldfrucht oder Jagdbeute zum Opfer gebracht wurde, um dadurch ein Recht auf den Genuß des Übrigen sich zugetheilt zu wissen, so opferte im Staate der Einzelne so viel von seinem Egoismus, als nöthig erschien, um die Befriedigung des großen Restes desselben sich zu sichern.
Hierbei geht die Tendenz des Einzelnen natürlich dahin, gegen das kleinstmögliche Opfer die größtmögliche Zusicherung zu erhalten: auch diese Tendenz kann er aber nur durch gleichbetheiligte Genossenschaften zur Geltung bringen; und diese verschiedenen Genossenschaften unter sich gleichbetheiligter Individuen bilden die Parteien, von denen den meistbesitzenden an der Unveränderlichkeit des Zustandes, den minder begünstigten an dessen Veränderung liegt. Selbst aber die nach Veränderung strebende Partei wünscht nur in den Zustand zu gelangen, in welchem auch ihr Unveränderlichkeit gefallen dürfte; und der Hauptzweck des Staates wird somit von vornherein von Denen festgehalten, deren Vortheile bereits die Unveränderlichkeit entspricht.
Stabilität ist daher die eigentliche Tendenz des Staates: und mit Recht; denn sie entspricht zugleich dem unbewußten Zwecke jedes höheren menschlichen Strebens, über das erste Bedürfniß wirklich hinauszukommen, nämlich: zur freieren Entwickelung der geistigen Anlagen, welche stets gefesselt wird, sobald Hinderungen für die Befriedigung dieses ersten Grundbedürfnisses eintreten. Nach Stabilität, nach Erhaltung der Ruhe strebt naturgemäß demnach Alles: versichert kann sie aber nur werden, wenn die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes nicht vorwiegendes Interesse nur einer Partei ist. Im wohlverstandenen Interesse aller Parteien, also des Staates, liegt es daher, keiner einzelnen Partei das Interesse seiner Erhaltung einzig zu überlassen. Es muß demnach die Möglichkeit der steten Abhilfe der leidenden Interessen der minder begünstigten Parteien gegeben sein: je mehr hierfür immer nur das nächste Bedürfniß in das Auge gefaßt wird, desto verständlicher wird es selbst sein, und desto leichter und beruhigender kann Befriedigung dafür gewonnen werden. Allgemeine Gesetze, welche für diese Möglichkeit sorgen, zielen somit, indem sie kleine Veränderungen zulassen, ebenfalls nur auf Versicherung der Stabilität, und dasjenige Gesetz, welches, auf die Möglichkeit steter Abhilfe dringender Bedürfnisse berechnet, zugleich die stärkste Versicherung der Stabilität enthält, muß demnach das vollkommenste Staatsgesetz sein.
Die verkörperte Gewähr für dieses Grundgesetz ist der Monarch. Es giebt in keinem Staate ein wichtigeres Gesetz, als welches seine Stabilität an die erbliche höchste Gewalt einer besonderen, mit allen übrigen Geschlechtern nicht verbundenen und nicht sich vermischenden, Familie heftet. Es hat noch keine Staatsverfassung gegeben, in welcher, nach dem Untergange solcher Familien und nach Abschaffung der Königsgewalt, nicht durch Umschreibungen und Substituirungen aller Art eine ähnliche Gewalt nothwendig, und meistens nothdürftig, rekonstruirt worden wäre. Sie ist daher als wesentlichstes Grundgesetz des Staates festgehalten, und wie in ihr die Gewähr für die Stabilität liegt, erreicht in der Person des Königs der Staat zugleich sein eigentliches Ideal.
Wie nämlich der König einerseits die Sicherung für den Bestand des Staates giebt, reicht er mit seinem eigenen höchsten Interesse bereits über den Staat hinaus. Er persönlich hat mit den Interessen der Parteien nichts mehr gemein, sondern ihm liegt nur daran, eben zur Sicherung des Ganzen den Widerstreit dieser Interessen ausgeglichen zu wissen. Sein Walten ist daher Gerechtigkeit, und wo diese nicht zu erreichen, Gnade auszuüben. Somit ist er, den Partei-Interessen gegenüber, der Vertreter des rein menschlichen Interesses, und nimmt daher vor dem Auge des im Partei-Interesse befangenen Bürgers eine in Wahrheit fast übermenschliche Stellung ein. Ihm wird demgemäß eine Ehrbezeigung zugewendet, wie sie der höchste Staatsbürger nie auch nur annähernd anzusprechen sich einfallen lassen kann; und hier, auf dieser Spitze des Staates, wo wir sein Ideal erreicht sehen, treffen wir daher auf diejenige Seite der menschlichen Anschauungsweise, welche wir, der Fähigkeit der Erkenntniß des nächsten Bedürfnisses gegenüber, als Wahn-Vermögen bezeichnen wollen. Alle Diejenigen nämlich, deren reines Erkenntnißvermögen entschieden nicht über das auf das nächste Bedürfniß Bezügliche hinausreicht, und diese bilden den überwiegend größten Theil der Menschen überhaupt, würden unfähig sein, die Bedeutung der königlichen Gewalt, deren Ausübung mit ihrem nächsten Bedürfnisse in keiner unmittelbar wahrnehmbaren Beziehung mehr steht, zu erkennen, geschweige denn die Nothwendigkeit, für ihre Erhaltung sich zu bemühen, ja dieser sogar die höchsten Opfer, die Opfer des Gutes und des Lebens zu bringen, wenn hier nicht eine, der gemeinen Erkenntniß ganz entgegengesetzte Anschauungsweise zu Hilfe käme. Diese ist der Wahn.
Ehe wir uns das Wesen des Wahnes aus seinen wundervollsten Bildungen verständlich zu machen suchen, beachten wir zu seiner Erklärung hier zunächst die ungemein anregende Beleuchtung, welche ein vorzüglich tiefsinniger und scharfblickender Philosoph der letzten Vergangenheit dem an sich so unbegreiflichen Phänomene des thierischen Instinktes zuwendet. – Die erstaunliche Zweckmäßigkeit in den Verrichtungen der Insekten, von denen uns die Bienen und Ameisen für die gemeine Beobachtung am nächsten liegen, ist bekanntlich nicht in der Weise erklärlich, wie die Zweckmäßigkeit bei ähnlichen gemeinschaftlichen Verrichtungen der Menschen zu begreifen ist; wir können nämlich unmöglich annehmen, daß, wie es bei den Menschen der Fall ist, hier diese Verrichtungen von einer wirklichen, den Individuen inwohnenden Erkenntniß ihrer Zweckmäßigkeit, ja nur ihres Zweckes, geleitet würden. Zur Erklärung des ungemeinen, ja selbst aufopferungsvollen Eifers, sowie der sinnreichen Art, mit welchen solche Thiere z.B. für ihre Eier sorgen, deren Zweck und zukünftige Bestimmung sie unmöglich aus Erfahrung und Beobachtung kennen, schließt unser Philosoph auf einen Wahn, der dem so äußerst dürftigen individuellen Erkenntnißvermögen des Thieres hierbei einen Zweck vorspiegelt, welchen es für die Befriedigung seines eigenen Bedürfnisses hält, während er in Wahrheit nicht dem Individuum, sondern der Gattung angehört. Der Egoismus des Individuums wird mit Recht hierbei als so unbesieglich stark angenommen, daß Verrichtungen, welche nur der Gattung, als den kommenden Geschlechtern, zu Nutzen sind, demnach die Erhaltung der Gattung, und zwar auf Kosten des eben jetzt in Anspruch zu nehmenden, der Vergänglichkeit geweihten Individuums, nimmermehr von diesem mit Mühe und Selbstaufopferung vollzogen werden würden, wenn es nicht zu dem Wahne verleitet würde, hierdurch einem eigenen Zwecke zu dienen; ja, dieser vorgespiegelte eigene Zweck muß dem Individuum wichtiger, die durch seine Erreichung zu gewinnende Befriedigung stärker und vollkommener erscheinen, als der gewöhnliche rein individuelle Zweck der Befriedigung des Hungers u.s.w., weil, wie wir sehen, dieser auf das Eifrigste jenem aufgeopfert wird. Als den Erreger und Bildner dieses Wahnes bezeichnet unser Philosoph eben den Geist der Gattung selber, welcher als allmächtiger Lebenswille für das beschränkte Erkenntnißvermögen des Individuums eintritt, da ohne seine Einwirkung das Individuum, in seiner beschränkten egoistischen Selbstsorge seinen eigenen einzelnen Bestehen zu Liebe willig die Gattung aufopfern würde.
Sollte es uns gelingen, die Beschaffenheit dieses Wahnes uns irgend wie zu innigem Bewußtsein zu bringen, so wäre hiermit auch der richtige Aufschluß über dieses sonst so unfaßbare Verhältniß des Individuums zur Gattung gewonnen. Vielleicht wird uns dieß auf dem Wege erleichtert, welcher uns über den Staat hinaus führt. Für jetzt giebt uns aber die Anwendung des aus der Beobachtung des thierischen Instinktes gewonnenen Ergebnisses auf Dasjenige, was gewisse stets gleiche, von nirgends her befohlene, doch immer wieder von selbst entstehende Einrichtungen von höchster Zweckmäßigkeit im menschlichen Staate hervorbringt, eine nächste Möglichkeit der Bezeichnung des Wahnes, als eines allgemein bekannten, selbst an die Hand.
Im politischen Leben äußert dieser Wahn sich nämlich als Patriotismus. Als solcher bestimmt er den Bürger, das eigene Wohlergehen, auf dessen möglichst reichliche Sicherung ihm sonst bei allen persönlichen, wie parteilichen Bestrebungen es einzig ankam, ja das Leben selbst zu opfern, um das Bestehen des Staates zu sichern: der Wahn, daß eine gewaltsame Veränderung des Staates ihn ganz persönlich treffen und vernichten müsse, so daß er sie nicht überleben zu können glaubt, beherrscht ihn hierbei in der Weise, daß er das dem Staate drohende Übel, als ein persönlich zu erleidendes, mit ganz demselben, und wohl gar größerem Eifer als dieses abzuwenden bemüht ist, während der Verräther, sowie der grobe Realist, allerdings beweist, daß auch nach dem Eintritte des von Jenem gefürchteten Übels, sein persönliches Wohlergehen jetzt so gut wie früher bestehen kann.