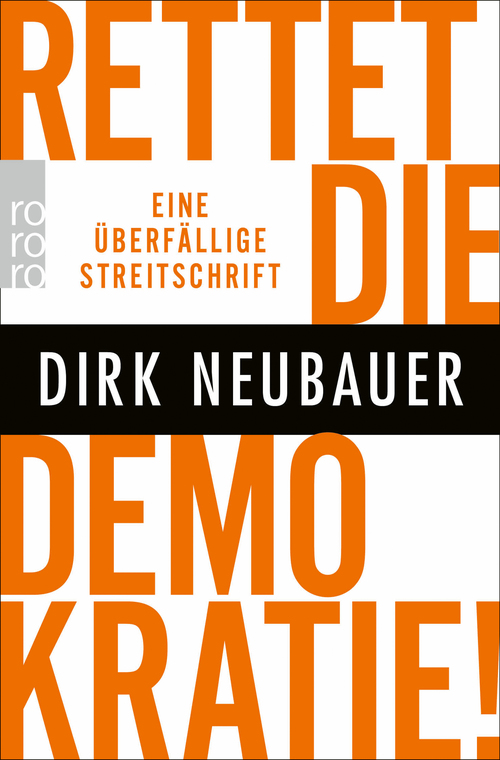
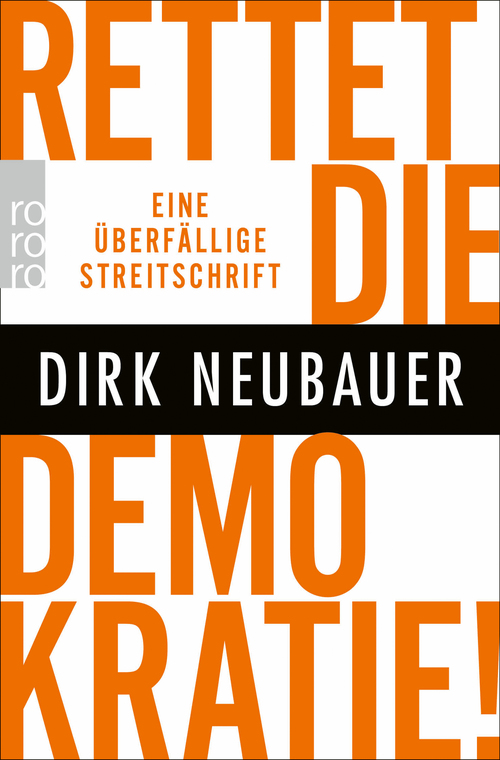
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Martin Kulik
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung zero-media.net, München
Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01107-6
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
ISBN 978-3-644-01107-6
Geschuldet der Gegenwart.
Gewidmet dem Aufbruch.
Danke, Löwenherz.
Das ist ein Weckruf! Eine überfällige Einladung zum Streit! Für die Demokratie. Denn die ist bedroht. Zum einen von denen, die seit Jahrzehnten per Mandat in unserem Namen Politik machen. Zum anderen von uns Bürgerinnen und Bürgern, die wir ebenso lange vergessen haben, dieses demokratische Mandat auch wirklich zu kontrollieren und uns selbst politisch einzubringen.
Nun wachen wir langsam auf und stellen fest: Dieses komplexe, überregulierte, paragraphenreitende und oftmals autokratisch gelenkte Land braucht einen Neustart! Einen konstruktiven Diskurs darüber, wie wir künftig wieder einfacher, ehrlicher und, ja, am Ende auch demokratischer miteinander leben können. Wie wir zu einer Ordnung kommen können, die nicht nur um des Volkes Mandat bemüht, sondern auch wieder mehr von dessen Willen bestimmt ist.
Dieses Buch macht ein Angebot, in diese Auseinandersetzung einzutreten. Es erhebt nicht den Anspruch, die alleinige Lösung zu sein. Wohl aber will es aufrütteln und dazu auffordern, Undenkbares zu denken, Unsagbares zu sagen. Und sich dabei auf Augenhöhe und fair begegnen zu lernen. Demokratie lebt von diesem Diskurs. Lasst ihn uns führen, bevor ihre Feinde unsere Fehler benutzen, ihr ein Ende zu bereiten.
Warum unsere Demokratie in Gefahr ist
Unsere Demokratie stirbt. Und ausgerechnet eine Pandemie macht diesen Prozess sichtbar. Es macht sich Wut breit in unserem Land – und diese zeigt sich besonders im Osten. Zwischen Politik und Menschen klafft ein Graben, der immer tiefer wird. Auf der einen Seite die vermeintlich Abgehängten, die man durch ein Übermaß an politischer Bekümmerung entmündigte und denen man so die Ankunft in einem selbstbestimmten System weitgehend verweigerte. Auf der anderen Seite eine Politik, die sich immer mehr vom Leben entfernt. Die sich einen eigenen Orbit geschaffen hat, der falsche Freiheiten proklamiert und echte Abhängigkeiten schafft. Wenn wir die Demokratie retten wollen, müssen wir alles anders machen.
Es liegt Wut über dem Land. Alte, gewachsene Wut. Sie ist aus Schmerzen und Erlebnissen gemacht. Aus Übersehen-Sein und Nicht-gehört-Werden. Diese Wut schlug Wurzeln, als die Mauer fiel und die Menschen naiv davon ausgingen, alles würde nun ganz automatisch gut. Sie glaubten, dass der neue Staat nun anders und viel besser für sie sorgen würde. Schließlich hatte er all die bunten Schaufenster und die D-Mark hervorgebracht, während der alte nur Mangel und Enge kannte. Wenig später erkannten die Menschen, dass im Schaufenster kaum noch Produkte aus eigener Produktion stehen würden und ihre Arbeit somit oft nicht mehr gebraucht wurde. Sie spürten, dass hier eine Entwicklung ihren Lauf genommen hatte, die wie ein Panzer durch jeden Lebenslauf rollen würde. Ohne dass der oder die Einzelne noch selbst Einfluss auf das große Ganze hätte nehmen können.
Jene Wut, die sich nährt aus dem Humus der Verletzungen: Umbruch, Dauerarbeitslosigkeit, Gesichtsverlust, Abwicklung. Es ist eine Wut, die in der Kälte der frühen 1990er Jahre heranwuchs. Ein Gefühl der Niederlage. Der Missachtung von Lebensleistung. Die misslungene Ankunft einer gerade neu geborenen Gesellschaft, obwohl die Menschen im Osten eigentlich auf einen gemeinsamen Neuanfang gehofft hatten. So wuchs sie heran, die kraftvolle Wut. Heimlich. Bis ins Heute. Gefüttert von Erinnerungen von einst und den politischen Kümmerern, die nun alles und jeden organisieren wollten und damit die Entwicklung von Eigenverantwortlichkeit verhinderten. Ungesehen und ungehört wie deren Träger, suchte sich diese Wut Ausdrucksformen. Die Folgen sind ein Rückzug in die private Heimlichkeit, die bewusste Abkehr von Teilhabe und das anonyme Kreuzen von Extremen auf dem Wahlzettel. Und jetzt, befeuert durch die aktuelle Situation der Coronapandemie, gewinnt diese Wut erneut an Kraft, wird breit und akzeptiert.
Der rumorende Osten. Erstmals scheinbar gewaltiger als der große Bruder West, der sich ähnlich wie zur Wende augenreibend und staunend vor dem Fernseher wiederfindet. Er bedroht nun sehr viel mehr, als wir wahrhaben wollen. Dieses schweigsam-wütende Land. Diese unerhörte Gesellschaft am Rande der zusammengeflickten Republik hat das Potenzial, das gesamte Land mitzureißen. Denn hier haben die Menschen eine tiefgreifende, epochale Erfahrung gemacht: Kollektive Verweigerung kann Systeme stürzen. Corona stellt nicht die größte Gefahr für unser Miteinander dar. Es sind nicht die AfD, der Dritte Weg, die Querdenker und was es sonst noch so gibt, die dieses Land und die Demokratie gefährden. Es ist das politische System selbst, das dies alles zu verantworten hat.
Zu lange haben wir grundlegende Probleme in unserem Land ignoriert. Nun wird uns im Zeitraffer klar, dass wir alles anders machen müssen. Dass diese Wut endlich eine Antwort verlangt, hat sich besonders im Verlauf der Coronapandemie gezeigt.
Es ist 2020. Ein hartes Jahr hat dem gesamten Land eine harte Prüfung auferlegt. Corona brachte alles zum Stillstand. Lockdown, Shutdown. Lockdown light. Weihnachten im Krisenmodus. Stille Nacht im Wortsinne. In föderalistischer Uneinigkeit stolperte sich die Republik im Frühjahr durch die erste Welle der Pandemie. Unterschiedliche Regeln in jedem Land. Komplex und im politischen Wettbewerb eher dynamisch als konsequent. Darüber ein Bund, der gemeinsam mit der Wissenschaft ebenso mahnend wie erfolglos suchte, Einigkeit zu schaffen. Darunter die Länder, die zuerst ihre Hoheiten verletzt sahen, bevor sie sich der Bedrohung stellten. Die Pandemie mit all ihren Auswirkungen offenbarte gnadenlos alle Schwächen am politischen Apparat dieses Landes. Der Kaiser stand nackt da. Splitterfasernackt sogar.
Wir erlebten Schulen, die in Ermangelung von digitalen Grundausstattungen einen Fernunterricht per Aufgabenzetteln am Gartenzaun organisierten. Eine Verzweiflungstat, die der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer noch zu einer Art Heimatgefühl zu verklären suchte. Dann die Entdeckung des Homeoffice, die zugleich sichtbar machte, in welch bedauernswertem Zustand die Kommunikationsnetze Deutschlands – einer immer noch führenden Wirtschaftsmacht – sich befinden und wie wenig digitale Kompetenz im Volk vorhanden ist. Milliardenhilfen rollten übers Land, suggerierten Tatkraft, Sicherheit und ein «Wir lassen niemanden zurück». In Wahrheit handelte es sich meist um Darlehen. Gut und nötig im Moment – am Ende für viele aber eher eine Hypothek, eine Wette auf eine mehr als ungewisse Zukunft. Gerade im Osten der Republik, wo die Eigenkapitalquoten und Ersparnisse auch nach 30 Jahren noch immer hoffnungslos denen im Westen hinterherhecheln. Ohne eine redliche Chance, diese jemals einzuholen.
Auch wenn das Land vorübergehend im Vergleich zum Rest der Welt zum Pandemievorbild in Sachen Kompensation erklärt wurde, waren die Auswirkungen dieser gesundheitlichen und politischen Krise für die Menschen im Land deutlich spürbar. Man denke nur an zahllose gastronomische Betriebe, die nach einem ungewissen Ende dieser Seuche 50000 Euro zusätzlicher Belastungen auf ihren Schultern wissen, danach aber nicht die doppelte Anzahl von Gästen zu erwarten haben. Daneben ganze Kohorten von Menschen, die von vornherein ganz durchs Raster fielen.
Oft traf es ausgerechnet die kreativen jungen Menschen, die sich bereits in neue, digitale oder künstlerische Arbeitswelten aufgemacht hatten: Die Programmierer, die Gestalter und Gründer. Diejenigen also, die man auch in der Politik gern aus Werbegründen hervorhebt, über deren Förderung man in Hochglanzdiskussionen philosophiert. Bei solchen Bestrebungen will die Politik eine Botschaft senden: «Seht her, wir sind hip in diesem Land. Wir bauen nicht nur Autos mit zweifelhaften Abgasnormen.» Doch genau diese hippen Kreativen, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass hierzulande Start-ups, Co-Working-Spaces und Creative Hubs keine Fremdwörter bleiben – ihnen wurde zum überwiegenden Teil wirkliche Hilfe versagt. Stattdessen winkten medienwirksam präsentierte Unterstützungen, die Betriebskosten auszugleichen suchten, wo keine waren. Nötig gewesen wäre ein Ersatz für ausgefallene Unternehmerlöhne und damit eine Existenzfinanzierung der Kreativszene. Und obwohl darüber monatelang öffentlich geredet wurde, wurden die nötigen Schritte schlicht nicht eingeleitet.
Ebenso traf es die Kulturszene, die einen nie dagewesenen Rückschlag verkraften musste. Jene so wichtige Branche, die oft den Kitt der Gesellschaft liefert. Die ausgleicht, spiegelt, Menschen Freude, Gleichgewicht und Offenheit verleiht. Auch sie wurde vergessen.
Zeitgleich flossen Milliarden in die Industrie. Altbekannte Muster wurden bedient. «Automotive forever!» Eben noch der Datenschwindelei überführt, erhielt dieser Industriezweig fünf Milliarden Euro. Insgesamt neun Milliarden flossen in die Kassen der Lufthansa. Schnell zeigte sich, welche Prioritäten dieses Land setzt. Und eben auch, welche nicht.
Zudem wurde auf alarmierende Weise offenbar, wie wenig lernfähig die Politik tatsächlich sein kann. Als nach einem entspannten Sommer, an dessen Ende die Virologinnen und Virologen sehr klar und für jeden vernehmbar eine zweite Welle vorausgesagt hatten, diese tatsächlich wie auf Ansage eintrat, da wiederholte sich dieser Albtraum vom Jahresbeginn. Wie in einem schlechten Déjà-vu. Warum? Weil die Politik schlicht und ergreifend die Zeit nicht genutzt hatte, die Fehler abzustellen. Statt das im Frühjahr Gelernte in einen konsequenten Plan zu gießen, der bei leisesten Anzeichen eines neuen Ausbruches aus der Tasche zu ziehen wäre. Statt zu verhindern, dass schon wieder nur halbherzige Entscheidungen getroffen werden. Statt Gesundheitsämter zu digitalisieren und so aufzustocken, dass diese einem neuen Ansturm besser gewachsen sein könnten. Stattdessen geschah weitgehend nichts. Ebenso fehlten langfristige Strategien, wie man künftig mit dem Virus leben könnte. Was wir in dieser Situation politisch wirklich gebraucht hätten, wären konsequente und lebensnahe Lösungen im Kleinen wie im Großen gewesen. Vielleicht hätte man verhindern können, dass die ganze Nation planlos von Halblockdown zu Halblockdown stolpern musste.
Zu Beginn der zweiten Welle blieb alles beim Alten. Statt Luftreinigern in den Schulen gab es von der Kanzlerin Hinweise zum Springen und Klatschen, sollte einem bei aufgerissenem Fenster im Dezember unter der Maske kalt werden. Statt digitaler Lernsysteme herrschte in Sachsen erst mal zwei Tage Server-Lockdown – angeblich soll ein Hackerangriff schuld gewesen sein. Wahrscheinlicher ist wohl die bloße Überlastung des Systems. Diese technischen Probleme begleiten das System bis zum heutigen Tag wie ein Schatten.
Verordnungen und Allgemeinverfügungen wurden mit erkennbar heißer Nadel gestrickt. Die letzte 2020, die schließlich den vorfristigen Lockdown in Sachsen verkündete, erreichte die Kommunen an einem Freitagabend. Umzusetzen zum darauffolgenden Montag. Ein Unding, wenn man zum Beispiel von den Eltern für die Notbetreuung der Kinder einen Nachweis des Arbeitgebers verlangt, der die Systemrelevanz der Tätigkeit bestätigt.
Chaos breitete sich aus. Und ebenso schnell das Virus. Es war ein erschreckendes Beispiel der immerwährenden Hand-in-den-Mund-Politik, die in Deutschland auch schon vor der Pandemie praktiziert wurde.
Dies alles erfasste auch meine Stadt. Augustusburg. Eine beschaulich schöne Kleinstadt, 17 Kilometer östlich von Chemnitz. Zwei Schulen. Ein Supermarkt. Ein bisschen Gewerbe. Ein bisschen Handwerk. Ein Skihang auf 500 Höhenmetern mit wenig Aussicht auf eine große Zukunft in Zeiten des Klimawandels. Keine arme Stadt. Eher eine Art Exklusivstandort im Speckgürtel von Chemnitz, dem Hidden Champion Sachsens. Schöne Wohnstandorte mit Villenbestand. Zwei Nachwendeneubaugebiete, wie es sie überall gibt. Weitgehend in sich geschlossene Satelliten. Heile, neue Welten mit Anschlussschwierigkeiten an das gewachsene Umland. Im Kern, hoch oben auf dem Berg und doch im Schatten des gewaltigen Jagdschlosses eine historische Altstadt. Viel Wald drumherum. 4500 Einwohnerinnen und Einwohner leben hier. Tendenz nach einem Jahrzehnte andauernden Aderlass wieder leicht steigend.
Es bleiben die Erinnerung an Zeiten, als jährlich Hunderttausende ebendieses über der Stadt thronende Jagdschloss besuchten, das Kurfürst August erbaut hatte. Der Großvater des Fürsten, der als der Starke in die Geschichte einging, war ein guter Regent, der den Grundstein des sächsischen Reichtums dadurch begründete, dass er neuen Dingen sehr aufgeschlossen gegenüberstand. So förderte er den Bergbau, der seinem Enkel später zu großem Reichtum verhalf. Alles kommt vom Bergwerk her, heißt es in der Region. Noch immer. Hier ist das Leben eigentlich noch halbwegs in Ordnung.
Aber auch in Augustusburg macht die typische Demographie des ländlichen Raumes das Buchstabieren von Zukunft immer schwieriger. Zwar gibt es noch eine Grundschule und auch ein privates Gymnasium. Aber spätestens mit dem Verlust der Oberschule Anfang der 2000er Jahre begannen die Menschen zu ahnen, dass das Schreckgespenst der sterbenden Stadt noch nicht verbannt worden ist. Eine kollektive Angst, die in den Menschen wohnt, seit Kunstlederfabrik und Baumwollspinnerei im Wendewandel verlorengingen. Damals, als die «gute alte Zeit» zusammen mit den Arbeitsplätzen unterging und durch Arbeitsamt, Umschulung und Stadtflucht ersetzt wurde. Diese kleine Stadt im Schatten des alten, ehrwürdigen Jagdschlosses. Sie kann als Beispiel gelten für einen ganzen Landstrich, für einen erheblichen Teil unseres Landes. Befreit und doch zu geschwächt, um aus eigener Kraft den Neuanfang zu wagen. Weil Menschen in Massen und in Klasse verlorengingen. Weil Arbeit hier immer noch Mangelware ist. Und nicht zuletzt, weil die Politik – den vielen Hochglanzreden vom Erhalt des ländlichen Raumes zum Trotz – nur Förderprogramme gebiert und keine Selbstbestimmung. Auch hier, in meiner Stadt, war beinahe jeder Glauben verloren, dass es irgendwann anders laufen könnte.
Wie auch anderswo im Osten wählten Bürgerinnen und Bürger hier zu Europa- und Landtagswahlen bis zu 30 Prozent AfD. Die Politik bekommt ihre gerechte Strafe, heißt es. Für all das, was auf den Menschen lastet. Und dafür, dass dies auch lange niemanden wirklich interessierte. Bei der letzten Bürgermeisterwahl wurde ich, der amtierende Sozialdemokrat, mit 68 Prozent der Stimmen sehr deutlich bestätigt. Gegen einen AfD-Kandidaten und drei weitere Bewerber. Weil man hier vor Ort Gesichter wählt, denen man vertraut. Vielleicht auch, weil die letzten Jahre Lokalpolitik die Stadt mit vereinten Kräften gut entwickeln konnte. Und vielleicht auch, weil in der letzten Konsequenz dann doch kaum jemand daran glaubt, dass die Alternative für Deutschland auch eine solche ist. Der scheinbare Widerspruch zwischen den Wahlen im Kleinen und im Großen. Er ist beispielgebend für den gesamten Osten. Und auch für den Rest des Landes.
Vorweg: Nein, ich mache das Ergebnis nicht an mir und meiner Person fest. Wenngleich es auch meine sowie die Arbeit aller anderen Beteiligten bestätigte und den Wunsch nach einem «Weiter so» deutlich signalisierte. Doch eine solche Wahl – wie inzwischen üblich – zu einer reinen Personenwahl zu verkleinern, um sich auf Parteiebene nicht mit unangenehmen Konsequenzen beschäftigen zu müssen, wäre trotzdem falsch. Natürlich wählen Bürgerinnen und Bürger gerne Menschen, denen sie vertrauen. Doch es gibt eine erschreckende Tendenz, Parteizugehörigkeit im Wahlkampf auszuklammern. Viele Kandidatinnen und Kandidaten lassen auch auf dem Wahlzettel inzwischen nur noch ihren Namen drucken, obwohl sie einer Partei angehören. Ja, man tarnt sich regelrecht, um seine Chancen als Bewerberin oder Bewerber um ein Amt zu steigern. Auch ich wurde ungläubig befragt, ob ich mich tatsächlich offiziell als SPD-Kandidat aufstellen lassen wolle. Und es folgte die Erklärung, dass ich das ja nicht müsse. Schließlich könne ich dies auch als Einzelbewerber tun. Aus den eigenen Parteireihen wohlgemerkt. Es wirkt ein wenig so, als hätte die Politik die Parteien schon fast aufgegeben – doch damit werden wir uns im folgenden Kapitel ausführlich beschäftigen.
Was also zeigen diese Wahlen, die die gesamte Republik zum Beben brachten? Dass es nicht die direkte, vor Ort erlebte und verantwortete Situation ist, die den allseits gefürchteten Aufstieg der AfD generiert und begründet. Es ist der politische Überbau, der als Problem identifiziert ist. Jener Apparat, der mit seinen etablierten Bestandteilen in Form der «Altparteien» und deren gefühlt ewig gleichen Kandidatinnen und Kandidaten seit Jahrzehnten die Geschicke des Landes lenkt. Immer gleiche Köpfe, die immer und immer wieder in jeweils anderer Funktion für eine Politik eintreten, die man hier (und nicht nur hier) nicht als die richtige ansieht. Es ist dieses übergeordnete «Weiter so», das diese Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger produziert, füttert und täglich neu auflädt. Ein Reflex der Notwehr, könnte man beinahe sagen. Eine Art kleine Rache und eine Genugtuung, die Menschen erfüllt, wenn sie ihr Kreuz bei der AfD setzen. Denn sie ahnen in diesem Moment den gewaltigen Aufschrei voraus, der daraus folgt. Und sie wissen, wie sehr sie das System damit treffen. In diesem einen Moment erhält ihre Stimme Bedeutung. In diesem Moment werden die Übersehenen sichtbar. Endlich. «Seht her. Mit uns müsst ihr nun rechnen.»
Tatsächlich glauben im Umkehrschluss nur wenige, dass diese vermeintliche Alternative wirklich Lösungen bietet. Vielmehr ist es der gelernte Feind, gegen den man sich auflehnen will. Einen Feind, den man von früher kennt, als die Diktatur des Proletariats abgehoben und unerreichbar als «das System» über das Land bestimmte. Ein gleicher Kampf mit den Mitteln, die diese scheinbar unantastbare Herrschaft damals beendete: dem Dagegensein. Verweigerung bringt Veränderung. Das ist die historische Erfahrung, deren Wucht nicht unterschätzt werden darf.
Der Irrtum im Rest der Republik besteht darin, anzunehmen, der Osten sei wirklich in breiter Masse für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf die Straße gegangen. Wenn es damals ein «Für etwas» gab, dann mehrheitlich ein materielles. Man wählte die D-Mark und die vermeintliche Freiheit, die der Mauerfall versprach. Nicht die Menschenrechte. Das Märchen der friedlichen Revolution. Es ist längst von der Geschichte eingeholt. Und was bis heute blieb, sind die ökonomischen Unterschiede, die noch immer ungleichen Entwicklungschancen zwischen West und Ost und die weitgehende politische Unsichtbarkeit und Bedeutungslosigkeit des sogenannten Beitrittsgebietes.
So liegen die Motive für eine nachhaltige Frustration im Osten der Bundesrepublik in vielen Feldern begründet. Und auch jene, die eigentlich als Erfolgsbeispiele der Wende gelten, können von diesem Sog erfasst werden. Zum Beispiel dann, wenn niemand ihr Lebenswerk fortführen möchte. Wenn das Unternehmen oder das Haus ein endliches Glück markieren, da die Kinder notgedrungen oder inzwischen beinahe automatisch ihr Heil in der Flucht gesucht haben. Erst in den Westen – nun in die großen Städte auch im Osten. Hauptsache weg.
All das suggeriert: Im Osten gibt es keine Zukunft. So sind längst nicht nur die «Abgehängten» wütend, also jene, die wirkliche Einschnitte, wirkliche Verluste beim Wechsel der Systeme erlitten haben. Die Unzufriedenheit mit dem «System» ist nicht mehr beschränkt auf die ewigen Nörgler, deren Klage zwischenzeitlich selbst hier in der ostdeutschen Gesellschaft niemand mehr aufnehmen wollte. Es betrifft nicht mehr nur Menschen, die im sozialen Aus ihr Dasein fristen müssen, weil sie seither nie wieder Anschluss an die Gesellschaft gefunden haben. Jene, die niemand mehr «brauchte».
Nein. Diese Wut frisst sich nun durch alle Schichten der Gesellschaft und speist sich aus vielen Ungerechtigkeiten, die nicht selten auch objektiv vorhanden sind: Bürokratie, lebensferne Verwaltungspraxis und eine entrückte Politik, die für viele einfach unerreichbar erscheint. Für die meisten hier ist dieses System somit vor allem eines. Weit weg. Dresden ist der Mond. Berlin die Milchstraße und Europa ist Pluto. Maximal empfängt man die Signale aus dem Orbit. Einen Rückkanal gibt es nicht.
Die Politik hat offenbar bereits vor Jahren beschlossen, den lokalen, erlebbaren Politikraum zu entpolitisieren und alle Verbindungen zu kappen. Anders ist nicht zu erklären, dass sie kampflos die letzte Meile der Politik zu den Bürgerinnen und Bürgern einfach räumte. Die Kommune als demokratischer Erlebnisraum wurde langsam, aber unaufhaltsam von den direkten Parteiverbindungen entkoppelt. Warum? Zum einen hatte die Politik des Kümmerns von oben herab den Menschen jegliche politische Kompetenz und Selbstbestimmung genommen. Zum anderen sinkt die Zahl derjenigen, die sich am untersten Ende der politischen Nahrungskette noch für eine Partei engagieren wollen. Zwar gibt es sie noch, die Ortsgruppen der Parteien. Aber sie werden kleiner. Und es ist selten, dass diese wirklich noch politisch aktiv sind. Im Ort. Nicht zuletzt, weil es eher nach Dienen denn nach Machen riecht.
Handlanger der übergeordneten Politik zu sein, reicht Menschen nicht, die sich wirklich engagieren wollen. Zu sehr erinnert dieses neue System mittlerweile an ein altes, das man vor drei Jahrzehnten abgelöst hatte. In dem der Parteisekretär vor Ort nicht selten schulterzuckend ausführte, was im Einheitsbrei der Partei beschlossen wurde.
So sind es nur noch wenige Bürgerinnen und Bürger, die wirklich eingebunden sind in das, was Politik tut. Ganz wenige, die wirklich Einfluss haben. Ein paar mehr, die das vielleicht noch glauben.
Dieser offensichtliche Mangel – diese Lücke zwischen Politik und wahrem Leben – wurde von uns jahrelang schlichtweg ignoriert. Statt in echte Basisarbeit zu gehen und den Menschen Politik wieder näherzubringen, verbreitete sich das Märchen der sachlichen Kommune. Hier wurde von einer fernen Welt berichtet, in der «Parteipolitik keine Rolle» spiele. «Da unten beim Volk. Da geht’s um die Sache und nicht ums Parteibuch oder ideologische Grabenkämpfe.» Das war die Botschaft. Abgesehen davon, dass die Bürgerinnen und Bürger sich wünschen, dass es außerhalb ihrer Kommune ebenfalls eher um die Sache und nicht um Parteipolitik gehen würde, eine wirklich absurde Strategie. Hier wurde die Entfremdung der Politik sichtbar. Das lange schon schwelende «die da oben» und «wir hier unten» wurde so vom Gefühl zur Realität.
Es war der bequeme Weg, den man gewählt hatte. Aber es war auch der Weg, der weg von der Basis führte. Die Folge: Einerseits beraubte man sich wichtiger Rückmeldungen dieser Basis, die essenziell für unsere Demokratie sind. Andererseits wurde Kommunalpolitik noch abhängiger davon, was auf Landes- oder Bundesebene geschah.
Mag sein, dass inzwischen einige diesen Fehler erkannt haben und beispielsweise die Jusos und andere aktiv in Diskussion darüber treten. Zu heilen ist der Schaden kaum, der über jahrzehntelange Entfremdung entstanden ist. Wir erleben nichts weniger als den Sterbeprozess unserer demokratischen Tugenden.
Unsere einzige Chance besteht darin, sich dem gigantischen Gesprächsstau in Demut zu stellen. Wer das tut, wird gute Nerven brauchen. Sie oder er begibt sich auf eine Mission mit ungewissem Ausgang, die aber unsere einzige Chance ist, wieder Anschluss zu finden.
Ja, ich weiß. Da sind die vielen Landtagsabgeordneten, die jetzt den Finger heben. Schließlich sind sie es doch, die diesen Kontakt herstellen sollen. Natürlich gibt es eine Menge politisch aktive Menschen, die unglaubliche Kilometer machen, Veranstaltungen abreißen, um irgendwie präsent zu sein. Und ja, es gibt auch viele, sehr viele, die ehrlich kämpfen, den Kontakt nicht nur zu halten, sondern auch aufzuwerten. Fakt aber ist: Ohne echte kommunale Basis. Ohne direkte Verantwortung keine Erdung. Ohne Erdung kein wirklicher Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. So schwebt die Politik inzwischen zum Großteil im luftleeren Raum und hat nicht zuletzt auch deshalb ihre Glaubwürdigkeit verloren. Was im Westen vielleicht in den Hinterzimmern, den Ortsgruppen und den bierseligen Stammtischen als gelernte politische Beteiligungsstruktur noch existiert, ist im Osten kaum entstanden.
So ist das Volk weitgehend allein mit sich und seinen Sorgen. Politischer «Widerstand» erwächst aus dem Gefühl, nicht selbst ändern zu können, was einen betrifft. Aus nicht geführten Diskussionen. Und aus Vorsicht. All dies hat gerade im Osten historische Wurzeln – und die daraus entstehenden Schicksale sind symptomatisch für den tiefen Graben, der in diesem Land zwischen Politik und Menschen entstanden ist. Beispiele dafür kenne ich viele.
Nehmen wir etwa eine Lehrerin, die bereits zu DDR-Zeiten engagiert war. Sie hat sich trotz des Stigmas der Konformität mit dem untergegangenen Land zurückgekämpft und bildet gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen faktisch das Rückgrat der ansonsten ziemlich maroden sächsischen Bildung.
Sie predigt keine DDR-Nostalgie und gibt alles, um den Kindern einen guten Start in diese Welt zu bahnen. Sie engagiert sich voller Energie und ohne Rücksicht auf Überstunden. Doch ihre Vorschläge, wie man Probleme trotz Personalmangel in den Griff bekommen könnte, verkümmern bereits auf Arbeitsebene. Niemand, der zuhört. Keine Debatte. Kein Interesse. Stattdessen eine offene Skepsis des staatlichen Kultusbetriebes gegenüber jenen «Altlehrenden».