

Buch
Nach dem Tod ihres Mannes sieht die irische Krankenschwester Katie die Zeit gekommen, sich endlich ihrer Vergangenheit zu stellen. Seit fast fünfzig Jahren bewahrt sie ein Geheimnis auf, gut versteckt im hintersten Winkel ihres Kleiderschranks: eine Kiste mit Armbändern von Babys, die in den Siebzigerjahren gegen den Willen ihrer Mütter zur Adoption freigegeben wurden. Unterstützt von ihrer Nichte Beth, will Katie möglichst viele Mütter und Kinder wieder vereinen. Die ersten Erfolge lassen nicht lange auf sich warten, und Geschichten voller Herzschmerz und Hoffnung kommen ans Licht. Doch noch ist Katie nicht bereit, ihr dunkelstes Geheimnis zu lüften …
Autorin
Rachael English ist eine irische Bestsellerautorin, Journalistin und Radiomoderatorin. Tausende Zuhörer kennen sie aus Irlands beliebtester Radiosendung »Morning Ireland«. Sie hat fünf Romane veröffentlicht und ist jetzt erstmals auch auf Deutsch zu lesen.
Rachael English

Das geheime Band
Roman
Aus dem Englischen von
Ann-Catherine Geuder
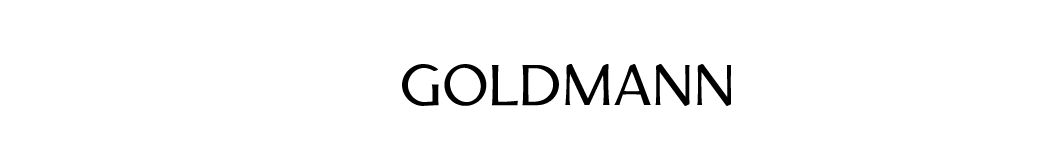
Die irische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »The Paper Bracelet« bei Hachette Books Ireland.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstveröffentlichung November 2021
Copyright © der Originalausgabe 2020 by Rachael English
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Umschlagmotiv: 1/3 U1 (Himmel): FinePic®, München;
2/3 U1 (Mädchen): Arcangel/JELENA SIMIC PETROVIC
Redaktion: Susanne Bartel
LS · Herstellung: ik
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-26825-1
V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz









Für Eamon
Kapitel 1
Damals – Patricia
Sie schlichen durch die Dunkelheit wie Tiere, das Oberlicht über der Eingangstür die einzige Beleuchtung. Es sei sicherer so, sagte ihr Vater. Man könne nie wissen, wer sich draußen herumtrieb. Er drückte die Tür auf und spähte nach links und rechts. Die Sterne funkelten am Firmament, und der Mond hing wie eine Schiffsschaukel über der Straße. Es war kalt für April.
»Ich hoffe, es hat keinen Unfall gegeben«, sagte er.
»Er wird gleich da sein«, erwiderte ihre Mutter. »Um zehn, hat er gesagt. Es ist erst fünf nach.« Sie wandte sich gereizt um, ihr schmales Gesicht vor Unmut verzogen. »Bleib im Haus, Patricia. Nicht dass dich noch jemand sieht.«
Sie benutzten schon ihren neuen Namen, nannten sie so, wie sie in Carrigbrack heißen würde. Es sei nur zu ihrem Besten, betonten sie. So würde sie nicht zu viel von sich verraten. Und das war in dieser Situation entscheidend. Nur ein falsches Wort, und der Ruf einer jungen Frau wäre für immer ruiniert. Dann würde sie niemals einen respektablen Ehemann finden oder ein normales Familienleben führen. Sie wäre gebrandmarkt, wohin sie auch gehen würde, und kein guter Mann würde sein Ansehen durch eine Verbindung mit ihr beflecken.
Sie vermutete, dass es die Situation für ihre Eltern einfacher machte, wenn sie einen anderen Namen verwendeten. Es war nicht ihre Tochter, die Schande über sich gebracht hatte, sondern Patricia. Ihre Tochter war anständig. Sie sang im Chor und bestand jede Prüfung. Sie hielt sich an Regeln. Patricia hingegen war ein Flittchen.
Damit auch garantiert niemand etwas merkte, hatten sie sogar eine Perücke besorgt und sie angewiesen, sie aufzusetzen. Die langen schwarzen Haare stanken nach Plastik und Zigarettenrauch.
»Falls dich jemand mit Pater Cusack im Wagen sieht«, hatte ihre Mutter erklärt. »Wir wollen nicht, dass die Leute Fragen stellen.«
»Früher oder später wird sich schon jemand nach mir erkundigen. Was dann?«
»Wir werden ihnen sagen, dass du in England bist.«
»Was ist mit den Leuten von der Arbeit?«
»Denen sagen wir das Gleiche.«
Eine Zeit lang hatte sie die Wahrheit geleugnet. Sie hatte nichts gesagt, weil sie es sich selbst nicht eingestehen konnte. Dann hatte sie versucht, einen Handel mit Gott abzuschließen oder mit dem Universum oder mit was auch immer da draußen war. Lass es verschwinden, und ich werde mich ändern. Versprochen. Als sie es schließlich ihren Eltern erzählt hatte, war alles Schlag auf Schlag gegangen. Die Fragen, die Blicke, die zwischen ihnen hin und her flogen, das Weinen ihrer Mutter, die kontrollierte Wut ihres Vaters – sie hatte alles nur noch wie durch einen Nebel wahrgenommen. Inzwischen bedauerte sie, dass sie nicht weggerannt war. Sie hatte überlegt, mit dem Bus nach London zu fahren, aber dort kannte sie niemanden, und das wenige Geld, das sie gespart hatte, wäre schon bald aufgebraucht gewesen.
»Was haben wir falsch gemacht?«, fragte ihre Mutter immer wieder.
»Nichts«, sagte ihr Vater. »Manche Mädchen werden wegen ihrer schlechten Erziehung zu Flittchen, aber das haben wir uns nicht vorzuwerfen. Sie hat sich ihr Fehlverhalten selbst zuzuschreiben.«
Auch wenn ihre Eltern noch nie besonders gut darin gewesen waren, Zuneigung zu zeigen, war Patricia immer davon ausgegangen, dass sie sie liebten. Ihre Liebe hatte sich in Form von blank polierten Schuhen und einem neuen Mantel für die Schule gezeigt, von Abendessen, das auf dem Tisch stand, und von Ausflügen ans Meer. Im Vergleich zu anderen Eltern hatten ihre den Holzlöffel nur selten eingesetzt. Ab und zu redeten sie davon, welche Opfer sie für ihre Kinder brachten. Andere Mädchen mussten mit fünfzehn die Schule verlassen und ihr eigenes Geld verdienen. Patricias Eltern hingegen hatten es ihr ermöglicht, ihren Schulabschluss zu machen. Ab und zu sprachen sie darüber, dass Mädchen einem ständig Sorgen bereiteten. Patricia hatte noch Teile eines Gesprächs im Ohr, das ihre Mutter mit einer Nachbarin geführt hatte. »Bei Mädchen ist man immer ein wenig nervös. Mit Jungs hat man es leichter. Jungs sind unkomplizierter.«
Nach ein paar Stunden war die Wut ihres Vaters verraucht gewesen. Er verließ das Haus, nur um dreißig Minuten später mit dem Gemeindepfarrer zurückzukehren. Pater Cusacks weißes Haar war ordentlich frisiert, aber zu dünn, um seine rosafarbene Glatze zu verdecken. Tiefe Falten zerfurchten sein Gesicht, ähnelten Rissen in getrocknetem Schlamm. Ihre Eltern führten ihn in die gute Stube, wo er sich auf das braune Sofa setzte und sich eine Zigarette anzündete. Er nahm einen Zug, stieß langsam einen Rauchkringel aus und tadelte sie dafür, dass sie ihrer allseits angesehenen Familie eine solche Schande bereitete. Ansonsten schien er nicht sonderlich verärgert zu sein. Eher wirkte er wie jemand, der wusste, was zu tun war, weil er es schon unzählige Male getan hatte.
Patricia konzentrierte sich auf die Tapetenbahn in Grün und Orange, die sich hinter dem Pater von der Wand löste. Auf der Straße sprangen ein paar Mädchen Seil. Fröhlich sangen sie: »Henriette, gold’ne Kette, gold’ner Schuh, wie alt bist du?«
»Du bist jetzt neunzehn, oder?«, sagte Pater Cusack.
»Zwanzig, Pater.«
»Und in welchem Monat, denkst du?«
»Im fünften«, sagte sie und klang dabei gefasster, als sie sich fühlte. »Vielleicht auch im sechsten.«
»Also kommt das Baby wahrscheinlich im August. Sag, meinst du, der Vater könnte bereit sein, dich zu heiraten?«
»O Gott, nein. Ganz bestimmt nicht.«
»Still«, fuhr ihre Mutter sie an. »Du hast kein Recht, so zu sprechen.«
»Aber ich sage doch nur die Wahrheit.«
»Also schön«, ergriff der Pater wieder das Wort. »Ich denke, es wäre das Beste, wenn du in die Küche gehst und uns einen Tee machst.«
Sie lauschte vom Flur aus. Ihre Eltern waren leicht zu verstehen. Sie erzählten dem Geistlichen von Mike. Er hingegen sprach mit leiser, sanfter Stimme, sodass sie nur bruchstückhaft aufschnappen konnte, was er sagte.
»Eine zuverlässige Einrichtung«, hörte sie. Und dann: »die Moral«, gefolgt von »überraschend häufig« und »morgen«.
Die Mädchen draußen sangen inzwischen einen anderen Reim. »Wie viele Pferde steh’n im Stall …«
Später begleitete Patricias Mutter Pater Cusack zum Gemeindehaus, in dem es ein Telefon gab. Der Geistliche rief das Heim in Carrigbrack an und sprach mit einer Frau namens Schwester Agnes. Ihre Mutter kam zurück und wies sie an, was sie zu tun hatte.
»Pack einen kleinen Koffer«, sagte sie. »Du brauchst zwei Nachthemden, einen Waschlappen, eine Zahnbürste. Unterwäsche. Und robustes Schuhwerk. Pack keinen Firlefanz ein, keine Bücher oder Make-up.« Da die Mädchen eine Art Uniform trügen, brauche sie keine Wechselkleidung. »Deine eigenen Kleider werden dir eh nicht mehr lange passen«, hatte sie hinzugefügt.
Vierundzwanzig Stunden später standen sie nun im Flur und taten, als ergebe das alles einen Sinn. Die Atmosphäre war verpestet, Verbitterung und Enttäuschung hingen in der Luft.
Patricia presste sich die Finger auf die Stirn. »Was, wenn ich das Kind behalten will?«
Die Wut ihres Vaters flackerte erneut auf. »Bitte«, sagte er. »Wir können jetzt wirklich kein dummes Geschwätz gebrauchen.«
»Aber ich habe von Mädchen gehört, die ihre Babys behalten haben. In Dublin. Niemand hier muss davon wissen.«
»Es ist mir egal, was in Dublin passiert. Was falsch ist, ist falsch. Willst du etwa deine Mutter umbringen? Willst du das?«
Sie hätte ihm so vieles antworten können, aber wozu? Es hatte ja doch keinen Sinn. Sie war so schrecklich erschöpft. Um ihre Augen herum pochte ein dumpfer Schmerz, und etwas Schweres hatte sich auf ihre Brust gelegt. Außerdem fürchtete sie, dass sie wieder zu weinen beginnen würde, wenn sie weiterstritten. Und das wäre ein Fehler.
In diesem Augenblick hörten sie das Tuckern eines alten Hillman Minx. Ihr Vater öffnete die Tür gerade weit genug, um sich der Ankunft des Geistlichen zu vergewissern.
Er nickte Patricia zu. »Besser, du lässt ihn nicht warten.«
Sie zögerte, fragte sich, ob ihre Eltern sie zum Abschied küssen oder vielleicht sogar umarmen würden. Sie hoffte auf ein Zeichen, egal, wie klein, dass sie ihr vergeben würden. Als keiner der beiden Anstalten in der Richtung machte, griff sie nach ihrem Koffer.
»Dann geh ich jetzt«, sagte sie.
Ihre Mutter wandte sich ab. »So Gott will, sehen wir dich später im Jahr wieder.«
Kapitel 2
Heute – Katie
Katie Carroll saß auf der Bettkante. Jeden Tag saß sie an derselben Stelle und sagte dieselben Sätze, jeden Tag stand sie wieder auf und tat es nicht. Gab es vielleicht ein besonderes Wort, fragte sie sich, für diese eine Aufgabe, die man nicht erledigen konnte? Das beschrieb, wie der Verstand mit einem Mal zu Brei wurde und Arme und Beine sich weigerten zu funktionieren? Falls nicht, sollte sie eins erfinden.
Milchiges Sonnenlicht hing im Schlafzimmer. Dublin hatte einen ungewöhnlich heißen Sommer hinter sich. Mittlerweile waren die Temperaturen gesunken, aber tagsüber strahlte die Sonne noch immer vom Himmel. Irgendwo in der Nähe brummte ein Rasenmäher. In der Griffin Road kannte man keine ungepflegten Gärten.
Und es gab nicht nur eine Aufgabe, der Katie sich nicht stellen konnte, sondern dazu noch Hunderte von unbeantworteten Fragen. Seit zwei Monaten gingen sie ihr unaufhörlich durch den Kopf. Was wirst du jetzt tun? Ist das Haus zu groß für dich? Könntest du dir vorstellen, es zu verkaufen? Wie wäre es umzuziehen?
Margo hatte sich als Erste nach ihren Plänen erkundigt. Andere hatten es ihr gleichgetan. Es war schon merkwürdig: Während Katie die Nachfragen ihrer Freunde und Bekannten einfach ignorieren konnte, funktionierte das mit denen von Margo nicht. Es musste am Tonfall ihrer Schwester liegen, an dieser Mischung aus Mitgefühl und Herablassung, dass Katie ihr am liebsten eine dreiste Antwort entgegengeschleudert hätte. Zum Beispiel, dass sie mit dem Gedanken spielte, nach Thailand auszuwandern oder sich einen jungen Liebhaber zuzulegen. Natürlich hatte sie nichts dergleichen gesagt, sondern nur etwas gemurmelt von wegen: »Bin mir nicht sicher«, und: »Ich brauche noch Zeit.«
Es gab Momente, in denen sie es vergaß. Wenn sie sich über das knarrende Dielenbrett auf dem oberen Treppenabsatz ärgerte und dachte: Ich muss Johnny bitten, etwas deswegen zu unternehmen. Wenn sie sich im Bett umdrehte und erwartete, seinen warmen, seifigen Geruch einzuatmen. Wenn sie aufwachte und für einen Augenblick in ihrem Kopf alles leer war.
Das waren die kurzen Momente des Glücks, bevor die Wahrheit sich wieder ihren Weg in ihr Bewusstsein bahnte.
Die Leute – gut meinende Leute – behaupteten, ihr Verhalten sei normal. »Sei nicht so hart zu dir«, sagten sie. »Ehrlich, du hältst dich wacker. In Anbetracht der Situation.«
Letzteres bezog sich darauf, wie plötzlich Johnny verstorben war. Nach der Diagnose hatte er nur noch vier Monate gelebt. Als Krankenschwester wusste Katie, dass keine Krankheit so ungerecht war wie Krebs. Mit einer Diagnose konnte man ein Jahr später noch auf Lanzarote Urlaub machen und anderen von seiner Zeit im Krankenhaus erzählen. Mit einer anderen hatte man kaum noch Zeit, sich zu verabschieden. Sie sagte sich, dass das Sterben ihres Mannes nichts Außergewöhnliches gewesen war. Er war vierundsiebzig gewesen, nicht extrem alt, aber auch nicht mehr jung. Alt genug, dass sein Tod nicht als Tragödie galt.
Auf der Beerdigung hatte sie sich beherrscht. Sie war dazu erzogen worden, öffentlichen Trauerbekundungen zu misstrauen. Damals war das so üblich gewesen. War es nicht verrückt, dass eine neunundsechzigjährige Frau noch immer davon beeinflusst wurde, was man ihr als Kind beigebracht hatte? Aber so war es. Ehrlich gesagt wollte sie nichts lieber als allein sein. Oh, sie wusste, dass sie nicht undankbar sein durfte. Es war wunderbar, dass sich so viele Menschen die Mühe gemacht hatten zu kommen, dass sie ihr ihr Beileid aussprachen und nette Erinnerungen austauschten. Einige von denen, die extra aus ihrem Heimatort Danganstown angereist waren, hatte sie seit Jahren nicht gesehen. Andere kamen sogar aus dem Ausland. Einer von Johnnys Neffen aus Madrid, Margos Tochter Beth aus London.
Im ersten Monat danach war Katie gut beschäftigt gewesen. Freunde hatten vorbeigeschaut, ihr Essen gebracht, sich mit ihr unterhalten und ihr Tee gekocht. Sie hatte Dankeskarten geschrieben und begonnen, sich mit dem vielen Papierkram auseinanderzusetzen. Aber die Leben der anderen gingen weiter. Selbst die engsten Freunde hatten irgendwann andere Prioritäten, andere Sorgen und Aufgaben.
Außerdem hatte sich Katie noch nie gerne auf andere verlassen. Schon früh hatte sie gelernt, dass dies in der Regel nur zu Enttäuschungen führte. Die meiste Zeit im Leben war ihr Johnny genug gewesen. Er hatte dasselbe über sie gesagt. Halb zufällig, halb absichtlich hatten sie sich einen überschaubaren Freundeskreis aufgebaut. Schon immer hatte sie ein Treffen in kleiner Runde dem Tamtam und Lärm größerer Veranstaltungen vorgezogen.
Jetzt war sie hier, wieder im Schlafzimmer, und die Säcke standen bereit. Sie musste nur noch Johnnys beste Kleidung zusammensuchen und dann zum Sozialkaufhaus bringen. Sie stand vom Bett auf, öffnete den Kleiderschrank aus Mahagoni und nahm ein hellblaues Hemd heraus. Doch anstatt es in einen Plastiksack zu tun, schmiegte sie ihr Gesicht in den Stoff. Für ein paar Minuten stand sie da, wippte auf den Fußballen auf und ab und spürte das vertraute Brennen hinter den Augen. Wie dumm von ihr! Die Kleidung war in gutem Zustand. Andere Männer hätten dafür Verwendung. Aber das Leben hatte Katie gelehrt, dass es einen großen Unterschied machte, ob man einfach nur begriff, wie dumm das eigene Verhalten war, oder auch etwas dagegen unternahm.
Sie legte das Hemd wieder in den Schrank zurück. »Ein andermal«, flüsterte sie. »Ein andermal, nicht jetzt.«
Die Trauer war unberechenbar. Meistens war Katie wie gelähmt vor Müdigkeit. Dann hätte sie sich am liebsten in ihrem Verlust verkrochen und in Ruhe getrauert. Doch manchmal verspürte sie auch eine pochende Wut. Sie war wütend auf die Nachbarn, weil sie Plattitüden sagten wie: »Die Zeit heilt alle Wunden.« Sie war wütend auf Johnny, weil er sie verlassen hatte. Schließlich war sie glücklich mit ihrem gemeinsamen Leben gewesen – es hatte keine Notwendigkeit gegeben, irgendetwas daran zu ändern. Meistens jedoch war sie wütend auf sich selbst. Warum nur hatte sie nicht mitbekommen, dass etwas mit ihm nicht stimmte? Was war sie bloß für eine Krankenschwester! Warum hatte sie jahrelang ihre Energie darauf verschwendet, sich über unwichtiges Zeug Gedanken zu machen? Warum hatte sie nicht einfach das genossen, was ihr geschenkt worden war? Wenn diese Gedanken sie quälten, rannte sie durchs Haus wie eine Irre und hätte am liebsten laut herumgeschrien und auf irgendetwas eingeschlagen. Und dann wurde ihr mit einem Mal klar: Vielleicht verspürte sie ja gar keine Wut. Sondern Schuld.
Eine Weile grübelte sie darüber nach, bis ihr einer von Beths Lieblingssprüchen einfiel: Lass locker!
Anstatt den Kleiderschrank zu schließen, griff sie jetzt mit dem Arm tief hinein und holte einen Karton heraus. Früher mal war ein Paar Sandalen mit Korkabsatz darin gewesen. Wenn sie sich richtig erinnerte, hatte Johnny sie nie besonders gemocht. Und auch bezüglich des gegenwärtigen Inhalts hatte er gemischte Gefühle gehabt. »Im Ernst, Kateser«, hatte er gesagt, »du würdest dich doch nur jedes Mal aufregen. Und überhaupt, die meisten dieser Frauen sind vermutlich längst gestorben.«
Sie glaubte nicht, dass das stimmte. Ja, die Frauen wären inzwischen alt, aber was bedeutete das schon? Schließlich war das Alter eine komplexe Angelegenheit. Wenn in den Nachrichten von einer Frau Ende sechzig die Rede war, stellte Katie sich immer eine verhutzelte Frau mit schlohweißem Haar, schlecht sitzendem Gebiss und beigen Kleidern aus knitterfreiem Stoff oder Tweed vor. Dieses Bild stammte noch aus ihrer Kindheit, als Menschen im Rentenalter mit einer Decke auf dem Schoß in einer Ecke saßen und vor sich hin welkten. Wobei Katie selbst nicht bereit war, diesem Bild zu entsprechen. Sie wollte nicht schrumpeln und verblassen. Selbst an ihren schlechtesten Tagen verzichtete sie nie auf Lippenstift und Mascara. Zwei Wochen nach Johnnys Tod hatte sie sich ihre blondierten Haarsträhnen auffrischen lassen. Vermutlich hätte ihm das gefallen.
Sie setzte sich wieder aufs Bett, nahm den Deckel vom Karton und betrachtete den Inhalt. Das Notizbuch und die zarten Armbänder aus einfachen Papierstreifen versetzten sie beinahe fünfzig Jahre zurück in die Vergangenheit. Sie war zweiundzwanzig gewesen, als sie angefangen hatte, in Carrigbrack zu arbeiten. Damals redeten die Leute kaum darüber, was dort geschah. Wenn, dann nur in Euphemismen. Carrigbrack war ein Heim für Mädchen, die »sich selbst in Schwierigkeiten« gebracht hatten, ein Ort, an dem sie »über ihr Fehlverhalten nachdenken« und »ihre Selbstachtung zurückgewinnen« konnten.
Das Notizbuch hatte einen fleckigen braunen Umschlag, und seine Seiten waren mit der Zeit spröde geworden. Katie öffnete es aufs Geratewohl. Die Schrift, mit Tinte, war klein und akkurat.
19. Oktober 1971. Junge, 2767 Gramm. Mutter, 19 J., aus Co. Limerick. Name: Goretti. Sagt, ihr Baby soll Declan heißen. Ihr Freund ist in Birmingham, sie will mit ihrem Baby zu ihm ziehen.
Die Jahre hatten Katies Erinnerungen sicherlich verzerrt, und doch sah sie die jungen Frauen und ihre Babys noch immer vor sich. Die »gefallenen Frauen«, wie manche sie zu nennen pflegten, als wären sie Figuren aus der Bibel oder einer Schmonzette. Womit auch immer Katie gerade beschäftigt war, ein Geräusch oder ein Geruch konnte sie urplötzlich in diese Zeit zurückkatapultieren. In die Zeit von Schlaghosen und Plateaustiefeln, Schwarz-Weiß-Fernsehen und Vietnam. Von kalkulierter Grausamkeit und unerwarteter Freundlichkeit. Noch immer hörte sie das einsame Schluchzen, das durch das Gebäude hallte. Roch Desinfektionsmittel und Corned Beef. Sah die feuchten Flecken an der Wand. Spürte die Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit.
Auch an ihr eigenes Versagen erinnerte sie sich.
Ein Außenstehender könnte vermuten, dass Johnny ihr verboten hatte, etwas wegen der Papierarmbänder zu unternehmen. Doch so war es nicht. Johnny hatte sie beschützt, aber nicht kontrolliert. Ihre eigenen Ängste hatten sie gehindert. Und doch – sosehr sie auch versuchte, ihre Erinnerungen beiseitezudrängen, kamen sie doch immer wieder zurück. Wie ihre Kindheit in Danganstown und ihre Ehe mit Johnny war auch Carrigbrack Teil ihrer Geschichte. Und wenn die Geschichte jetzt enden würde, hätte sie nicht den Schluss, den sie sich wünschte.
»Carrigbrack?«, sagte Beth und kräuselte die Nase. »Ja, natürlich hab ich davon schon gehört. Das ist im Norden von Clare, in der Nähe vom Burren-Nationalpark. War da nicht ein großes Mutter-Kind-Heim?«
»Mmm. Nicht so riesig wie ein paar andere, aber für seine Zeit schon ziemlich groß.«
»Und was hast du da gemacht?«
»Ich war Krankenschwester«, sagte Katie und fuhr mit der Hand über den Rand des Schuhkartons.
Sie saßen in der Küche und tranken den Milchkaffee, den Beth in einem Café in der Nähe vom College in Drumcondra gekauft hatte.
Einen Monat nach Johnnys Beerdigung war Katies Nichte dauerhaft nach Irland zurückgekehrt. »Ich hatte ganz vergessen, wie sehr ich Dublin mag«, hatte sie erklärt. Einen Job bei einer Internetfirma hatte sie schon gefunden, eine bezahlbare Wohnung zu finden gestaltete sich wesentlich schwieriger. Erst einmal war sie bei alten College-Freunden in Stoneybatter untergekommen. Trotz des Altersunterschiedes hatten Beth und Katie einen guten Draht zueinander. Auch weil Beth, anders als ihre Mutter, kein Interesse daran zu haben schien, Katies Leben neu zu gestalten.
Ihr Kontakt war in den letzten Jahren eher sporadisch gewesen. Katie besuchte ihren Heimatort nur selten, aber ihre Nichte hatte sie immer gemocht. Beth war ein aufgewecktes und nicht gerade schüchternes Mädchen gewesen und voller Fragen zu Katies Leben in Dublin. Margo schien ausgelaugt von ihr gewesen zu sein. Aber welche Mutter einer Sechsjährigen war nicht fortwährend erschöpft?
»Musste man nicht Nonne sein, um in so einer Einrichtung wie Carrigbrack zu arbeiten?«, fragte Beth jetzt.
»Die meisten von uns waren es«, sagte Katie. »Nur zwei oder drei nicht. Wir waren einfach … nun, ich schätze, man könnte sagen, wir waren so etwas wie Aushilfen. Ich hatte damals gerade erst meine Ausbildung abgeschlossen.«
»Gab es denn keine anderen Jobs?«
»Kaum. Es war nicht leicht, Arbeit zu finden. Und außerdem war Carrigbrack ganz in der Nähe von zu Hause, nur dreißig oder vierzig Meilen von Danganstown entfernt.«
»Schon verstanden. Aber war es nicht seltsam, dort zu arbeiten?«
Katie begann, sich zu fragen, ob es wirklich eine so gute Idee gewesen war, sich Beth anzuvertrauen. Für die Generation ihrer Nichte war alles schwarz oder weiß, unfassbar toll oder unentschuldbar. Die jungen Leute waren sich der Welt – und ihres Platzes in ihr – in einem Ausmaß sicher, wie Katie es nie vergönnt gewesen war. Dazu kam noch ihre direkte Art – ganz anders als die der älteren Generation, die immer versucht hatte, alles Unangenehme unter den Teppich zu kehren, den Schein zu wahren. Vermutlich war das sehr viel besser, dachte Katie. Trotzdem fiel es ihr manchmal schwer, mit Beths Freimütigkeit umzugehen.
»Ich hatte keine große Wahl«, erwiderte sie. »Mam und Dad haben von dem Job erfahren, und damit war es entschieden. Was ich wollte, spielte keine Rolle.«
»War es schlimm?«
»Wenn du wissen willst, ob es körperliche Züchtigung gab, dann lautet die Antwort Nein. Jedenfalls nicht offiziell. Trotzdem war es brutal. Von den jungen Frauen wurde erwartet, dass sie bis kurz vor der Geburt arbeiteten. Als Ort, an dem man glücklich war, würde ich das Heim nicht bezeichnen.«
Beth schüttelte den Kopf. »Was ich nicht kapiere, ist, warum alle diesen Mist so lange akzeptiert haben. Haben die Leute wirklich gedacht, dass es eine gute Idee ist, die eigene Tochter in eine solche Einrichtung abzuschieben?«
Katie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Sie wollte Beth nicht ausweichen, war aber auch nicht in der Lage, eine Antwort zu geben, die allen Aspekten ihrer Frage gerecht wurde. Sie holte tief Luft. »Ich habe viel darüber nachgedacht. Im Nachhinein ist es schwer zu sagen, wo fehlerhaftes Verhalten in Grausamkeit übergegangen ist. Die Leute damals hatten Angst. Angst vor der Kirche. Angst vor ihren Nachbarn. Angst davor, nicht mehr als anständig zu gelten.«
»Aber …«
»Ich glaube, du musst dir bewusst machen, dass die meisten Menschen damals ein ganz anderes Leben geführt haben als heute. Zu meiner Zeit war von Verhütung noch keine Rede. Du wurdest gewarnt, keinen Sex vor der Ehe zu haben. Hattest du ihn doch und wurdest schwanger, musstest du heiraten. Wenn das nicht ging, wurdest du weggeschickt, und das Baby wurde zur Adoption freigegeben. So war das damals, und auch wenn es verrückt klingen mag, haben die meisten Leute es doch akzeptiert.«
»Es klingt verrückt, weil es verrückt war. Total schwachsinnig.«
Katie zuckte bei Beths scharfem Tonfall zusammen und blickte in ihre Tasse. Einen Moment lang schwiegen beide. Auf der Straße genoss eine Gruppe Kinder einen der letzten Sommertage. Ihr Kreischen und Rufen durchbrach die Stille.
»Bitte entschuldige, Katie«, sagte Beth schließlich. »Es war falsch, dich so anzufahren. Ich finde es wirklich gut, dass du mir davon erzählst. Es kommt mir nur so schrecklich makaber vor, verstehst du?«
Katie lehnte sich zu ihrer Nichte hinüber und tätschelte ihr das Handgelenk. »Schon okay, Liebes. Ich will ganz sicher nichts schönreden. Makaber ist genau der richtige Ausdruck.«
»Also, was hat es mit dem Schuhkarton auf sich?«
»Nun, als ich in Carrigbrack gearbeitet habe, entschloss ich mich, die Geburten zu protokollieren.« Sie hielt inne, um den Deckel der Box abzunehmen und das Notizbuch hervorzuholen. »Wenn ein Baby auf die Welt kam, wurde darüber nicht weiter gesprochen. Es durfte nicht gefeiert werden, und auch sonst war es niemandem erlaubt, großes Gewese darum zu machen. Den Müttern wurde gesagt, sie sollten besser über die Sünde nachdenken, die sie begangen hatten und die sie nach Carrigbrack gebracht hatte. ›Je mehr ihr leidet, desto besser‹, sagte eine der Nonnen, Schwester Sabina, für gewöhnlich zu ihnen. Jedenfalls wusste ich inzwischen, dass den Müttern in den meisten Fällen nur eine begrenzte Zeit mit ihren Kindern vergönnt war, ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Dann wurde ihnen ihr Baby weggenommen. Einfach so.«
»Und die Mutter erfuhr nicht, wohin ihr Kind gegeben wurde?«
»Genau. In gewisser Weise war die Trennung für die Mutter umso schlimmer, je länger sie ihr Baby hatte behalten können. Denn auch wenn den jungen Frauen gesagt wurde, dass sie keine Bindung zu ihrem Kind aufbauen sollten, taten es die meisten doch.«
Katie stockte. Ein Bild tauchte vor ihrem inneren Auge auf. Das Bild einer verängstigten jungen Frau, deren Sohn fünf Monate bei ihr in Carrigbrack geblieben war. Sie hatte ihn nicht hergeben wollen, war überzeugt davon gewesen, dass sie es schaffen würde, ihm eine gute Mutter zu sein. Doch dann, an einem regnerischen Freitagnachmittag, wurde er ihr weggenommen. Als sie begriff, dass sie ihn niemals zurückbekommen würde, legte sie sich auf den Boden und schluchzte laut vor Kummer.
Es war nur ein Bild. Eine Geschichte von vielen. Aber es war immer noch da.
Verwundert stellte Katie fest, dass ihre Augen feucht waren. »Bitte entschuldige. Kein Grund für mich, so rührselig zu werden. Darum geht es hier nicht.«
»Schon in Ordnung«, erwiderte Beth. »Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen sein muss. Also …«
»Du willst wissen, was es mit dem Notizbuch auf sich hat? Nun, damals habe ich beschlossen, jede Geburt aufzuschreiben – ein paar Informationen über die Mütter und ihre Babys. Und die hier habe ich auch aufgehoben.« Sie nahm zwei Papierarmbänder aus dem Karton. »Die Babys trugen sie zur Identifizierung. Wie du siehst, sind es bei Weitem nicht solche Hightech-Dinger, wie es sie heutzutage in den Krankenhäusern gibt. Nur ein Stück Papier mit dem Namen der Mutter, dem des Babys und den Daten.« Sie reichte ihrer Nichte eins der Armbänder.
»Junge. Eugene«, las Beth. »5. Januar 1972. 3231 Gramm. Mutter: Loretta.«
»Loretta war natürlich nicht ihr richtiger Name«, sagte Katie. »Im Heim hießen sie alle anders. Und eins kann ich dir sagen: Es wurde streng darauf geachtet, dass ausschließlich die falschen Namen benutzt wurden.«
»Eugenes Name wurde nach seiner Adoption bestimmt auch geändert«, meinte Beth und strich über die Schrift.
»Wahrscheinlich. Gott allein weiß, wo der kleine Kerl letztlich gelandet ist.«
»Aber wo auch immer er jetzt ist – er würde das Armband und deine Notizen sicher gerne haben wollen. Beides könnte ihm helfen, seine biologische Mutter zu finden.«
»Falls er das möchte. Aber vielleicht hat er das auch längst schon getan. Immerhin ist er jetzt sechsundvierzig, und Loretta dürfte an die siebzig sein.«
Beths runde blaue Augen glänzten. Nicht nur ihren kleinen Mund und die schmale Nase, auch die Augen hatte sie von ihrer Familie mütterlicherseits geerbt. Aber während Katie und Margo unter ihren eher flachen Gesichtern gelitten hatten, war Beth mit den markanten Wangenknochen ihres Vaters gesegnet. Jetzt, mit achtundzwanzig, sah sie aus wie eine verbesserte Ausgabe ihrer Mutter.
»Wie viele Armbänder hast du?«, fragte sie.
»Siebenundvierzig. Ich habe etwas mehr als ein Jahr in Carrigbrack gearbeitet, lange genug, um die Geburt von über fünfzig Kindern mitzuerleben. Es gab drei Totgeburten, und drei weitere Babys starben schon nach wenigen Tagen. Oh, und ein paar Armbänder sind mir aus verschiedenen Gründen durch die Lappen gegangen. Natürlich sollten wir sie nicht aufheben, und wenn meine Sammlung entdeckt worden wäre, hätte das ziemlichen Ärger für mich bedeutet.«
Als sie die toten Babys erwähnte, bemerkte Katie, dass Beth die Lippen aufeinanderpresste. Auch wenn die Sterberate höher gewesen war, als sie hätte sein sollen, so versuchte Katie sich doch mit dem Wissen zu trösten, dass es in anderen Heimen noch schlimmer zugegangen war. Und dennoch: In Carrigbrack war sie den Ansprüchen ihrer Ausbildung nicht gerecht geworden. Die jungen Frauen hatten unnötig gelitten, und sie hatte ihren Teil dazu beigetragen.
»Und du hast die Armbänder die ganze Zeit über aufbewahrt?«, fragte Beth.
»Na ja, ich habe sie mir zwar nicht tagtäglich angesehen, aber wegwerfen konnte ich sie auch nicht.«
Schon zu Schulzeiten war Katie geradezu peinlich organisiert gewesen. Ihre Hausaufgaben hatte sie immer pünktlich fertig gehabt, sodass ihre Mitschüler von ihr abschreiben konnten. Auch wenn es anderen merkwürdig erscheinen mochte, sie hätte diesen Karton voller Namen niemals entsorgen können.
Beth gab ihr das Armband zurück und nahm ein anderes aus der Box. »Mädchen. Jaqueline. 10. November 1971. 2834 Gramm. Mutter: Hanora Culligan«, las sie laut.
»Ich erinnere mich an sie. Du lieber Himmel, sie war erst vierzehn, und auch das nur knapp! Ihr richtiger Name war Christine. Chrissie. Sie war von einem Nachbarn vergewaltigt worden.«
»O Gott.« Beth wischte sich eine Träne weg. »Die Arme. Ich hoffe, sie hat danach trotzdem noch ein gutes Leben gehabt. Auch wenn sie einfach nur fertig gewesen sein muss, als sie Carrigbrack verlassen hat.«
»Man weiß es nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, was Menschen überleben können. Vielleicht hat sie nach Carrigbrack auch nie wieder zurückgeschaut.«
»Glaubst du das im Ernst?«
»Ich bin mir nicht sicher. Aber zumindest würde ich es gern glauben.«
»Es wäre toll, das herauszufinden.«
»Das wäre es«, sagte Katie leise. Je länger sie darüber sprachen, desto mehr war sie von ihrem Plan überzeugt. Ja, es würde bestimmt nicht immer einfach sein. Manche der Geschichten wären sicherlich ziemlich aufwühlend. Vielleicht würde sie auch Menschen kontaktieren müssen, an die sie sich lieber nicht mehr erinnert hätte. Bisher hatte sie nur eine ungenaue Vorstellung davon, wie sie vorgehen würde, aber eins wusste sie ganz sicher: Wenn sie jemandem dabei helfen konnte, eine Tür zu öffnen, dann würde sie es tun. Sie lächelte Beth an. »Wie du schon gesagt hast, die Männer und Frauen, die in Carrigbrack geboren wurden, könnten dankbar für die paar Informationen darüber sein, wie ihr Leben begonnen hat.«
»Außer …« Beth zögerte.
»Sag schon.«
»Versteh mich bitte nicht falsch. Ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Aber ich frage mich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Schau uns doch an. Schon wegen der paar Papierstreifen sind uns die Tränen gekommen. Ich kann mir gut vorstellen, wie Mam reagiert, wenn sie davon erfährt. ›Seid ihr verrückt?‹, wird sie sagen. ›Was müsst ihr euch solche Probleme aufhalsen, und das, wo Johnny gerade erst unter der Erde ist.‹«
»Dann sollten wir ihr nichts davon erzählen.«
»Damit hätte ich kein Problem, aber …«
»Es muss keine Probleme geben. Und was das Timing angeht … auch wenn ich diese Phrasen über den Tod immer gehasst habe, scheinen sie doch ein Fünkchen Wahrheit zu enthalten. Wenn jemand, der dir nahesteht, stirbt, fragst du dich ganz automatisch, wie viel Zeit dir selbst noch bleibt. Wenn ich es jetzt nicht tue, dann besteht die Gefahr, dass ich es später bereue. Einige der Beteiligten werden vielleicht nicht mehr viele Jahre leben. Und außerdem ist es ja nicht so, dass ich mich den Frauen aufdrängen will. Ich möchte einfach nur eine Anzeige in die Zeitung setzen und, wenn sich jemand daraufhin meldet, mit ihm oder ihr reden.«
»Mein neuer Job fängt erst in ein paar Wochen an«, sagte Beth. »So lange kann ich dir dabei helfen, wenn du willst.«
»Danke, Liebes. Das wäre schön.«
»Und wenn dich wirklich Leute kontaktieren, was dann?«
»Bekommen sie von mir alle Informationen, die ich zu ihrem Fall besitze, und das war’s dann. Glaub mir«, sagte Katie, »ich habe nicht vor, mich in das Leben anderer einzumischen.«