

E-Death
Von C. A. Raabe
Buchbeschreibung:
Die überarbeitete Neuausgabe des ursprünglich 2017 erschienenen Krimis über die Schattenseiten von Social Media.
Freiwillig geben viele Menschen jeden Tag ihre Daten den verschiedensten Apps gegenüber preis. Was passiert, wenn sie in die Hände einer wirklich kranken Person gelangen? Denn es gibt eine solche Person. Sie macht sich die Sorglosigkeit zunutze mit der diese Menschen ihre Smartphones mit Daten füttern, um ihre ganz persönlichen Ziele zu verfolgen.
Über den Autor:
Im Jahr 2012 veröffentlichte Christian A. Raabe unter dem Pseudonym „C. A. Raaven“ seinen ersten Roman, ein Urban Fantasy Jugendbuch, über den KDP-Service von Amazon.
2017 wurde er in die Autorenvereinigung „Das Autorensofa“ aufgenommen, mit der er seitdem regelmäßig einen Stand auf der Frankfurter Buchmesse betreibt.
Im Jahr 2018 etablierte er das Pseudonym „Christine Corbeau“, unter dem er 2019 seine erste romantische Komödie veröffentlichte.
Auch seiner dunkleren Seite blieb er in dieser Zeit treu und stellte eine Anthologie düsterer Kurzgeschichten zusammen. Weiterhin veröffentlicht er zusammen mit AutorInnen des Phantastik Autoren Netzwerks wöchentlich kostenlose Kurzgeschichten.
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Nachwort
Aus der gleichen Feder, aber unter anderem Namen
Werke geschätzter Kollegen
Impressum

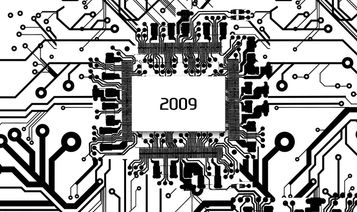
Mein Leben endet, als ich gerade 12 Jahre alt geworden bin.
Ich bin im Garten hinter dem Haus und sortiere das Totholz, das ich heute Morgen aus dem angrenzenden Wald geholt habe, weil ich es zum Trocknen auslegen will. Die Luft ist kalt heute – man kann den sich heranschleichenden Winter schon erahnen. Bald werden wir alles Holz brauchen, das ich heranschaffen kann. Ich hoffe, dass Vater mit meiner Ausbeute zufrieden ist – wenigstens heute einmal.
Als hätte er meine Gedanken spüren können, schallt plötzlich seine Stimme durch das halb offene Fenster zu mir heraus.
»He, Nichtsnutz. Komm rein. Deine Mutter will dich sehen.«
Mutter! Bei diesem Wort stellen sich meine Nackenhaare spontan auf. Die Haut an meinen nackten Unterarmen beginnt, unangenehm zu kribbeln, so als ob eine Schar Insekten dort hin und her kriechen würde.
Nein, lass mich. Ich möchte lieber noch ein paar Klafter Holz sammeln, will ich zurückrufen. Aber ich drehe mich langsam um und trotte zum Haus. Ungehorsam mag Vater nicht. Ich weiß, was dann passiert.
»Mach schon. Wer weiß, wie lange sie noch hat.«
Seine Stimme empfängt mich, als ich zögernd durch die Eingangstür trete. Wie eine Stahlklammer umfasst sein Griff meine Schulter. Damit bugsiert er mich – schneller, als mir lieb ist – den Gang hinunter auf eine Tür zu. Eine Tür mit abblätterndem roten Anstrich. Die Tür, hinter der sie auf mich wartet.
Ich lege eine Hand auf die Klinke und drücke sie langsam hinunter. Kurz schaue ich über meine Schulter, in der Hoffnung, ein aufmunterndes Nicken zu sehen. Aber ich sehe nur den durchbohrenden Blick zweier stahlblauer Augen in seinem hageren Gesicht.
Also trete ich ein.
Wärme schlägt mir aus dem halbdunklen Zimmer entgegen. Wärme und der Geruch. In diesem Moment wird mir bewusst, dass ich vor Anspannung die Luft angehalten hatte, als ich vor der Tür stand. Also muss ich nun Luft holen, ob ich will oder nicht. Ich versuche, es schnell hinter mich zu bringen und nehme einen kurzen tiefen Atemzug. Sofort wird mir von dem Gestank speiübel.
Warum kann ich denn nicht einmal etwas richtig machen? Ich hätte mir die Nase zuhalten sollen.
Aber jetzt ist es zu spät. Mühsam gegen den Würgereiz ankämpfend taste ich mich an der Wand entlang und versuche dabei, flach zu atmen.
Das wird schon wieder, sage ich mir. Der Mensch gewöhnt sich an alles.
»Bist du das, Liebling?«, reißt sie mich aus meinen Gedanken.
»Ja, Mutter. Ich bin’s. Wie geht es dir?«
»Blendend, mein Herzblatt«, antwortet sie mit einer röchelnden Stimme, die das Gesagte Lügen straft. »Komm doch her und setze dich ein bisschen zu mir.« Darauf folgt ein Hustenanfall, der nicht enden zu wollen scheint. Ihr Gesicht läuft dunkelrot an.
Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass es auch ihr letzter sein kann. Bin ich ängstlich? Erleichtert? Ich kann es nicht sagen.
Doch dann ist er vorüber. Ihr nun wieder blasses, teigiges Gesicht verzieht sich zu einem Lächeln. Ich zumindest weiß, dass es ein Lächeln sein soll, denn in den letzten vier Jahren hatte ich genug Gelegenheit, mir jede ihrer Regungen einzuprägen. Ich brachte ihr Essen und habe ihr vorgelesen. Als sie noch in der Lage war, sich zu bewegen, habe ich ihr bei der Körperpflege geholfen. Aber das ist lange her. Nun liegt sie nur noch auf ihrem Lager. Mehr lässt ihr schieres Gewicht nicht zu. Und ich kann nichts dagegen tun.
Mit einer kaum merklichen Bewegung ihrer Finger winkt sie mich zu sich heran.
Ich trete näher. Inzwischen habe ich mich tatsächlich an den Geruch gewöhnt – einer Summe aus Schmutz, Schweiß und den Ausdünstungen ihrer schwärenden Wunden. Neben dem Lager, das nur aus auf dem Boden liegenden Matratzen und einigen Decken besteht, lasse ich mich nieder.
Die fleischigen Arme meiner Mutter heben sich ein wenig, so dass ich mich an sie anlehnen kann. Dann fallen sie wieder herunter und begraben mich fast unter sich.
Eine ganze Stunde sitzen wir so da, während sie mir Dinge erzählt, die ich schon kenne, und andere Dinge, die ich niemals wissen wollte. Zwischendurch gibt sie mir immer wieder zu verstehen, dass ich ihr etwas Essbares in den Mund stecken soll. Selbst dazu ist sie nicht mehr allein in der Lage. Schließlich dämmert sie weg. Ich bemerke es nur daran, dass die beständige Aufforderung zur Hilfe bei der Nahrungsaufnahme unterbleibt.
Mühevoll winde ich mich aus ihrer Umarmung. So schnell es mir möglich ist, verlasse ich diesen Albtraum eines Zimmers. Als ich die Tür hinter mir geschlossen habe, muss ich mich kurz dagegen lehnen, so sehr hat die vergangene Stunde an mir gezehrt.
»Ich kann das nicht mehr«, denke ich. Oder habe ich es laut gesagt?
In diesem Moment wird mir klar, dass er direkt vor mir steht. Mein Vater. Er sieht mich mit forschendem Blick an. Ein weiteres Mal überlege ich fieberhaft, ob ich gesprochen oder gedacht habe.
»Möchtest du dich einen Moment ausruhen?«, fragt er mich mit einer weichen Stimme, die ich noch nie von ihm gehört habe.
Überrascht blicke ich ihn an. Auch in seinen Augen sehe ich nicht die übliche Härte und Strenge.
»Nein, danke Vater«, erwidere ich perplex. »Ich glaube, ich brauche noch etwas frische Luft.«
»Dann tu das. Geh nach draußen. Vielleicht kannst du noch nach etwas mehr Holz im Wald suchen.«
Mit offenstehendem Mund schaue ich ihn an und nicke abwesend. Dann setze ich mich in Bewegung und gehe nach draußen. Dort überlege ich kurz, ob ich zuerst noch die bereits gesammelten Äste zu Ende sortieren soll, aber ich will hier weg.
Also mache ich mich auf den Weg zum Wald. Die ganze Zeit über kreisen meine Gedanken um das seltsame Verhalten meines Vaters.
Ist etwas geschehen, das diese Veränderung bei ihm bewirkt hat?
Oder habe ich es mir in meiner Erschöpfung nur eingebildet?
Kurz bevor ich den Wald erreiche, höre ich einen Knall. Ich zucke nicht einmal zusammen. Es gibt viele offizielle Jäger hier im Wald – von den Wilderern ganz abgesehen. Eigenartig kommt es mir nur vor, dass das Geräusch nicht aus dem Wald, sondern von hinter mir zu kommen schien.
Das Suchen nach Holz dauert lange – immerhin habe ich den nahe zu unserem Haus liegenden Teil des Waldes bereits abgesucht. Aber ich habe das Gefühl, dass mich die Tätigkeit befreit – zumindest meinen Geist, den ich herumwandern lasse, genauso, wie es meine Füße auf dem Waldboden tun. Doch irgendwann gehe ich nicht mehr weiter, da ich weiß, dass ich das gesammelte Paket ja auch wieder nach Hause schaffen muss.
Als ich aus dem Unterholz hervortrete, sehe ich ein Auto vor dem Haus stehen. Eigenartigerweise ist es über und über beladen. Selbst der Anhänger sieht bis zum Platzen gefüllt aus. Ich trete näher, um mir das Ganze genauer zu betrachten. Da sehe ich Vater aus der hinteren Tür treten.
Eben will ich mich dazu aufraffen, ihn zu fragen, was es mit dem Auto auf sich hat. Er mag es nicht, wenn ich ungefragt rede – von Fragen ganz zu schweigen.
Da höre ich einen gedämpften Knall aus dem Haus, das von einem seltsam vertrauten Brausen gefolgt wird. In dem Moment, als mein Gehirn dem Geräusch eine Bedeutung zuordnet, schlagen die ersten Flammen aus der offenen Tür. Fassungslos starre ich auf das Inferno, das nun auch hinter den Fenstern lodert.
Mit einem Aufschrei renne ich auf die Tür zu.
Meine Sachen, Rex unser Hund, Mutter!
Vater streckt einen seiner sehnigen Arme aus, als ich gerade an ihm vorbeistürmen will, und ich bleibe daran hängen. Der Aufprall presst die wenige Luft, die sich noch in meinen Lungen befindet, heraus.
»Es ist alles in Ordnung. Alles, was du brauchst, ist schon im Wagen.«
Bis seine Worte weit genug in meinen Verstand dringen, um auch nur ansatzweise einen Sinn zu ergeben, sehe ich ihn verständnislos an.
»Mama ... Rex«, keuche ich atemlos.
»Rex sitzt im Wagen und deine Mutter hat es überstanden.«
Wieder dauert es eine Ewigkeit, bis ich meine, zu verstehen. Mit aufgerissenen Augen starre ich in sein Gesicht. Dort erkenne ich aber nichts von dem verständnisvollen Zug, den es vorhin noch hatte.
Ohne eine Spur von Bedauern in der Stimme sagt er: »Ich habe deine Mutter von ihrem Leid erlöst. An der Situation, in die sie sich selbst gebracht hat, wäre nichts mehr zu ändern gewesen. Auch du hast vorhin gesagt, dass es so nicht mehr weitergeht.«
»Ich habe ... ich hab doch nicht ...«, beginne ich, aber er fährt mir über den Mund.
»Was fällt dir ein, zu sprechen, ohne dass du dazu aufgefordert wurdest?!«
Doch dieses Mal kennt meine Seele kein Halten. Mit sich überschlagender Stimme schreie ich Worte, die ich niemals im Leben wieder zurücknehmen kann. Ich trete um mich, schlage, versuche zu kratzen. Aber nichts davon scheint Vater zu erreichen. Ein eiskaltes Lächeln umspielt seinen Mund, während er mich an seinem ausgestreckten Arm zappeln lässt.
Ein weiterer Knall, diesmal wesentlich lauter, lässt uns beide zusammenfahren. Das Fenster zur Linken explodiert in einem Feuerball.
Mutters Zimmer!
Vater hat mich aus seinem Griff verloren, und ich plumpse zu Boden. Sofort springe ich auf. Ich versuche, doch noch ins Haus zu gelangen. Obwohl der Feuerball mir alles darüber hätte sagen sollen, was sich im Innern des Zimmers abspielt, habe ich die irrwitzige Hoffnung, dass ich nur schnell genug sein muss, um sie noch retten zu können.
Ich bin fast an der Tür, als mich eine Hand am Sweatshirt packt und brutal zurückreißt. Auf dem Boden liegend blicke ich nach oben in Vaters Augen, die wieder ihren stählernen Glanz angenommen haben.
»Jetzt hör mal zu, Nichtsnutz«, herrscht er mich an. »Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich dich nicht einfach da hinein werfe und dich deinem Schicksal überlasse. Du hast noch eine Chance. Steig jetzt in den Wagen und halt verdammt noch mal den Mund.«
Benommen rappele ich mich auf. Ich stolpere auf das Auto zu. Jetzt wird mir auch die infernalische Hitze bewusst. Wenn ich sie sogar hier draußen so schmerzhaft spüren kann, dann muss es im Haus noch viel schlimmer sein. In diesem Moment wird mir klar, dass dort drinnen nichts und niemand mehr ist, dem ich noch helfen könnte.
Vater ist schon an mir vorbeigegangen und steht an der geöffneten Autotür.
»Jetzt mach schon. Wenn das Feuer den Gastank erreicht, dann bleibt hier kein Stein auf dem anderen.«
Als ob diese Worte ein Startschuss wären, renne ich los und springe in den Wagen hinein.
»Na bitte. Geht doch. Vielleicht ist mit dir ja doch noch etwas anzufangen«, bemerkt Vater mit einem grimmigen Lächeln auf den Lippen.
Er startet den Motor und gibt Gas. Trotz des Gewichts all der Dinge, die in ihm und auf dem Anhänger gestapelt sind, macht das Auto einen Satz. Es fliegt fast auf den Waldrand zu, ganz in der Nähe von dem Punkt wo ich vor ein paar Minuten den Schutz der Bäume verlassen habe.
Oder war es in einem anderen Leben?
Wir halten auf einen Forstweg zu, der vom Regen der letzten Tage völlig aufgeweicht ist. Die breiten Reifen des Geländewagens pflügen durch den fast flüssigen Schlamm. Zu allen Seiten spritzt er davon, scheint sich hinter uns aber wieder zu schließen, so als ob er unsere Flucht verbergen wollte.
Ich kauere auf der Rückbank und schaue verzweifelt durch das Heckfenster auf das Haus, in dem ich mein ganzes Leben verbracht habe. Kurz bevor mir die Bäume zu beiden Seiten des Weges die Sicht darauf verdecken, wird es von einer gewaltigen Explosion in tausend Stücke zerfetzt.
Zusammen mit ihm höre auch ich auf zu existieren.
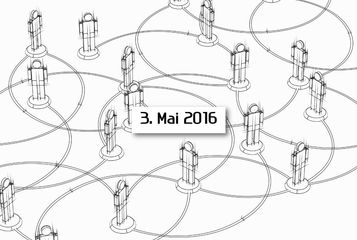
»Nein«, keuchte Marc. »Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein ...! Verdammte Sch...! Ich glaub, ich hab das Internet gelöscht.«
Aus dem Augenwinkel konnte er erkennen, wie seine Tochter ihren Kopf mit der wilden braunen Lockenpracht aus dem Flur in die Küche streckte, wo er tief über den Tisch gebeugt saß, an dem sie morgens frühstückten. Ein Blick auf ihn schien ihr zu genügen, um die Dringlichkeit der anstehenden Aufgabe klar zu machen.
»Ach, Papi«, sagte Lina, während sie zu ihm humpelte. Sie war anscheinend gerade dabei gewesen, sich ihre Stiefel anzuziehen, denn einer davon baumelte noch von ihrer linken Hand herab.
Er stand auf und schüttelte das Gerät frustriert. »Wie zur Hölle soll mich so ein Ding zu einem besseren Polizisten machen?«
»Lass mal schauen«, bemerkte sie in einem geschäftsmäßigen Tonfall, nachdem sie ihm das Objekt des Anstoßes aus der Hand geschnappt hatte.
Sie tippte und wischte einen Moment lang auf dem Display des brandneuen Modells herum, das erst vor ein paar Tagen seinen Vorgänger ersetzt hatte. Schnell hatte sie gefunden, was sie suchte.
»Schau mal. Du hast wohl nur ein bisschen zu lange auf das Icon gedrückt. Dann lässt es sich verschieben. Da ist es in dem Ordner für die Apps gelandet, die du nicht brauchst.«
»Aber das Internet brauche ich doch«, begehrte Marc auf.
»Ja, is schon klar. Das ist ja auch nur aus Versehen passiert. So, ich ziehe es dir wieder heraus auf deinen Homescreen.«
»Würde es dir etwas ausmachen, Deutsch mit mir zu reden? Du weißt doch, dass dieser ganze Technik-Kram nicht mein Ding ist.«
Lina lächelte ihrem Vater zu. »Ist gut, Paps«, sagte sie. Nach einer kurzen Pause ergänzte sie in einem beiläufigen Tonfall: »Wenn du doch eh nicht damit klarkommst, vielleicht solltest du dir besser doch wieder so ein Anrufhandy zulegen.«
Aber ihre Taktik fruchtete bei dem erfahrenen Ermittler nicht.
»Und das hier gebe ich dann wem?«, fragte er mit einem Gesichtsausdruck, der erkennen ließ, dass er wusste, was jetzt kam.
»Jemandem, der etwas damit anfangen kann.«
»Also dir.«
Lina setzte ihr entwaffnendstes Lächeln auf.
»Sorry, Schatz«, sagte Marc und brachte es fertig, tatsächlich etwas wie Bedauern in seiner Stimme anklingen zu lassen. »Du weißt, dass ich lieber früher als später nichts mehr mit diesen Dingern zu tun hätte, aber das ist ein Diensthandy. Das kann ich dir nicht einfach geben. Im Prinzip gehört es ja nicht mir, sondern der Stadt Berlin, die es mir nur freundlicher- oder in meinem Fall wohl eher gemeinerweise zur Verfügung stellt.«
Lina fuhr fort, sich ihren zweiten Stiefel anzuziehen.
»Was denn, keine Widerwehr?« Marc zog eine Augenbraue hoch.
»Ach weißt du, ich glaub, ich werde langsam erwachsen.«
»Und damit alt genug, ein Smartphone zu bekommen.«
»Das hast du gesagt«, meinte Lina augenzwinkernd.
»In der Tat, das habe ich. Dein Wunsch ist hiermit vermerkt. Ob es dann aber ...«
Marc brach ab, denn in diesem Moment begann das Gerät in seiner Hand in voller Lautstärke den Song »Bad Boys« von »Inner Circle« zu spielen. Fast hätte er es daraufhin fallen lassen.
»Wow, wo hast du das denn her?«, fragte Lina erstaunt.
»Hat mir Mike geschickt. Du weißt doch, das ist schon immer unser Song gewesen. Mike Lowrey und Marcus Burnett sind einfach zwei der coolsten Bullen, die es gibt – wenn auch nur im Film.«
Lina lachte. »Aber wie hast du es geschafft, den Klingelton einzurichten? Bei dem alten ...«
Das brüllende Klingeln verstummte.
»Das war ja auch ein ganz anderes Modell«, entgegnete Marc stolz. »Das hier hat eine viel bessere Benutzerführung. Da ging das fast von allein.«
Linas Mund klappte auf und blieb offen stehen, ohne dass sie es merkte.
»Ha, erwischt!«, rief Marc triumphierend. »Du hast es mir abgekauft. Nee, in Wirklichkeit hat Mike das erledigt. Das geht hier ja wohl direkt über nen Computer, und er hat es gestern gleich auf der Dienststelle gemacht.«
In diesem Moment piepte es mehrmals. Danach fing »Bad Boys« wieder an, durch die Küche zu schallen.
Marc schaute auf das Display, wo der Text der Nachricht, die er eben bekommen hatte, angezeigt wurde. Schlagartig verdüsterte sich seine Miene, als er las: »Geh ran. Wir müssen los. Es gibt einen Toten.«
»Muss rangehen. Ist leider kein Spaß«, murmelte Marc in Richtung seiner Tochter. Er gab ihr einen Abschiedskuss auf die Wange, dann nahm er das Gespräch an.
»Na, hast du endlich herausgefunden, wozu das grüne Symbol auf dem Bildschirm da ist?«, begrüßte ihn Mikes Stimme. Auch wenn die Kurzmitteilung, die er geschickt hatte, erkennen ließ, dass eine dringende Angelegenheit anstand, verlor er doch nie ganz seine scherzhafte Ader.
»Nee, diesmal nicht. Hatte nur gerade ein Gespräch mit Lina über Smartphones.«
»Ah, der 16. Geburtstag lässt grüßen«, bemerkte Mike. »Vielleicht solltest du wirklich mal überlegen, ob du ihr eins schenkst. Sie ist ja für einen Teenager schon ziemlich verantwortungsbewusst.«
Marc schaute auf und konnte erkennen, dass Lina in diesem Moment das Haus verließ. Er seufzte. »Weißt du, ich glaube, das mache ich wirklich.«
***
Lina schloss die Haustür hinter sich und ging auf ihre Freundin zu, die eben im Begriff war, am Gartentor zu klingeln.
»Oh, du bist schon fertig«, sprach Claudia das Offensichtliche aus.
»Du klingst so enttäuscht. Ist was?«
»Ach, ich ... aber ist ja auch egal«, murmelte Claudia und ein Hauch von Rosa überzog dabei ihre Wangen.
Lina schüttelte schmunzelnd den Kopf. »Kann es sein, dass du meinem Paps noch kurz ‘Hallo’ sagen wolltest?«
»Ich ... wie ... kommst du denn da drauf?«
Lina legte den Kopf schräg und schaute ihre Freundin nur stumm an.
»Okay, okay, ich geb’s ja zu. Er ...«
»Nicht du auch noch«, bemerkte Lina kopfschüttelnd, aber mit einem Schmunzeln.
»Wieso auch?«
»Letztens waren Karen und Sanne bei mir zum Lernen. Aber als Paps nach Hause gekommen ist, konntest du das voll vergessen. Die haben die ganze Zeit nur noch im Wohnzimmer rumgehangen und ihn dabei angeschmachtet, wie er im Garten nen Baum gepflanzt hat.«
»Nicht dein Ernst.«
»Doch, echt.«
»Aber du musst schon zugeben, dass er ein ziemlich hei...«, begann Claudia.
»Mann, er ist Anfang vierzig ... und mein Vater!«, fuhr Lina auf.
»Na gut, dann einigen wir uns darauf, dass er ein ziemlich cooler Typ ist. So von außen betrachtet.«
»Das lass ich mal gelten. Aber an seinem Technikverständnis müssen wir noch arbeiten.«
***
Vierzig Minuten später stieg Marc aus seinem Dienstwagen und ging einen breiten Sandweg entlang, der in einen Park führte. Rings um ihn her spross das frische Grün aus den Zweigen der Bäume. Narzissen, Tulpen und auch die ersten Pfingstrosen zauberten bunte Tupfen in die Umgebung. Die Luft war angenehm frisch. Der Sonne, die an einem fast wolkenlosen Himmel stand, gelang es, durch ihre Strahlen seinen Rücken mit angenehmer Wärme zu überziehen. Alles in allem war dies eine Szenerie, die förmlich danach rief, sie in sich aufzusaugen und zu genießen.
Ihm stand im Moment jedoch ganz und gar nicht der Sinn nach Genuss. Er bemerkte die Schönheit um ihn herum nicht einmal, da er auf dem Weg zu einem Tatort war. Schon von weitem konnte er die Absperrbänder sehen, die die Kollegen von der Spurensicherung bereits gespannt hatten. Er wappnete sich innerlich für den Anblick, der sich ihm gleich bieten würde. Selbst nach all den Jahren im Polizeidienst und einigen davon im Dezernat für Gewaltverbrechen konnte er sich einfach nicht daran gewöhnen, unter welch fürchterlichen Umständen das Leben mancher Menschen ein Ende fand.
Als Marc unter der Absperrung hindurchgegangen war, erhaschte er einen ersten Blick auf das, was vor ihm auf dem Boden lag. Spontan wusste er, dass alles Wappnen bei dem Anblick, der sich ihm bot, nichts nützen würde. Im ersten Augenblick schoss ihm »Lina!« durch den Kopf. Dann jedoch ließ der Schreck nach. Er begann, die Unterschiede zu seiner Tochter wahrzunehmen. Abgesehen von der langen braunen Mähne, die der von Lina zum Verwechseln glich, war die junge Frau dort auf dem Boden um einiges größer. Sie war auch sehr viel dünner. Außerdem trug seine Tochter nie solche Klamotten oder wenn sie es täte, dann dürfte sie sich auf ein längeres Gespräch mit ihm gefasst machen.
Die Tote hatte unter einem Mantel aus schwarzem Lackleder das an, was in den feuchten Träumen mancher Männer vermutlich als Schulmädchen-Kostüm bezeichnet werden würde: ein extrem kurzer dunkelblauer Falten-Minirock, Lackschuhe mit weißen Kniestrümpfen und eine Matrosenbluse, die ebenfalls einmal weiß gewesen war. Nun hatte sie zum großen Teil die hässlich rot-bräunliche Färbung von angetrocknetem Blut. Blut, das sich außerdem in einer großen Lache um sie herum ausgebreitet hatte. Woher es gekommen war, ließ sich unschwer erkennen. Direkt unterhalb ihrer linken Wange befand sich im Hals ein klaffender, ausgefranster Riss.
»Ja, Mann, das ist heftig«, erklang Mikes Stimme hinter Marc.
»Das kannst du aber richtig laut sagen«, bemerkte Marc müde. »Wie ich sowas hasse. Das arme Ding. Hast du schon irgendwas rausbekommen?«
»Na ja, aus den Zeugen, die sie gefunden haben, ist nicht viel herauszubringen gewesen. Kein Wunder bei dem Schreck, den sie bekommen haben. Ich mein: Stell dir mal vor, du willst einfach nur mit deiner Freundin nen kurzen Lauf durch den Park machen, bevor du zur Arbeit fährst. Dann biegst du um ne Ecke und siehst das hier.«
»Jo, kann ich nachvollziehen.«
»Aber die Papiere haben uns das eine oder andere erzählt. Cindy Sommer heißt sie, 25 Jahre, wohnt in Pankow. Außer dem Ausweis hatte sie noch ein paar Kassenzettel aus ihrer Wohngegend, ne BVG-Karte, ein paar Visitenkarten und 375,26 Euro in ihrem Portemonnaie.«
Marc pfiff durch die Zähne. »Okay, dann können wir Raub als Motiv wohl ausschließen.«
»Sieht so aus«, bestätigte Mike. »Wollen wir dann erst mal zurück in die Dienststelle?«
»Glaub schon. Die Jungs von der SpuSi haben das ja alles im Griff. Wenn’s keine offensichtlichen weiteren Zeugen gibt, dann können wir uns dort weitere Gedanken machen.«
***
Wenig später saßen sie einander an ihren Schreibtischen gegenüber und starrten auf die Bildschirme ihrer Computer.
»Hast du schon was?«, ließ sich Mike bald von der anderen Seite des Schreibtischs vernehmen.
Marc ließ die Quittungen, die er in der Hand hielt, sinken. »Nicht wirklich. Kassenbelege eben. Ein Bio-Laden, ein Blumengeschäft und ... Moment mal ... das hier ist nicht aus dem Wohnumfeld.« Er gab die Adresse in die Suchmaschine ein. »Oh ... na ja, war eigentlich klar. Solche Läden gibt’s wahrscheinlich nicht überall.«
»Wie jetzt?«
»Der Beleg hier ist von nem Laden in der Uhlandstraße. Da wird sie wohl ihr Outfit herhaben.«
»Ah, ich verstehe. Lohnt es sich, dass ich mir die Internetseite auch anschaue?«
Marc rollte mit den Augen und sah seinen Partner über die Bildschirme hinweg an.
»Tu, was du nicht lassen kannst. Aber vielleicht machst du diese Recherche dann von zu Hause aus.«
»Wofür hältst du mich?«, kam es von Mike zurück. »Aber jetzt mal im Ernst. Die Klamotten müssen nicht unbedingt ihrem persönlichen Geschmack entsprochen haben. Vielleicht war es auch nur Arbeitsbekleidung. Sie hat im letzten Jahr in zwei verschiedenen Clubs auf oder an der Oranienburger gearbeitet.«
»Hmm, meinst du, dass wir uns dann auf diese Szene konzentrieren sollten?«
»Kann sein. Ich seh aber gerade, dass sie nicht allein gewohnt hat. Die Wohnung ist auf zwei Namen angemeldet.«
»Okay, dann lass uns doch erst mal da nachfragen.«
»Wer zuletzt am Auto ist, muss fahren«, rief Mike, sprang auf und war aus dem Büro, noch bevor Marc sich seine Jacke genommen hatte.
Wie im Kindergarten, dachte er kopfschüttelnd. Dann breitete sich ein Lächeln auf seinen Zügen aus und er rannte los – nicht hinter seinem Partner her, sondern in die andere Richtung. Im Treppenhaus nahm er mehrere Stufen auf einmal, stieß sich an den Wänden ab und nutzte den Schwung, um sich über das Geländer auf die weiter unten liegenden Treppen zu schwingen. Als Mike durch die offene Tür auf den Parkplatz rannte, lehnte Marc sich bereits an den Dienstwagen – zwar schwer atmend, aber mit einem breiten Grinsen.
»Boh, wie hast du das denn nun schon wieder geschafft?«
»Ich betreibe hin und wieder Sport und dieser ganz spezielle nennt sich Parcours. Solltest du vielleicht auch mal wieder machen.« Augenzwinkernd klopfte Marc seinem Partner mit der flachen Hand auf den leichten Bauchansatz, der unter seinem Hemd erkennbar war. Dann warf er ihm die Autoschlüssel zu und stieg auf der Beifahrerseite ein.
***
Als ihnen die Tür, auf deren Klingelschild »Langer/Sommer« stand, geöffnet wurde, hob Marc seinen Dienstausweis, um ihn der im Türspalt stehenden Frau zu zeigen. Er war im Begriff, sich vorzustellen, als ihr bereits Tränen in Strömen aus den Augenwinkeln liefen.
»Cindy ist was passiert«, sagte sie tonlos.
»In der Tat, Frau ... Langer?«, setzte er erneut an.
Doch die Frau schien ihn nicht gehört zu haben. »Sie ist ... ist sie?«, krächzte sie. Dann versagte ihr die Stimme.
Marc nickte. »Wollen wir das nicht besser in Ihrer Wohnung besprechen?«
Wortlos drehte die Frau sich um und verschwand hinter der halb offen stehenden Tür. Kurz danach konnten sie ein »Kommen Sie!« hören.
Die beiden folgten ihr bis in eine offene Küche mit einem in den Wohnbereich hineinragenden Tresen, an dem zwei Barhocker standen.
»Entschuldigung«, murmelte die Frau und wies mit fahrigen Bewegungen auf die Hocker. »Das ... ich weiß gar nicht, wie man ...« Sie trocknete ihr tränenfeuchtes Gesicht mit dem Ärmel ihres Pullovers. »Setzen Sie sich doch.«
»Vielen Dank, Frau Langer«, sagte Marc. »Entschuldigen Sie die Frage, aber wir sprechen doch mit Frau Langer, oder?«
»Ja ... ähm, sorry. Sylke Langer. Ich bin ... das ist ...« Sie schlug sich die Hände vors Gesicht und begann zu schluchzen.
»Es tut uns leid, dass wir Ihnen diese Nachricht überbringen müssen. Und umso mehr bedauern wir es, dass wir leider nicht darauf verzichten können, Ihnen einige Fragen zu stellen. Wir wollen die Umstände von Frau Sommers ... Tod so schnell wie möglich aufklären.«
Sylke Langer hob ihren Blick und sah Marc in die Augen. »Es war kein Unfall, stimmt’s?«
»Was macht Sie da so sicher?«
»Der Job ... na ja, ich hab immer wieder gesagt, dass sie aufhören soll. Aber sie hat mir dann vorgerechnet, wie viele Nebenjobs sie machen müsste, um das gleiche zu verdienen. Dabei ist sie eigentlich gar nicht so ... gewesen.«
»Möchten Sie mir erzählen, wie sie wirklich war? Ach und würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn sich mein Kollege in der Zwischenzeit Frau Sommers Zimmer anschaut?«
Sylke Langer bedeckte mit einer Hand ihr zitterndes Kinn. Sie schloss kurz die Augen, dann nickte sie. »Es ist das Zimmer den Gang runter, ganz hinten rechts.«
Mike bedankte sich und ging in die Richtung, die ihm gewiesen worden war.
»Ich brauch jetzt unbedingt was zum Trinken«, bemerkte die Frau und stieß sich von der Arbeitsfläche, an die sie sich gelehnt hatte, ab. »Kann ich ... Ihnen auch etwas anbieten?«
»Oh, nein danke. Ich bin ...«
»Im Dienst, schon klar. Ich hatte auch nicht vor, zum Alkohol zu greifen. Es wäre auch gar keiner da.«
Sie ging zum Kühlschrank und holte eine große Glaskaraffe hervor, die außer mit einer klaren Flüssigkeit auch mit einigen rosafarbenen Steinen und grünen Blättern gefüllt war. Daraus goss sie sich ein Glas voll und leerte es in einem Zug. Bevor sie es erneut füllte, sah sie Marc fragend an.
»Das sieht interessant aus, aber trotzdem nein danke.«
»Das habe ich von ihr.«
Nun war es an Marc, Sylke Langer fragend anzuschauen.
»Sehen Sie, ich habe Cindy in der Uni kennengelernt. Wir waren beide verpeilte Erstsemester an der Humboldt – sie in Soziologie und ich in Psychologie. Wir waren uns auf Anhieb sympathisch und sind dann auch schnell auf die Idee gekommen, zusammenzuziehen. Da hat mich Cindy dann in ihre Welt eingeführt.«
Sie bemerkte ein leichtes Zucken in Marcs Mundwinkel und brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Nein, diese Welt meine ich nicht. Die ist eigentlich nur ein Nebeneffekt einer Semesterarbeit gewesen. Sie hat dafür in solchen Clubs recherchiert und dabei festgestellt, dass man da ganz gut verdienen kann, auch ohne sich mit Männern einzulassen.« Sylke Langer seufzte. »Wissen Sie, wenn ich es mir recht überlege, dann hätte man es als durchaus normal empfinden können, wenn Cindy bei ihrem Background in der Sucht-Szene gelandet wäre. Ihren Vater hat sie nie gekannt und ihre Mutter hat volltrunken einen Autounfall verursacht und ist dabei umgekommen. Da war Cindy erst sechzehn. Sie ist natürlich in ein Heim gekommen, hat da aber wohl den richtigen Betreuer erwischt. Auf jeden Fall hat sie eisern daran gearbeitet, ihr Abitur zu schaffen, um studieren zu können. Und alles, was auch nur den Anschein erweckte, nicht gesund zu sein, kam bei ihr nicht ins Haus. Das war die Regel, die sie auch für unser Zusammenleben aufgestellt hat.«
»Und wie ging es Ihnen damit?«
»Mit der Regel? Na ja, ich gebe zu, dass es mich anfangs einiges an Disziplin gekostet hat, beim Einkaufen nicht automatisch Wein, Bier oder Ähnliches in den Wagen zu legen. Aber dann habe ich gemerkt, wie viel besser es mir damit geht. Heute möchte ich gar nicht mehr ohne grüne Smoothies und energetisches Wasser sein.«
»Gab es noch weitere Regeln?«, fragte Marc, während er sich Notizen machte.
Als keine Antwort kam, schaute er vom Notizblock auf und vermutete sofort, dass Sylke Langer ihn gar nicht gehört hatte. Sie stand mitten in der Küche und hatte ihren Blick auf die Karaffe geheftet, während Tränen über ihre Wangen strömten.
»Es ist das letzte ... das letzte Wasser, das Cindy mit ihren eigenen Händen gemacht hat«, flüsterte sie, wie zu sich selbst. Dann schien sie wieder aus ihren Gedanken aufzutauchen. Sie sandte einen waidwunden Blick zu Marc.
»Ich ... kann ... nicht mehr. Kann ich ... ich meine, können wir das später ... fortsetzen?«
Marc nickte. »Natürlich, Frau Langer.« Er bemerkte, dass Mike durch die Tür von Cindys Zimmer in den Flur trat und winkte ihn zu sich. »Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich lasse Ihnen meine Karte hier – für den Fall, dass Ihnen noch etwas Wichtiges einfällt. Haben Sie vielleicht Bekannte, die Sie heute noch herbitten können? Ich denke, es wäre gut, wenn Sie jemanden zum Reden hätten.«
Sylke Langer nickte mit geschlossenen Augen.
»Ja, danke. Ich werde schon klarkommen. Ich bringe Sie noch zur Tür.«
»Möglicherweise haben wir später auch noch weitere Fragen. Dann würden wir uns noch einmal bei Ihnen melden.«
»In Ordnung. Ich arbeite eh von hier. Kommen Sie vorbei, wenn Sie noch etwas brauchen.«
***
»Da kann man mal wieder sehen«, sinnierte Mike, während sie zu ihrem Wagen gingen. »Man sollte sich nie auf den ersten Eindruck festlegen.«
»Das ist mir bei der Geschichte von Langer auch durch den Kopf gegangen. Was hast du gefunden, dass dich auf diese Idee gebracht hat?«
»Hat sie dir erzählt, dass sie eigentlich studiert?«
»Jep. Die Nachtclubs waren wohl so ein Zufallsfund bei einer Hausarbeit für die Uni oder so.«
»Und dass sie total auf alles mögliche Gesundheitszeug gestanden hat?«
»Yo, sie hat anscheinend einiges versucht, um nicht so zu werden wie ihre Eltern.«
»Aha. Ja, das passt zu dem, was ich noch gefunden habe.«
»Okay, und was wäre das?« Sie kamen am Auto an und stiegen ein.
»Sommer hat sich in ihrer Freizeit nicht etwa auf die faule Haut gelegt oder war nur am Feiern. Ich hab Unterlagen gefunden, nach denen sie in nem Tierheim mitgearbeitet hat.«
»Wow, da kann man echt ...«, begann Marc, wurde aber durch das Klingeln seines Telefons am Weitersprechen gehindert. »Pathologie«, sagte er nach einem Blick auf das Display.
»Dann mach mal laut.«
»Äh ... und wie?«
Mike schnappte sich das Gerät und betätigte einen Button auf dem Display. Dann gab er es Marc schmunzelnd zurück.
»Förster. Ja, bitte?«
»Guten Tag, Herr Förster«, meldete sich am anderen Ende der Leitung eine leise, fast ätherisch klingende Männerstimme. »Dr. Nickolaus hier. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich mit unserem Neuzugang so gut wie fertig bin. Wenn Sie noch Zeit haben, dann könnten Sie direkt vorbeikommen.«
»Okay, das lässt sich einrichten«, antwortete Marc und beendete das Gespräch.
Er sah Mike an, der mit hochgezogenen Augenbrauen zurückschaute.
»Was denn. Jetzt schon? Der lässt sich doch sonst tausendmal bitten.«
»Tja, keine Ahnung. Aber wenn er es schon mal so schnell erledigt, dann sollten wir das auch würdigen.«
»So soll es sein«, bestätigte Mike und startete in Richtung rechtsmedizinisches Institut.
***
»Guten Tag, meine Herren«, begrüßte Dr. Nickolaus die Eintreffenden. Er war ein blasser, schmaler Mann mit einem stets melancholischen Gesichtsausdruck. Zusammen mit seiner leisen Ausdrucksweise und einer eher sparsamen Mimik und Gestik wirkte dies geradezu geisterhaft. Es hatte fast den Anschein, als hätte er sich eines Tages von einer der Bahren erhoben, auf denen seine Patienten ihm für gewöhnlich angeliefert wurden. Irgendein Harry-Potter-Fan hatte ihm aufgrund dieser Erscheinung einmal den Spitznamen »Sir Nick« gegeben. Die Bezeichnung hielt sich hartnäckig, wenn sie ihrem Träger auch niemals zur Kenntnis gegeben wurde.
»Herr Dr. Nickolaus«, erwiderte Marc daher auch die förmliche Anrede. »Wir freuen uns, dass Sie angerufen haben. Ich nehme an, dass es etwas Besonderes zu berichten gibt?«
»Nun ja. Da wären zwei bemerkenswerte Punkte. Zum einen war unser Opfer in einer guten körperlichen Verfassung. Vielleicht ein wenig mager für meinen Geschmack, aber Schönheit liegt nun einmal im Auge des Betrachters, nicht wahr?«
»Und das ist etwas Besonderes?«, platzte Mike heraus, wofür er sich einen tadelnden Blick des Pathologen einfing.
»Basierend auf den mir bekannten Umfelddaten des Opfers wäre ein anderer physiologischer Zustand durchaus zu erwarten gewesen«, fuhr der Mediziner indigniert fort.
»Wenn ich da mal kurz einhaken dürfte«, meldete Marc sich zu Wort. »Wir kommen gerade von ihrer WG-Mitbewohnerin. Diese hat uns erzählt, dass ihr äußerlicher Schein trog. Sie war eine erfolgreiche Soziologiestudentin und hat sich in ihrer Freizeit gemeinnützig engagiert.«
Ein Hauch von Rosa überzog die Wangen des Doktors.
»Hm, unter dieser Prämisse ist die Tatsache, dass sie gesund und sportlich war und sich außerdem keinerlei schädliche Substanzen in ihrem Blut befanden, nicht sonderlich bemerkenswert.«
Erwischt, schoss es Marc durch den Kopf. Also ist auch Sir Nick nicht frei von Vorurteilen.
»Eines jedoch trübt den guten Eindruck, den ihr grundsätzlicher körperlicher Status vermittelt: Ihr Pharynx war stark gerötet.«
Dr. Nickolaus sah die beiden Ermittler mit einem Gesichtsausdruck an, der darauf hinwies, dass er eine Reaktion erwartete. Als diese ausblieb, ergänzte er mit einem leicht überheblichen Unterton: »Der Pharynx wird auch Rachen genannt.«
Mike nickte ungerührt. »Also hatte sie eine Halsentzündung, na und? Das ist bei dem ständigen Hoch und Runter der Temperaturen zur Zeit doch nicht ungewöhnlich.«
»Aber angesichts der offensichtlichen körperlichen Gesundheit des Opfers sehr wohl«, bemerkte Sir Nick mit erhobenem Zeigefinger. »Es ließen sich auch im Blut keine Anzeichen einer Inflammatio nachweisen.«
Mike öffnete den Mund, um eine Frage zu stellen, schloss ihn aber aufgrund des Blickes wieder, den Marc ihm zuwarf.
»Folglich bleiben meines Wissens nach nur zwei Varianten übrig, um die Rötung zu erklären: Entweder hat physische Gewalt durch die Mundhöhle auf den Rachen eingewirkt oder sie hat sich in letzter Zeit des Öfteren heftig übergeben.«
»Schwanger?«
»Auch darauf deutet nichts hin. Aber dessen ungeachtet gibt es noch einen weiteren Umstand, der als extraordinär zu bezeichnen ist.«
»Und der wäre?«, fragten Marc und Mike fast gleichzeitig. Sie verkniffen sich jedoch das Grinsen, das sich daraufhin in ihren Gesichtern ausbreiten wollte.
»Vom ersten Anschein her schien die rupturierte Carotis die Todesursache zu sein. Allerdings hat mir die Verletzung an sich schon Rätsel aufgegeben. Das aufgeschlitzte, ja geradezu zerfetzte Gewebe passt zu keiner mir bekannten Waffe. Nachdem die Leiche komplett entkleidet und gewaschen war, stellte ich jedoch zwischen der vierten und fünften Rippe eine Einstichstelle fest. Als ich nach Abschluss der äußerlichen Untersuchungen und Anfertigung eines post mortem CT den Thorax öffnete, konnte ich erkennen, dass das Herz vollständig durchstochen war. Wir können demnach davon ausgehen, dass die verursachende Klinge ungefähr fünfzehn Zentimeter lang ist.«
»Aha«, machte Marc. »Ein Einstich. Aber warum?«
»Nun ja. Wenn die Arteria carotis, also die Halsschlagader, durchtrennt wird, dann fällt der Blutdruck für das Gehirn sofort auf null ab, so dass das Bewusstsein umgehend schwindet. Auch wenn das Herz noch eine Weile weiterpumpt, so tritt doch spätestens innerhalb von zehn Minuten der Tod ein, wenn die Wunde unbehandelt bleibt.«
»Aber das erklärt trotzdem nicht den Einstich.«
»In der Tat«, bemerkte Nickolaus trocken. »Nichtsdestoweniger ist er aber da. Letztendlich war auch genau dieser Einstich ursächlich für ihren Tod, denn als das Herz seine Funktion nicht mehr ausüben konnte, trat der Tod fast augenblicklich ein.«
»Da wollte jemand anscheinend wirklich sichergehen«, war Mikes Reaktion.
»Ein Overkill, meinst du?«, fragte Marc zweifelnd.
»Das, meine Herren, obliegt nun Ihren geschätzten Ermittlungen. Meinen abschließenden Bericht erhalten Sie morgen.«
Damit war ihre Audienz bei Sir Nick beendet. Marc fuhr zusammen mit Mike zurück zur Dienststelle.
»Meinst du, wir sollten uns noch mal die Unterlagen vornehmen und schauen, ob sich noch was ergibt?«, brach Mike nach einiger Zeit das Schweigen, das sich auf der Fahrt zwischen ihnen ausgebreitet hatte.
»Hm, ich denke nicht«, sagte Marc, während er auf die Uhr schaute. »Ist schon ganz schön spät. Vielleicht sollten wir erst einmal drüber schlafen. Kann ja sein, dass das morgen alles einen Sinn ergibt.«
Mike stimmte begeistert zu. Sie fuhren bis zu seinem Wagen, wo er ausstieg und den Dienstwagen Marc überließ, um damit nach Hause zu fahren. Von der Nachhausefahrt bekam dieser allerdings kaum etwas mit, da seine Gedanken fortwährend um die Seltsamkeiten des Falls kreisten.
Hier ist irgendwie nichts so, wie es auf den ersten Blick wirkt.
***
»Und, wie war dein Tag?«
Marc hob den Blick, der bis dahin auf seinen Teller gerichtet gewesen war, und sah Lina an.
»So schlimm also?«
»Ach weißt du, Schatz, es gab da so eine ...«
Marc erschrak innerlich und brach ab. Fast hätte er ihr von der jungen Frau berichtet.
Warum eigentlich nicht?, erklang eine Stimme in seinem Kopf. Es könnte immerhin dazu beitragen, dass sie besser aufpasst.
Aber das macht sie doch, widersprach er sich in Gedanken selbst.
Das mag ja sein. Noch. Aber was ist, wenn sie erst einmal von dir ein Smartphone geschenkt bekommt?
Ich hab doch noch gar nicht ...
Red dir nichts ein, hielt die Stimme dagegen. Du weißt genau, dass du ihr diesen Wunsch letztendlich erfüllen wirst – wenn nicht zu diesem Geburtstag, dann spätestens zu Weihnachten.
Okay, okay, das stimmt. Aber ich werde trotzdem nicht mit einer Erziehung anfangen, die auf Horrorgeschichten beruht – erst recht nicht, wenn diese tatsächlich passiert sind. Sie ist ein vernunftbegabter Mensch. Das muss auch anders gehen.
Er setzte ein schiefes Grinsen auf und schüttelte leicht den Kopf.
»Sei mir nicht böse, aber darüber kann ich wirklich nicht sprechen.«
Und ich will es auch nicht.
Kurz runzelte Lina die Stirn. Es sah so aus, als ob sie zu einer Argumentation ansetzen würde, aber letztendlich schien sie ihre Rolle als Erwachsene weiterspielen zu wollen. Also zuckte sie nur mit den Schultern und fragte: »Willst du noch was von dem Gulasch?«
Marc atmete auf, denn er verspürte keinerlei Interesse daran, seiner Tochter mehr über das verfrühte Ende einer Frau zu erzählen, die in seinen Augen gar nicht so viel älter, als sie selbst gewesen war.
Im weiteren Verlauf des Abends war Lina zwar immer noch darauf aus, ihrem Vater Einzelheiten aus der Nase zu ziehen. Aber Marc erzählte ihr nur Dinge, die sie früher oder später auch in der Zeitung lesen könnte, und ging nicht auf ihre Sticheleien ein. Schließlich hörte Lina auf zu bohren und wünschte Marc eine gute Nacht. Als sie schon fast durch die Tür des Wohnzimmers verschwunden war, drehte sie sich noch einmal um und fragte: »Hat denn die Auswertung des Handys dieser ‘Person’ was gebracht?«
Marc musste unwillkürlich schmunzeln. »Du kommst mir echt schon fast vor wie Columbo.«
»Wer?«
»Ach, das ist so ne alte Serie aus den USA. Haben wir früher oft zusammen geschaut.«
»Ja, stimmt. Dieser Typ mit dem Trenchcoat, der immer so ein bisschen vertrottelt daherkam. Und wieso erinnere ich dich ausgerechnet an den?«
»Na, das war doch seine Masche. Im Gehen hatte er meist noch eine letzte Frage und hat damit seine Pappenheimer oft aus der Reserve locken können.«
Lina grinste mit schräggelegtem Kopf und hob die Schultern. »Hätte ja klappen können.«
»Die Sache ist echt nix, worüber ich mehr erzählen möchte. Aber das mit dem Handy ist seltsam.«
»Wieso?«, hakte Lina nach.
Marc seufzte, musste dann aber in sich hineinlachen. »Okay, für das Ding hast du es dir verdient.«
Lina sah ihn fragend an.
»Eine Kleinigkeit erzähle ich dir doch noch. Die Handy-Auswertung hat nichts ergeben, weil wir gar keins gefunden haben.«
»Ernsthaft? Das geht doch gar nicht. Ich meine ...«
»Schon klar. Und darauf hätten wir wirklich gleich kommen können. Na ja, ich vielleicht nicht, aber Mike werde ich das morgen unter die Nase reiben.«
Jetzt weiß ich endlich, was mich den ganzen Tag über gestört hat.
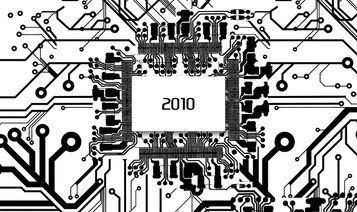
Wir wohnen nun schon über ein Jahr in der Nähe eines kleinen Ortes in Brandenburg. Vater hat hier für uns eine Wohnung in einem alten, etwas heruntergekommenen Gehöft mitten in einem großen Waldgebiet gefunden. Der Besitzer war froh, einen Mann zu haben, der auf dem Hof ordentlich anpacken kann, denn seit seine Frau gestorben war, bewirtschaftete er Land und Gebäude mehr schlecht, als recht. Daher stellte er keine Fragen darüber, woher dieser Mann mit seinem Kind kam oder warum die beiden ihre gesamten Habseligkeiten in ihrem Auto samt Anhänger mit sich führten. Er wunderte sich nicht einmal, dass Vater mich nicht zur Schule schickte, sondern zu Hause unterrichtete. Er half sogar mit, indem er mir alles beibrachte, was bei der Bewirtschaftung eines Hofes anfällt: von den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, wie Kochen, Putzen oder dem Ausbessern von Kleidung über das Schlachten von Vieh, bis hin zum Fahren des Traktors. Vater ist froh um unsere neue Bleibe, auch wenn es ihn stört, dass Alfred, der Gutsherr, so viel trinkt. Aber ich mag Alfred. Er ist ein netter älterer Herr, der mich ebenfalls zu mögen scheint. Letztens haben wir die Einzäunung des Anwesens auf Schadstellen überprüft.
Als wir zurückkamen, hat er mir sogar etwas von seinem Schnaps in den Tee angeboten, weil er dann besser aufwärmt.
In dem Moment, als er mir von der braunen Flüssigkeit in die Teetasse eingießen wollte, kam mein Vater zu uns in die Küche.
Alfred bemerkte seinen Blick, ließ sofort die Flasche sinken und schaute schuldbewusst zu Boden.
Vater nickte kaum merklich und verließ die Küche wieder.
Ich hätte wissen müssen, dass es damit nicht vorbei war.
***
Am Abend saßen Vater und ich beim Essen in unserer Wohnung. Als ich meinen Becher ergriff, um daraus zu trinken, bemerkte ich einen seltsamen stechenden Geruch. Ich setzte ihn daraufhin wieder ab. Fragend schaute ich zu Vater.
Dieser nickte langsam und sagte: »Trink.«
»Was ist das, Vater?«
»Das ist das Teufelszeug, das Alfred dir vorhin geben wollte.«
Es brauchte einen Moment des Kräftesammelns, bevor ich antworten konnte.
»Ich ... ich möchte das nicht trinken.«
»Und doch wirst du es tun«, sagte er und durchbohrte mich mit seinem Blick.
»Aber ich ... ich wollte das vorhin nicht tun.«
»Red keinen Blödsinn, Nichtsnutz. Du hast ihm die Tasse hingehalten.«
»Ich wusste doch gar nicht, was das ist.«
»Aber trotzdem hast du ihm die Tasse nicht entzogen oder auch nur gefragt. Und jetzt trink.«
Er stellte eine Flasche auf den Tisch, die noch zu einem Viertel mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit gefüllt war.
»Alles!«
Als ich ihn daraufhin mit weit geöffneten Augen ansah, bemerkte ich den Lederriemen, der von seiner linken Hand baumelte.
»Trink es aus oder du erhältst eine Abreibung, bevor du es trinken wirst.«
Mit zitternden Fingern tastete ich nach dem Becher, denn ich wusste, dass er seine Drohung wahrmachen würde. Auf dem Weg zu meinem Mund wackelte der Becher so sehr, dass fast etwas von der Flüssigkeit über den Rand schwappte.
»Untersteh dich, etwas davon zu verschütten«, herrschte er mich an.
Ich hob den Becher zu meinem Mund, um zu trinken, vergaß aber dabei, vorher Luft zu holen oder mir wenigstens die Nase zuzuhalten. Die Dämpfe aus dem Becher stachen mir so sehr in die Nase, dass ich husten musste. Verzweifelt versuchte ich dabei, ihn ruhig zu halten, damit nichts verlorenging. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, was dann passieren würde. Es gelang mir, ihn abzustellen, um meinen Hustenanfall zu bekämpfen. Danach holte ich tief Luft, hielt mir die Nase zu und stürzte den Inhalt des Bechers so schnell, wie möglich hinunter.
Erst in diesem Moment bemerkte ich das Brennen. Es war, als ob mein Hals zerrissen würde. Wie eine unbarmherzige Flut von Lava bahnte sich das Getränk seinen Weg bis in meinen Bauch. Dabei hinterließ es eine Spur aus Schmerz in meinem Körper.
Vor Überraschung und Angst holte ich japsend Luft, aber auch sie brannte in mir wie Feuer.
»Unangenehm, nicht wahr?«, bemerkte Vater mit einem bitteren Lächeln.
Ich nickte – voller irrationaler Hoffnung, dass diese Bewegung in ihm eine Änderung seiner Entscheidung bewirken könnte.
Aber er schob nur mit unbewegter Miene die Flasche über den Tisch auf mich zu. Ich nahm sie und goss meinen Becher voll. In der Flasche blieb noch genug Flüssigkeit, um ihn ein weiteres Mal zu füllen.
Resigniert griff ich nach dem Becher ... und verfehlte ihn, denn in meinem Kopf hatte alles damit begonnen, sich zu drehen. Ich musste mich sehr stark konzentrieren, um ihn gegriffen zu bekommen. Dann begann ich zu trinken – vorsichtiger diesmal, weil ich hoffte, so das Brennen etwas abzumildern. Auch dieser Versuch war nicht viel besser, als der erste, denn so musste ich den Geschmack länger ertragen. Es schmeckte, als wenn man glühende Kohlen in einem Eimer voll Seifenlauge aufgelöst hätte. Das Kreiseln in meinem Kopf nahm immer mehr zu. Von meinem Magen her stieg eine Übelkeit in mir auf, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Mit tränenden Augen blickte ich zu Vater, der mir nur mit einem unbarmherzigen Kopfnicken zu verstehen gab, dass ich fortfahren sollte. Inzwischen verschwamm vor meinen Augen alles, sodass ich die Flasche fast beim Versuch, sie zu greifen, umstieß. Mit fahrigen Bewegungen kippte ich ihren Inhalt dorthin, wo ich meinen Becher vermutete. Es klappte mehr schlecht, als recht, aber es war mir mittlerweile egal, ob ich nun auch noch Schläge bekommen würde. Ich wollte nur noch, dass es vorbei war. Doch es war nicht vorbei.
»Jetzt iss«, befahl Vater und wies auf den Teller.
Dort konnte ich mit Mühe Stampfkartoffeln mit Spiegelei und Spinat erkennen – eigentlich meine Lieblingsspeise, aber im Moment musste ich beim Gedanken daran, etwas zu essen, schon würgen.
»Stell dich nicht so an. Du musst etwas zu dir nehmen, sonst wirkt der Alkohol noch stärker«, rief Vater ungeduldig.
Also begann ich, zu essen.
Der sonst so vertraute, ja geliebte Geschmack der Speisen war ekelerregend. Ich musste mich zu jedem Löffel zwingen. Immer wieder rang ich den Brechreiz nieder, aber noch bevor ich den letzten Bissen zum Mund führen konnte, schwanden mir die Sinne. Dunkelheit umfing mich.
***