

Dominik Geppert
GESCHICHTE DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
C.H.Beck
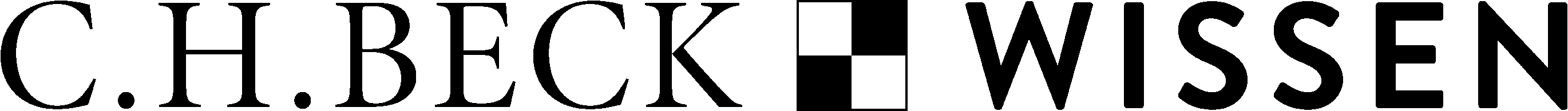
Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde lange als Erfolgsgeschichte erzählt. Leitmotive waren Verwestlichung, Liberalisierung, Zivilisierung und die erfolgreiche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. An dieser Lesart sind Zweifel aufgekommen. Zum einen stellt sich seit der Wiedervereinigung die Frage nach einer Nationalgeschichte jenseits des postnationalen Selbstverständnisses der alten Bundesrepublik mit neuer Dringlichkeit: Die Bundesrepublik ist nicht mehr der östlichste Frontstaat des Westens im Kalten Krieg. Sie findet sich als Macht in der Mitte des europäischen Kontinents wieder. Zum anderen verblasst das Deutungsmuster einer 1945/49 beginnenden success story, je stärker Fragen nach der Vorgeschichte gegenwärtiger Probleme in den Vordergrund treten. Damit rücken auch Gefährdungen der Demokratie, der Wandel von Institutionen und gesellschaftlichen Arrangements sowie neue außenpolitische Herausforderungen in den Blick.
Anschaulich und pointiert zeichnet Dominik Geppert vor diesem Hintergrund die Geschichte der Bundesrepublik von der Gründung bis zur Gegenwart nach. Sein Buch bietet eine konzise Einführung auf dem neuesten Stand der Forschung und ist gleichermaßen anregend wie informativ.
Dominik Geppert lehrt Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Bei C.H.Beck hat er (gemeinsam mit Nina Schnutz) herausgegeben: «Hans Werner Richter: Mittendrin. Die Tagebücher 1966–1972» (2012).
Einleitung
I. Neuanfang und Wiederaufbau (1945–1958)
1. Gründung in Stufen
2. Bonn und Weimar
3. Adenauers Kanzlerdemokratie
4. Konservative Modernisierung
II. Reform und Revolte (1958–1973)
1. Ein Land im Umbruch
2. Verschiebungen in der Parteienlandschaft
3. Modernisierung und Protest
4. Streit um die Außen- und Deutschlandpolitik
III. Bedrohte Sicherheit (1973–1985)
1. Weltwirtschaftliche Verwerfungen
2. Terrorismus und neue soziale Bewegungen
3. Die Volksparteien im Zenit
4. Internationale Koordinierung und Verschärfung des Kalten Krieges
IV. Transformation und Beharrung (1985–1999)
1. Ein neues Europa
2. Wirtschaft und Währung jenseits des Ost-West-Konflikts
3. Das System Kohl
4. Die Deutschen und die Nation
V. Aufbruch in die Berliner Republik (1999–2008)
1. Von Bonn nach Berlin
2. Machtwechsel
3. Die Bundesrepublik im Krieg
4. Abschied vom «Modell Deutschland»
VI. Globalisierung und ihre Grenzen (2008–2021)
1. Ein Aufschwung des Missmuts
2. Die Krise(n) Europas
3. Die Methode Merkel
4. Corona
Ausblick
Literatur
Für Anton, Charlotte und Paul
Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde lange als Erfolgsgeschichte erzählt. Als Leitmotive der Entwicklung einer «geglückten Demokratie» (Edgar Wolfrum) dienten die Konzepte von Verwestlichung, Stabilisierung, Liberalisierung, Zivilisierung und erfolgreicher Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. An einer derartigen Lesart sind Zweifel aufgekommen. Zum einen stellt sich seit der deutschen Einheit 1990 mit neuer Dringlichkeit die Frage nach einer Nationalgeschichte jenseits des postnationalen Selbstverständnisses der alten Bundesrepublik, die nur den westlichen Teil des heutigen Deutschlands umfasste. Die Bundesrepublik ist nicht mehr der östlichste Frontstaat des Westens im Kalten Krieg mit der Sowjetunion, sondern findet sich in der Mitte des europäischen Kontinents wieder, mit all den Herausforderungen an das politische Balancegefühl, die eine solche Lage mit sich bringt. Zum anderen verblasst das Deutungsmuster einer 1945/49 beginnenden Erfolgsgeschichte, je stärker das Staunen über die Stabilität der Bundesrepublik nachlässt und Fragen nach der Vorgeschichte gegenwärtiger Probleme in den Vordergrund treten. Diese sind kaum noch allein unter den Gesichtspunkten einer fortschreitenden Liberalisierung oder Zivilisierung der Deutschen einzuordnen, sondern verweisen auch auf Gefährdungen der Demokratie, den Wandel von Institutionen und gesellschaftlichen Arrangements sowie auf neue außenpolitische Herausforderungen jenseits der Westbindung im Kalten Krieg.
Die folgende Darstellung zeichnet die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ohne Rückgriff auf teleologische Erzählweisen nach. Sie skizziert den Wandel politischer Konstellationen und gesellschaftlicher Spannungslagen, ökonomischer Herausforderungen, intellektueller Strömungen und mentaler Dispositionen. Die Kapitelfolge orientiert sich weniger an den Amtszeiten einzelner Kanzler(innen) als an wirtschaftlichen Großwetterlagen, tektonischen Verschiebungen im Parteienspektrum und der Rückbindung an die internationale, speziell europäische Politik. Die Geschichte der Bundesrepublik war und ist mehr als eine Abfolge von Regierungen und Koalitionen, von konjunkturellen Auf- oder Abschwüngen, gesellschaftlichen Umschichtungsprozessen oder kulturellen Transformationen. Es ging und geht in ihr immer auch um die Herausbildung einer sich wandelnden staatlichen und gesellschaftlichen Identität, die in der Lage ist, Leitideen zu verkörpern. Dabei bleibt das vereinigte Deutschland normativ auf die Geschichte der Bundesrepublik angewiesen. Denn diese ist in ihren Errungenschaften und Irrungen gleichermaßen Identitätsressource und historische Orientierungslinie für die Gegenwart.
Die Gründung der Bundesrepublik war kein Ereignis, sondern ein Prozess. Sie erfolgte schrittweise: in Sprüngen und über Stufen. Dabei wurden die Gründungsetappen des westdeutschen Staates jeweils von den Eskalationsschüben des sich verschärfenden weltpolitischen Gegensatzes zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion angestoßen. Im Schatten wechselseitiger Bedrohung mit Nuklearwaffen standen Marxismus-Leninismus, Planwirtschaft und Zentralismus sowjetischer Prägung gegen liberalen Pluralismus, Marktwirtschaft und Demokratie westlicher Spielart. Europa und vor allem das besiegte Deutschland waren in den späten 1940er Jahren der wichtigste Schauplatz der globalen Auseinandersetzung zwischen den beiden neuen Supermächten «um die Seele der Menschheit» (Melvyn Leffler).
Vier Monate nachdem US-Außenminister James F. Byrnes Anfang September 1946 erstmals die Möglichkeit einer (zunächst noch gesamtdeutsch gedachten) Selbstregierung angedeutet hatte, wurden die amerikanische und die britische Besatzungszone zum «Vereinigten Wirtschaftsgebiet» der Bizone mit zentralen Verwaltungen für Wirtschaft, Ernährung, Verkehr, Finanzen und Post fusioniert, um die katastrophale Wirtschafts- und Ernährungslage der deutschen Bevölkerung zu verbessern. Ein Zusammengehen mit der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) erschien unmöglich. Auch die französische Regierung, der auf britische Fürsprache eine eigene Besatzungszone im deutschen Südwesten zugewiesen worden war, weigerte sich zunächst, die Abschottung ihrer Zone aufzugeben. 1947 spitzte sich die globale Konfrontation der Supermächte zu. US-Präsident Harry S. Truman versprach amerikanische Hilfe beim Widerstand gegen den Kommunismus zur Eindämmung weiterer sowjetischer Expansion: Entweder, so sah es Truman, man gehörte zur freien Welt des Westens oder zur totalitären Welt des Ostens. Der sowjetische Diktator Josef Stalin ließ seinen engen Mitarbeiter Andrei Schdanow mit seiner eigenen Version der Zwei-Lager-Theorie antworten: hier das antiimperialistische Lager der sozialistischen Staaten unter sowjetischer Führung, dort die Imperialisten unter der Knute der Amerikaner.
Die logische Konsequenz dieser Weltsicht bestand darin, das eigene Lager zu konsolidieren. Die USA fürchteten, wirtschaftliche, politische und soziale Auflösungsprozesse im kriegszerstörten Europa würden den Kommunismus stärken. Um die Erosion Westeuropas zu stoppen, legte Byrnes’ Nachfolger als Außenminister, George C. Marshall, einen Plan auf, über den Europa bis 1952 insgesamt mehr als 13 Milliarden Dollar Aufbauhilfe erhielt. Die Amerikaner boten ihre Unterstützung nicht jedem Land einzeln an. Sie beharrten vielmehr darauf, die Europäer müssten sich als Vorleistung auf ein gemeinsames Wirtschaftsprogramm einigen und dauerhaft um wirtschaftspolitische Zusammenarbeit im Rahmen der Organization for European Economic Cooperation (OEEC) bemühen, die im Frühjahr 1948 nach einigen Querelen gegründet wurde. Die Sowjetunion sorgte dafür, dass die ostmitteleuropäischen Staaten in ihrem Einflussbereich nicht am Marshallplan teilnahmen, obwohl die Tschechoslowakei, Polen und Ungarn ursprünglich Interesse bekundet hatten. Stattdessen legte Stalin mit der Kominform als Koordinationsbüro der kommunistischen Parteien zur Festigung sowjetischer Dominanz und mit dem Molotow-Plan vom Juli 1947 als Keimzelle des späteren Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) das Fundament für eine östliche Antwort auf die westliche Eindämmungspolitik.
Vor dem Hintergrund zunehmender weltpolitischer Polarisierung konnte es niemanden verwundern, dass sich die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs auf der Londoner Außenministerkonferenz im November und Dezember 1947 nicht auf die stufenweise Etablierung einer gemeinsamen Regierung in allen Besatzungszonen einigen konnten; der letzte Anlauf zur Schaffung einer gesamtdeutschen Regierung war damit gescheitert. Ein kommunistischer Staatsstreich in der Tschechoslowakei erweiterte das sowjetische Einflussgebiet im Februar 1948 weiter nach Westen. Im März zogen sich die sowjetischen Vertreter aus dem Alliierten Kontrollrat zurück, der obersten Besatzungsbehörde in Deutschland, in der die Militärgouverneure der vier Siegermächte alle ganz Deutschland betreffenden Fragen zu regeln hatten. Zwei Wochen später trat der Marshallplan für Westeuropa in Kraft, an dem auch die Bizone und die französische Besatzungszone teilhatten. Am 20. Juni 1948 folgte die Einführung der D-Mark in den drei Westzonen, die für die wirtschaftliche Konsolidierung Westdeutschlands entscheidend war, gefolgt von einer Währungsreform in der SBZ drei Tage später. Damit war die wirtschaftliche Spaltung Deutschlands de facto vollzogen.
Fast zeitgleich verdichtete die UdSSR die seit Monaten andauernden Behinderungen des freien Verkehrs mit den westlichen – von Amerikanern, Briten und Franzosen kontrollierten – Sektoren Berlins zu einer weitgehenden Blockade der Teilstadt, die wie eine Insel mitten in der SBZ lag. Stalin wollte die Briten und Amerikaner zur Aufgabe ihrer Weststaatspläne zwingen oder, falls dies nicht gelang, wenigstens dafür sorgen, dass sie sich aus ihren Sektoren zurückzogen. In London und etwas später auch in Washington setzten sich allerdings die Kräfte um den britischen Außenminister Ernest Bevin und den Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone, General Lucius D. Clay, durch, die dem sowjetischen Druck nicht nachgeben und stattdessen an den Plänen für die Gründung eines Weststaates festhalten wollten. «Wenn wir der Ansicht sind», so Clay, «dass wir Europa gegen den Kommunismus halten müssen, dann dürfen wir uns nicht vom Fleck rühren.» Der einzige Weg, der hierfür offenstand, war die Versorgung West-Berlins per Flugzeug, weil nur die Luftkorridore zwischen den Siegermächten vertraglich festgelegt worden waren, während die Sowjetunion alle anderen Zufahrtswege auf der Straße, über die Schiene und mit dem Schiff unterbrechen konnte.
Der Durchbruch vom westdeutschen Wirtschaftsverbund zum politisch verfassten Gemeinwesen fand im Schatten der ersten großen Krise des Kalten Krieges statt. Auf der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz hatten die USA und Großbritannien die widerstrebenden Benelux-Staaten und Frankreich im Frühjahr 1948 dazu gebracht, einer Umwandlung der westdeutschen Wirtschaftszone in einen regelrechten Staat zuzustimmen. Die einzigen gewählten Vertreter des deutschen Volkes, die dieser Entscheidung der Westmächte demokratische Legitimität verleihen konnten, waren die Ministerpräsidenten der elf Länder. Sie wurden daher von den Militärgouverneuren der drei westlichen Besatzungszonen im Juli 1948 in den sogenannten Frankfurter Dokumenten aufgefordert, die Verfassung eines westdeutschen Staates vorzubereiten.
Obwohl die Ministerpräsidenten aus Sorge vor einer Zementierung der deutschen Teilung anfangs zurückhaltend reagiert hatten, trat nicht zuletzt auf amerikanischen Druck im August ein Sachverständigenausschuss zusammen, um im Auftrag der Ministerpräsidenten den ersten Entwurf einer provisorischen Verfassung zu erarbeiten. Im Anschluss an diesen sogenannten Herrenchiemseer Verfassungskonvent setzte von September 1948 bis Mai 1949 der Parlamentarische Rat die Arbeit fort, immer wieder unterbrochen von den Besatzungsmächten, die durch Memoranden und über ihre Verbindungsoffiziere in die Verhandlungen eingriffen. Bei der Verabschiedung am 8. Mai 1949 wurde das Verfassungswerk, das man zur Betonung seines provisorischen Charakters «Grundgesetz» nannte, gegen die Stimmen der Kommunisten, der konservativen Deutschen Partei (DP), des katholischen Zentrums sowie sechs von acht CSU-Vertretern angenommen; später votierte auch der Bayerische Landtag dagegen, weil ihm der Föderalismus nicht weit genug ging. Vier Tage darauf, am 12. Mai 1949, genehmigten die drei Militärgouverneure, die sich das letzte Wort vorbehalten hatten, das Grundgesetz. Am selben Tag gab die UdSSR nach elf Monaten die Zufahrtswege nach Berlin wieder frei. Stalins Bestreben, die Gründung eines westdeutschen Staates zu verhindern, war ebenso gescheitert wie sein Versuch, die Westmächte aus Berlin zu vertreiben. Der sowjetische Diktator war zum unfreiwilligen Geburtshelfer der Bundesrepublik geworden.
Das Grundgesetz trat am 24. Mai 1949 in Kraft, Mitte August fand die Wahl zum ersten Bundestag statt. Mit den konstituierenden Sitzungen von Bundestag und Bundesrat war Anfang September die institutionelle Gründung der zweiten deutschen Republik abgeschlossen. Ihren Sitz nahmen Regierung und Parlament in Bonn am Rhein, wo schon der Parlamentarische Rat getagt hatte. Bonn war im Krieg nicht so verheerend getroffen worden wie andere Städte. Als preußische Garnisonsstadt verfügte es über Kasernengebäude, in denen die neuen Ministerien und Ämter untergebracht werden konnten. Dass Konrad Adenauer, der nur wenige Kilometer stromaufwärts in Rhöndorf wohnte, als Präsident des Parlamentarischen Rates und Vorsitzender der CDU in der britischen Besatzungszone im Hintergrund die Strippen zog, schadete ebenfalls nicht. Vor allem aber galt die Entscheidung für Bonn und gegen Frankfurt – die traditionsreiche Krönungsstadt der deutschen Kaiser, im 19. Jahrhundert Sitz des Deutschen Bundestages und 1848/49 Tagungsort der ersten deutschen Nationalversammlung – als Bekenntnis zum provisorischen Charakter der neuen Ordnung, die nur als Zwischenschritt zu einer Rückkehr der Regierung in die alte Hauptstadt an der Spree gesehen oder jedenfalls propagiert wurde.
Das Provisorium erwies sich jedoch als derart langlebig, dass «Bonn» zum Synonym der zweiten deutschen Republik wurde. Besorgte Zeitgenossen fürchteten, diese könnte das Schicksal ihrer Vorgängerin von Weimar teilen. Tatsächlich war die zweite deutsche Republik wie die erste aus Krieg und Niederlage entstanden. Eine tiefgreifende sozialistische Umgestaltung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft blieb in der jungen Bundesrepublik wie nach 1918 aus. Die Führungspositionen wurden 1949 zudem von Männern eingenommen, die schon in Weimar zur politischen Elite gezählt hatten: der christdemokratische Bundeskanzler Adenauer als Kölner Oberbürgermeister und Präsident des preußischen Staatsrats, Bundespräsident Theodor Heuss von der FDP und der sozialdemokratische Oppositionsführer Kurt Schumacher als Reichstagsabgeordnete.
In mancher Hinsicht war die Situation schlechter als nach dem Ersten Weltkrieg. Denn anders als nach 1918 lagen weite Gebiete des Landes, vor allem die großen Städte, in Trümmern. Industrieanlagen und Infrastruktur waren zum Teil schwer beschädigt oder von den Besatzungsmächten demontiert worden. Rechtlich gesehen war die Bundesrepublik anfangs nicht viel mehr als ein Protektorat der USA, Großbritanniens und Frankreichs, die nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht im Mai 1945 (gemeinsam mit der Sowjetunion) mit der uneingeschränkten Macht der Sieger in Deutschland herrschten. Die drei westlichen Militärgouverneure hatten sich zwar im Mai 1949 an ein Besatzungsstatut gebunden, das mit der Konstituierung der ersten Bundesregierung in Kraft trat; darin wurden ihre Kompetenzen schriftlich fixiert und begrenzt. Auch nach Übertragung exekutiver, legislativer und rechtsprechender Gewalt an Bund und Länder bestanden die drei Besatzungsmächte jedoch auf umfangreichen Hoheitsrechten, etwa für Abrüstungsfragen und wirtschaftliche Entflechtung, für Restitutionen und Reparationen, für auswärtige Angelegenheiten, für die Überwachung des Außenhandels und der Devisenwirtschaft; vor allem behielten sie sich das Recht vor, die Staatsgewalt im Notfall auch wieder ganz in die eigenen Hände zu nehmen.
Die anfängliche Machtlosigkeit der Deutschen und die Herrschaft der Siegermächte erwiesen sich langfristig als Vorteil für die Etablierung eines stabilen Gemeinwesens. Denn die schlimmsten Jahre der Nachkriegsnot fielen noch in die Besatzungszeit, so dass Hunger und Lebensmittelrationierung, Kriegszerstörung und Wohnungsmangel nicht mit einer deutschen Regierung, sondern mit den Siegermächten assoziiert wurden. Anders als nach 1918 stand die Kriegsschuld außer Frage. Der nationalsozialistische Vernichtungskrieg und die Monstrosität der Verbrechen, die Deutsche begangen hatten, waren durch nichts zu rechtfertigen. Für neue Dolchstoßlegenden ließen die vollständige Niederlage der Wehrmacht und die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches keinen Raum. Die Hauptkriegsverbrecher wurden von den Siegermächten 1946 in Nürnberg verurteilt. Deutsche spielten als Ankläger oder Richter in Nürnberg ebenso wenig eine herausgehobene Rolle wie bei den über 5000 weiteren Prozessen, die unter alliierter Regie bis 1949 stattfanden. Vorwürfe des «Vaterlandsverrats» gegenüber den neuen politischen Eliten, wie sie nach 1918 an der Tagesordnung waren, blieben in der jungen Bundesrepublik seltene Ausnahmen. Zugleich war eine positive Bezugnahme auf Hitler und den Nationalsozialismus öffentlich nicht mehr möglich, auch wenn das in Privatgesprächen und hinter vorgehaltener Hand noch längere Zeit anders blieb.
Insbesondere die umfassende Entnazifizierungspolitik mit Hilfe von Fragebögen, Spruchkammerverfahren und massenweisen Entlassungen, die die Amerikaner und weniger rigoros auch die Briten und Franzosen betrieben, war in der deutschen Bevölkerung verhasst und in Teilen auch ungerecht, weil man zunächst die einfacher zu bearbeitenden kleinen Mitläufer aburteilte, während die schweren Fälle oft aufgeschoben wurden und auf diese Weise später leichter davonkamen. Dennoch war die Entnazifizierungspolitik bedeutsam für den politischen und gesellschaftlichen Neuanfang. Sie zwang überzeugte Nationalsozialisten, sich in den ersten Jahren nach Kriegsende in der Öffentlichkeit zurückzuhalten. Das verschaffte den demokratischen Kräften beim Aufbau von Parteien, Länderregierungen, Presse und Rundfunk einen Startvorteil, den sie in der Weimarer Republik nicht besessen hatten, zumal die Alliierten bis 1949 (und auch später) darüber wachten, dass sich keine neonazistischen Gruppierungen und Netzwerke bildeten.
Auch jenseits der Entnazifizierung trafen die Alliierten Entscheidungen, die unpopulär, aber für den Neuanfang wichtig waren. Sie zerschlugen Preußen, dessen schiere Größe sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik für eine Unwucht im Staatsaufbau gesorgt hatte. Aus der preußischen Erbmasse schnitten sie neue Länder wie Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, deren Abmessungen in der Regel den Grenzen der alten preußischen Provinzen entsprachen. Sie gründeten die «Bank deutscher Länder» als Vorläuferin der Bundesbank und verantworteten im Juni 1948 die Währungsreform, die eine wesentliche Grundlage für den Aufschwung der 1950er Jahre bildete. Den Deutschen blieb bis 1949 nur die politische Betätigung auf Landesebene und die Mitarbeit im seit Juni 1947 in Frankfurt tagenden Wirtschaftsrat der Bizone, später der Trizone, der von den Landesparlamenten beschickt wurde und seiner Bestimmung nach ein unpolitisches Verwaltungsgremium war.
Im öffentlichen Diskurs stand der «Weimar-Komplex» (Sebastian Ullrich) für das zu großen Teilen selbstverschuldete Scheitern der ersten deutschen Republik, aus dem die zweite ihre Lehren zu ziehen hatte. Die Väter und (wenigen) Mütter des Grundgesetzes taten dies im Parlamentarischen Rat, indem sie auf direktdemokratische Elemente fast völlig verzichteten; nur für die Neugliederung der Bundesländer war ein Volksentscheid vorgesehen. Das Staatsoberhaupt wurde im Vergleich zum Weimarer Reichspräsidenten weitgehend auf Repräsentationsaufgaben beschränkt und seiner plebiszitären Legitimation durch Direktwahl ebenso entkleidet; es gab auch keinen Notverordnungsparagrafen, der es dem Reichspräsidenten vor 1933 ermöglicht hatte, in einer Art Ersatzverfassung für Krisenzeiten am Parlament vorbeizuregieren. Nicht mehr der Präsident fungierte in der Institutionenordnung der Bundesrepublik als «Hüter der Verfassung» (Carl Schmitt), sondern das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dessen Mitglieder von Bundestag und Bundesrat gewählt wurden; mit der Einrichtung einer gerichtlichen Kontrollinstanz über der Politik stellte sich das Grundgesetz in eine spezifisch deutsche Tradition der Rechtsstaatlichkeit, die im «Dritten Reich» gekappt worden war.
Dass «Bonn» nicht «Weimar» wurde, wie der Schweizer Publizist Fritz René Allemann 1956 den Untergangspropheten der zweiten deutschen Republik entgegenhielt, hatte auch mit dem Führungspersonal zu tun, das Staat und Regierung in ihrer Gründungsphase prägte, vor allem mit Konrad Adenauer, der am 15. September 1949 mit knapper Mehrheit zum ersten Bundeskanzler gewählt wurde. Als Parteivorsitzendem der CDU in der britischen Zone war es ihm gelungen, zusammen mit CSU, FDP und der konservativen Deutschen Partei (DP) eine «bürgerliche» Koalition zu bilden. Die SPD unter Kurt Schumacher, der sich ebenfalls Hoffnungen auf die Kanzlerschaft gemacht hatte, wurde auf die Oppositionsrolle verwiesen. Damit setzte sich Adenauer gegen auch in seiner eigenen Partei verbreitete Pläne durch, eine Große Koalition aus Union und SPD nach Vorbild der Weimarer Koalition von 1919 zu bilden, wie sie auf Länderebene in den Jahren zuvor mehrfach zustande gekommen war.
Adenauer, der von 1917 bis 1933 als Kölner Oberbürgermeister einer der mächtigsten Zentrumspolitiker der Weimarer Republik gewesen war, stand bei seinem Amtsantritt als Bundeskanzler bereits im 74. Lebensjahr. Die Nationalsozialisten hatten ihn gleich nach ihrer Machtübernahme aus dem Amt getrieben. Bis Kriegsende lebte er zurückgezogen in seinem Haus in Rhöndorf in der inneren Emigration, ohne sich mit dem NS-Regime einzulassen, aber auch ohne engere Kontakte zu Widerstandskreisen. Die britische Sonntagszeitung «The Observer» beschrieb ihn im Sommer 1949 als den mit Abstand besten «Taktiker auf der politischen Bühne Deutschlands». Adenauer war ein konservativer Katholik, aber kein Klerikaler. Das katholische Milieu und der Kölner Klüngel hatten ihn stärker geprägt als päpstliche Enzykliken oder Gehorsam gegenüber der Amtskirche. Als Regierungschef etablierte er in der jungen Bundesrepublik, was später als «Kanzlerdemokratie» bezeichnet wurde.
Diese für die Anfangsjahre der Bundesrepublik spezifische Form einer vom Kanzler straff bis autoritär geführten Regierung besaß ihr Fundament im Grundgesetz. Der Parlamentarische Rat hatte das Amt des Staatsoberhaupts geschwächt, aber den Regierungschef aufgewertet. Der Bundeskanzler bestimmte nach Artikel 65 die «Richtlinien der Politik». Er legte den Zuschnitt der einzelnen Ressorts fest und entschied bei Streitigkeiten zwischen den Ministerien. Sowohl gegenüber dem Bundespräsidenten als auch gegenüber dem Parlament besaß er eine starke Stellung und konnte vom Bundestag nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt werden, was kurzlebige Regierungen wie in Weimar verhindern helfen und die Parteien zur Kooperation zwingen sollte. Adenauers hervorgehobene Position fand ihren Ausdruck im Aufbau eines machtvollen Bundeskanzleramts als Regierungszentrale, das die verschiedenen Ressorts kontrollierte, bei der Personalpolitik der Ministerien entscheidend mitsprach und auch in Gesetzesvorhaben direkt eingriff.
Im Verhältnis zu den Siegermächten, die bis zur Aufhebung des Besatzungsstatuts 1955 die oberste Souveränität im Lande innehatten und vor jeder wichtigen Entscheidung konsultiert werden mussten, erwies Adenauer sich als verlässlicher, durchsetzungsstarker Partner. Im Umgang mit dem Bundestag pflegte er einen patriarchalisch-obrigkeitlichen Stil. Als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zur Sozialdemokratie hatte sich schon im Wirtschaftsrat die Frage der Wirtschaftsordnung herauskristallisiert. Diese wurde von Adenauer und Ludwig Erhard im Wahlkampf 1949 auf die Formel «bürokratische Planwirtschaft gegen soziale Marktwirtschaft» zugespitzt. Der Begriff der «Sozialen Marktwirtschaft» zielte darauf, «das Prinzip der Freiheit auf dem Markte mit dem des sozialen Ausgleichs zu verbinden» (Alfred Müller-Armack).