

Ian und das Amulett der Laghoiries
Lena Detlefsson
edition oberkassel
Seit Jahrhunderten herrschte im Land eine Fehde zwischen den beiden Clans der McLarens und der McGregors. Das Amulett der Laghoiries soll der Legende nach der Schlüssel zu einem dauerhaften Frieden sein. Ob es tatsächlich zu einem Frieden beider Familien kommen wird, erzählt diese Geschichte.
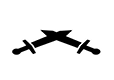
Ian McLaren blickte in den Himmel und versuchte, das Wetter der nächsten Tage abzuschätzen. Die Sonne schien, und es war noch ungewöhnlich warm für diese späten Herbsttage. Das würde in den folgenden Tagen wahrscheinlich nicht so bleiben. Weiße Wolkenschlieren zogen weit entfernt am Himmel vorbei an Donnahew Castle, dem Stammsitz der McLarens.
Ian war heute unterwegs gewesen und hatte bei den Pächtern und Bauern nach dem Rechten geschaut. Sie hatten geklagt, dass die Ernte nicht so gut ausgefallen sei. Er überlegte, ob und wie viel er seinen Leuten von der Pacht erlassen konnte. Aber ihm blieb kein großer Spielraum. Er musste zusehen, dass er seine Familie und seine direkten Bediensteten versorgen konnte. Erst wenn es ihnen gut ging, konnte er sich um die Sorgen und Nöte der Bauern kümmern.
Als er am Ufer des Flusses, der seiner Burg das nötige Wasser lieferte, in Richtung Donnahew entlangritt, wanderte sein Blick über die Landschaft. Es war ein stattliches Stück Land, das er hier beackerte und verwaltete. Viele Jahre vor ihm hatten es sein Vater und davor schon dessen Vater bearbeitet. Ian hoffte, sein Vater wäre stolz auf ihn, wäre stolz darauf, dass er die Tradition der Berserker auf den richtigen Wegen fortführte.
Kurz vor seinem Ziel sah er rechts den Übungsplatz für die Ausbildung der Kämpfer seines Clans. Robert, sein Schwertmeister, arbeitete momentan mit zwei Knaben aus Keltie Bridge. Einer von beiden sollte demnächst als Stallbursche auf Donnahew in Lohn und Brot genommen werden. Ians Mundwinkel gingen nach oben und ließen unter dem buschigen Schnauzbart seine Zähne hervorschauen, als er die roten Köpfe und die zerzausten Haare der Jünglinge sah. Er hielt sein Pferd an, um dem Treiben noch etwas zuzuschauen.
»Nicht so zaghaft, Bursche«, hörte Ian seinen Schwertmeister rufen. »Du bist doch sonst so wagemutig. Dann kannst du beim Zuschlagen auch ruhig vorwärtsmarschieren. Nur den Schild darfst du dabei nicht vergessen.«
»Aye, Master Robert.«
Amüsiert und mit einem Schnalzen auf der Zunge trieb Ian sein Pferd wieder an. Er brauchte gute Männer – Männer, die etwas vom landwirtschaftlichen Handwerk verstanden, aber auch wussten, wie man ein Schwert führt und sich verteidigt. Denn so still wie in der letzten Zeit war es eine geraume Weile nicht gewesen. Der König hatte schon lange keinen Auftrag mehr für ihn gehabt, und Rupert McGregor schien auch in seinem Zwist gegen die McLarens die Luft ausgegangen zu sein.
Als er durch das Tor von Donnahew Castle kam, das dieser Tage meist offen stand, hörte er seine Köchin Breaca mit ihrem Mann Oswald schimpfen.
»Jetzt sieh dir das an!«, herrschte sie den Stallmeister an. »Was du schon wieder angestellt hast. Ich habe dir erst heute ein frisch gestopftes Hemd gegeben. Und du hast nichts anderes zu tun, als dich damit im Stall an einem Pflock aufzuhängen.«
Wenn es weiter nichts ist, dachte Ian. Dann flicke es halt noch mal. Dein Mann hat nur seine Arbeit getan.
Oswald hatte es aufgegeben, seiner Frau gegenüber zu argumentieren. Schuldbewusst zog er den Kopf zwischen die Schultern und hoffte, dass diese Schimpftirade ohne großen Schaden über seinen Kopf hinwegziehen würde.
Ian McLaren erlöste ihn aus seiner Bedrängnis. »Oswald, bringst du mein Pferd in den Stall? Gib ihm Hafer und Wasser – es wird durstig sein.«
»Ja, sofort, Mylord. Bin schon unterwegs.« Mit diesen Worten eilte Oswald auf Ian zu und ergriff die Zügel. Ian stieg aus dem Sattel und begab sich in die Halle.
Dort wartete bereits Bellana darauf, ihn zu begrüßen. Seitdem die älteren Mädchen nicht mehr im Haus lebten, war es für sie einfacher geworden, den Haushalt zu führen. Und wenn ihr danach war, ritt sie manchmal gemeinsam mit ihrem Mann über die Wiesen und durch die Wälder, wie sie beide es schon als Jugendliche getan hatten.
»Wie war dein Tag, Ian? Konntest du erledigen, was du dir vorgenommen hast?«, begrüßte sie ihren Mann.
»Aye, der war schon erfolgreich. In Murraybridge hatte ich Gelegenheit, einen kleinen Streit zu schlichten. Zwei Bauern waren sich über Bewirtschaftung eines Streifens Land nicht einig. Finley Murray ist einige Tage unterwegs. Bei unserm Schwiegersohn, dem König, wie es heißt.« Er schloss seine Frau in die Arme und gab ihr einen dicken Kuss. Er genoss es, sie kaum noch mit den Mädels teilen zu müssen. Die Kleinste der vier, Catriona, nahm sie auch nicht mehr so sehr in Anspruch. Sie war jetzt in einem Alter, in dem sie nicht mehr viel mit ihren Eltern zu tun haben wollte. Ihr schwebte eher Oswalds Sohn durch den Kopf.
»Dann ist ja alles gut. Breaca stellt bald das Abendessen auf den Tisch. Wenn du magst, kannst du dich zuvor noch frisch machen.«
»Das ist eine gute Idee. Und nach dem Essen werde ich mich gleich ins Bett legen. Ich bin ziemlich müde. Wahrscheinlich hat mir die Sonne zu sehr auf den Pelz geschienen.«
***
Die drei Reiter hingen schlaff in ihren Sätteln. Sie waren schon den ganzen Tag unterwegs. Die Sonne ging zu ihrer linken Seite langsam unter. Es dürfte nicht mehr so weit sein, bis sie das Clan-Gebiet der McGregors erreichen sollten.
Sie hatten heute nur zur Mittagsstunde kurz an einem See angehalten und ein Stück Brot mit Käse gegessen, um sich dann sofort wieder auf den Weg zu machen. Unten im Süden war ihnen zu Ohren gekommen, dass McGregor Soldaten suchte. Den dreien war es egal, für wen sie kämpften, solange sie ihr Auskommen davon hatten. Kleidung, Unterkunft und Essen reichten ihnen. Wenn der Herr noch etwas drauflegte, was meist der Fall war, konnten sie wenigstens hin und wieder den Abend mit einem Trunk beschließen – zwar nicht immer mit einem guten, aber mit einem, der die Seele beruhigte. Warum der Schotte Rupert McGregor jetzt Soldaten anwarb, war ihnen bislang noch nicht zugetragen worden. Doch sie hatten keine Lust mehr, wie Banditen durch die Lande zu ziehen und die Bauern auszuplündern. Das hieß, plündern würden sie auch im Auftrag von McGregor. Aber sollte es mal eine Flaute geben, dann müsste ihr Herr sie trotzdem versorgen. Sie müssten also nicht ohne Unterlass zum eigenen Lebensunterhalt auf Raubzug gehen.
Für die drei Männer wurde es höchste Zeit, wieder in Diensten zu stehen. Ihre Kleidung war schon ziemlich heruntergekommen und zerschlissen. Es war einige Monate her, dass sie in Wessex für den dortigen Erzbischof gegen eine Horde von Wikingern gekämpft hatten. Doch die Kerle aus dem Norden waren zäh gewesen. Sie schlugen sich recht hartnäckig. Die englischen Truppen hatten viel zu tun gehabt. Da war keine Zeit geblieben, die Kleider ausbessern zu lassen – erst recht nicht, nachdem sich die drei Reiter von den Engländern aus den Diensten des Bischofs entfernt hatten. Mit nichts weiter als ihren Pferden und Waffen hatten sie sich auf den Weg gemacht. Hatte ihre Kleidung schon in den Kämpfen gelitten, so wurde sie beim Ausplündern der Bauern und Pächter nicht besser. Zwar gab es mal eine andere Hose oder ein anderes Hemd, aber da die Bauern selbst arm waren, waren auch deren Sachen meist zerschunden.
»Was haltet ihr davon, wenn wir uns jetzt eine gute Stelle zum Übernachten suchen?«, fragte John, der allein wegen seiner stattlichen Größe wie ein Anführer wirkte. Er trug eine schmutzige, lederne Hose und ein zerschlissenes Hemd. An der Seite seines dunklen Gaules hing ein runder Schild, der teils aus Holz, teils aus Eisen gefertigt war. Er schien sehr robust zu sein und im Kampf guten Schutz zu bieten. An der anderen Seite des Pferdes hingen ein Schwert und zwei Äxte, die John wegen der Bequemlichkeit im Sattel von seinem Gürtel abgenommen hatte. Hier am Pferd waren die Waffen genauso schnell erreichbar, falls es notwendig sein sollte, nach ihnen zu greifen.
»Ja, es wird Zeit. Mir tun schon alle Knochen weh«, sagte Francis, ein eher schmächtiger Mann mit rotem Haarwuchs, der aus Irland stammte. Der Bart in seinem Gesicht war so dünn, dass jede Rasur verschwendete Zeit gewesen wäre.
»Die Knochen tun dir weh?«, mischte sich nun auch Elroy ins Gespräch ein. »Was bist du denn für ein Mann? Ich dachte immer, Kämpfer kennen keinen Schmerz. Aber klar, wer das Gefecht unter den Kleidern der Trossweiber abwartet, überlebt so auch den Kampf.« Elroy, den eine große Narbe auf der Stirn, die von links nach rechts ging, gefährlich aussehen ließ, war der Einzige unter ihnen, der einen Kilt trug. Es war ein Kilt in den Farben eines überwiegend grünen Tartans. Elroy war von Geburt Schotte. So haben es zumindest die Leute erzählt, bei denen er aufgewachsen war. Aber wie sich das mit den Schotten verhält und zu welchem Clan sein Kilt gehörte, den er doch nur einem Bauern abgenommen hatte, konnte er nicht sagen. Doch seine Pflegeeltern hatten damals dafür gesorgt, dass er das Spielen eines Dudelsacks lernte. Deshalb hing an seinem Pferd hinter dem Sattel neben den zwei Äxten auch ein solches Instrument.
»Hoho, komm mir doch nicht so«, maulte Francis zurück. »Du willst wohl wieder eine Tracht Prügel von mir beziehen. Wäre wohl nicht das erste Mal, oder?« Wahrscheinlich war es die Körpergröße des Iren, die ihm solch eine große Klappe verliehen hatte. Wie alle etwas kleiner geratenen Menschen war auch er mit seinem Mundwerk sehr geschwind. Er schreckte damit zwar nicht vor Hünen zurück, aber er ging damit auch nicht immer als Sieger aus einem Kampf hervor.
»Hey, ihr zwei, nun lasst es mal gut sein!«, ertönte die dunkle Stimme ihres Anführers. »Da vorne unter den Bäumen scheint ein guter Platz für uns zu sein. An dem Bach können wir uns und unsere Pferde mit Wasser versorgen.«
Die Stelle, auf die John wies, war nur noch wenige Schritte entfernt. Sie war tatsächlich für die Nacht gut geeignet. Die drei Männer stiegen von ihren Pferden und führten diese an den Bach. Sie selbst begaben sich etwas bachaufwärts, um sich dort an dem sanft fließenden Gewässer zu erfrischen.