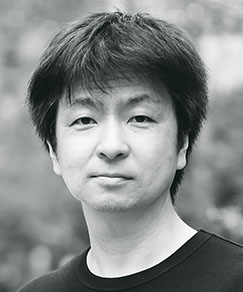
Foto: © Osamu Hoshikawa
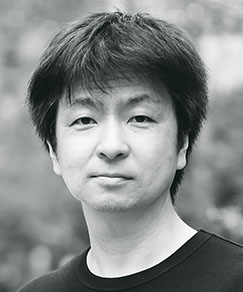
Foto: © Osamu Hoshikawa
Kotaro Isaka, geboren 1971, ist einer der international erfolgreichsten japanischen Autoren. Er wurde mit fünf der wichtigsten japanischen Literatur- und Krimipreise ausgezeichnet, und viele seiner 24 Romane wurden verfilmt. Seine Bücher erscheinen u. a. in den USA, in Großbritannien, China, Korea, Russland, Italien, Frankreich – und jetzt auch in Deutschland.
Die Übersetzerin
Katja Busson, geboren 1970, studierte Japanologie und Anglistik in Trier und Tokyo. Sie übersetzte u.a. Nanae Aoyama, Keigo Higashino, Mieko Kawakami, Ko Machida, Natsu Miyashita, Junichiro Tanizaki und Shugoro Yamamoto.
Der Bahnhof Tokio war voll. Ob das normal war, wusste Yuichi Kimura nicht. Er war lange nicht mehr hier gewesen. Man hätte ihm auch erzählen können, dass es sich um eine Großveranstaltung handelt. Er musste an die Pinguine denken, die er mit Wataru im Fernsehen gesehen hatte. Die hatten sich auch so gedrängelt. Aber das konnte er verstehen. Denen war kalt gewesen.
Kimura nutzte eine Lücke im Gewimmel, ging zwischen einem Souvenirgeschäft und einem Kiosk hindurch und beschleunigte den Schritt.
Er stieg eine kurze Treppe hinauf und passierte die automatische Sperre. Die Befürchtung, dass die Waffe in seiner Innentasche dabei entdeckt, die Schranke sich schließen und er vom Sicherheitspersonal überwältigt werden könnte, erwies sich als unbegründet. Er blieb stehen, sah zur elektronischen Anzeigetafel auf und vergewisserte sich, auf welchem Gleis sein Zug abfuhr, der Shinkansen Hayate. Die uniformierten Wachmänner nahmen keine Notiz von ihm.
Ein kleiner Junge mit Rucksack ging an ihm vorbei, ein Grundschüler wohl. Kimura dachte an Wataru. Sein Herz krampfte sich zusammen. Vor seinen Augen erschien das Bild seines kleinen Sohnes, der im Krankenhaus noch immer im Koma lag. ›Selbst jetzt sieht der Ärmste noch so verständig aus‹, hatte seine Mutter geschluchzt. Jedes Wort hatte sich wie ein Pfeil in seine Eingeweide gebohrt.
Das wird er büßen! Kaum zu glauben, dass jemand, der ein sechsjähriges Kind vom Dach eines Kaufhauses schubst, frei herumlaufen darf. Wut schnürte ihm die Kehle zu, nicht Trauer. Kimura marschierte zur Rolltreppe. Er hatte aufgehört zu trinken. Geradeaus zu gehen war kein Problem. Seine Hände zitterten nicht. Die Papiertüte mit dem Aufdruck TOKYO SOUVENIR in der Hand lief er weiter.
Der Zug war abfahrbereit. Kimura legte einen Schritt zu. An der vorderen Tür von Wagen 3 stieg er ein. Den Informationen eines alten Kollegen zufolge saß die Person, die er suchte, in Wagen 7, Reihe 5. Kimura wollte sich von hier aus anpirschen.
Er betrat den Vorraum. Linker Hand entdeckte er eine Waschnische. Er zog den Vorhang hinter sich zu und besah sich im Spiegel. Sein Haar war lang geworden, in seinen Augenwinkeln klebte Schlaf. Rasiert hatte er sich ewig nicht mehr. Der Anblick seines erschöpften Gesichts tat selbst ihm in den Augen weh. Er wusch sich die Hände. Schrubbte, bis das Wasser aus dem Hahn versiegte. Seine Hände zitterten. Das ist die Aufregung, sagte er sich, nicht der Alkohol.
Seit Watarus Geburt hatte er keine Pistole mehr angefasst. Allenfalls beim Umzug oder beim Putzen. Gut, dass ich sie nicht weggeworfen habe, dachte er. Um dem Burschen eine Lektion zu erteilen, war eine Pistole genau das Richtige.
Sein Spiegelbild verzerrte sich. Das Glas sprang. ›Vorbei ist vorbei. Kannst du mit einer Pistole überhaupt noch umgehen?‹, tönte es ihm aus den Splittern entgegen. ›Du bist ein Säufer. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht mal deinen Sohn konntest du beschützen.‹ ›Ich trinke nicht mehr.‹ ›Dein Sohn liegt im Krankenhaus.‹ ›Der Kerl wird dafür büßen.‹ ›Das darfst du nicht zulassen!‹ explodierten die Gedanken in seinem Kopf.
Er zog die Pistole aus dem schwarzen Blouson und schraubte den Zylinder aus der Papiertüte an. Der Schalldämpfer würde den Knall nicht ganz verschlucken, ihn aber immerhin so dämpfen, dass seine 22-Millimeter harmloser klingen würde als eine Spielzeugpistole.
Kimura nickte seinem Spiegelbild zu, ließ die Waffe in der Tüte verschwinden und trat aus der Waschnische.
Fast wäre er dabei mit der Frau vom Bordservice zusammengestoßen, die gerade ihren Trolley bestückte. Du stehst im Weg, hätte er am liebsten gepoltert, räumte aber, als ihm die Bierdosen ins Auge fielen, sofort das Feld.
›Ein Schluck, und du bist wieder da, wo du warst. Merk dir das‹, schossen ihm die Worte seines Vaters durch den Kopf. ›Einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Ein Schluck, und du hängst wieder an der Flasche.‹
Als Kimura Wagen 4 betrat, schlug der Mann in der ersten Sitzreihe links die Beine übereinander. Kimura blieb mit seiner Tüte hängen. Vorsichtig zog er sie wieder an sich.
Er war so nervös, dass er am liebsten zugeschlagen hätte. Der Mann an der Tür trug eine schwarze Brille und sah angenehm aus. »Verzeihung«, sagte er und deutete eine Verbeugung an. Kimura schnalzte mit der Zunge. Er wollte gerade weitergehen, als der Mann sagte: »Vorsicht, Ihre Tüte ist gerissen.« Kimura blieb stehen. Die Tüte mit der Waffe hatte tatsächlich einen Riss, aber das musste ihm jetzt egal sein. »Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß«, sagte er und setzte sich wieder in Bewegung.
Er hastete durch Wagen 4, dann weiter durch die Wagen 5 und 6.
»Papa. Warum ist Wagen 1 der letzte?«, hatte Wataru gefragt. Bevor er ins Koma gefallen war, natürlich.
»Weil er von Tokio aus gesehen der erste ist«, hatte Kimuras Mutter die Frage beantwortet.
»Was heißt das, Papa?«
»Die Wagen werden von Tokio aus durchnummeriert. Wenn wir zu Oma und Opa fahren, ist Wagen 1 ganz hinten, und wenn wir zurück nach Hause fahren, ganz vorne.«
»Man fährt doch auch nach Tokio ›hoch‹«, hatte Kimuras Vater gesagt. »Alles ist auf Tokio ausgerichtet.«
»Wenn ihr zu uns kommt, kommt ihr also hoch?«
»Genau. Um dich zu sehen, schnaufen Oma und Opa den Hügel hinauf.«
»Der Shinkansen schnauft.«
»So ein niedlicher Kerl. Kaum zu glauben, dass er von dir ist«, hatte Kimura Senior gesagt und seinem Sohn einen vielsagenden Blick zugeworfen.
»Der Spruch kommt mir bekannt vor.«
»Das meint man in der Genetik wohl mit dem Überspringen einer Generation«, hatten seine Eltern weitergeplaudert, ohne sich an seiner Ironie zu stören.
Wagen 7. Linker Hand Zweierreihen, rechter Hand Dreierreihen, alle Sitze in Fahrtrichtung. Kimura umfasste die Pistole in der Tüte, zählte die Reihen ab und tat ein, zwei große Schritte nach vorn.
Der Wagen war leerer als gedacht. Fast alle Sitzplätze waren frei. Rechts am Fenster in Reihe 5 saß in aufrechter Haltung ein Jugendlicher in weißem Hemd und Blazer, der gebannt die einfahrenden Züge beobachtete. Man hätte ihn für einen Musterschüler halten können.
Kimura näherte sich vorsichtig. Kann dieses unschuldig aussehende Kind wirklich dermaßen böse sein, fragte er sich. Von hinten sieht er aus wie ein kleiner Junge, der zum ersten Mal allein verreisen darf. In diesem einen Moment war Kimura nicht auf der Hut.
Vor seinen Augen explodierte ein Feuerwerk.
Zuerst dachte er, die Beleuchtung im Shinkansen sei defekt, aber das war es nicht. Nicht die Sicherungen im Shinkansen, sondern die in seinem Hirn waren durchgebrannt. Er sah nur noch schwarz. Der Junge am Fenster hatte sich blitzschnell zu Kimura gedreht und ihm etwas an den Oberschenkel gedrückt, eine Art großformatige Fernbedienung. Als Kimura merkte, dass es der selbst gebastelte Elektroschocker des Schülers war, war es schon zu spät: Die Haare standen ihm zu Berge, und er konnte sich nicht mehr rühren.
Als er wieder zu sich kam, saß er am Fenster, die Hände und Füße mit Klettband gefesselt.
»Du bist wirklich dumm. Dass du so berechenbar bist, hätte ich allerdings nicht gedacht. Selbst Computerprogramme verhalten sich erratischer. Ich wusste, dass du kommst. Und in welcher Branche du mal warst, weiß ich natürlich auch«, sagte der Junge neben ihm leichthin. Sein Gesicht mit den Mandelaugen und der wohlgeformten Nase hatte etwas Feminines. »Siehst du. Alles wie geplant. Wer hätte gedacht, dass das Leben so leicht ist«, sagte der Junge, der Kimuras Sohn zum Spaß vom Kaufhausdach gestoßen hatte, mit der Selbstsicherheit eines Menschen, der, obwohl er noch zur Schule geht, schon alles gesehen und erlebt hat. »Dabei hast du dir so viel Mühe gegeben. Sogar auf deinen geliebten Alkohol verzichtet.«
»Was macht die Verletzung?«, fragte Tangerine. Er saß mit Lemon in Wagen 3, Reihe 10, er am Gang, Lemon am Fenster.
»Warum die 500er wohl nicht mehr fahren. Die blauen Wagen waren so schön«, murmelte Lemon, den Blick nach draußen gerichtet. »Welche Verletzung?«, meinte er dann, als hätte ihn die Frage erst jetzt erreicht, und runzelte die Stirn. Seine Haare standen in alle Richtungen ab. Entweder hatte er komisch gelegen oder sie extra so frisiert. Dem springt mit seinem Schlafzimmerblick und dem missmutig verzogenen Gesicht sein Mir-ist-alles-zu-viel förmlich aus dem Gesicht, dachte Tangerine. Prägt der Charakter das Aussehen?, fragte er sich. Oder das Aussehen den Charakter?
»Die Verletzung in deinem Gesicht natürlich, welche sonst? Die Schnittwunde, die du gestern kassiert hast«, sagte Tangerine.
»Ich? Wobei?«
»Bei der Befreiung von Papas Liebling hier.«
Tangerine wies auf den fünfundzwanzigjährigen, langhaarigen Mann, der zusammengesunken zwischen ihnen saß. Der junge Mann sah von ihm zu Lemon. Dafür, dass er gestern gefesselt und gefoltert vor Angst mit den Zähnen geklappert hat, hat er sich erstaunlich schnell erholt. Innen hohl, dachte Tangerine. Nicht selten bei Leuten, die nie in ihrem Leben ein Buch in der Hand gehabt haben. Die schalten sofort um. Vergessen alles. Empathie kennen sie nicht. Gerade die müssten eigentlich viel mehr lesen, aber wer in dem Alter noch nicht damit angefangen hat, fängt wahrscheinlich nie an. Er sah auf die Uhr. Neun Uhr. Die Befreiung dieses Muttersöhnchens, des einzigen Sohnes von Yoshio Minegishi, war schon neun Stunden her. Minegishi Junior war in einem Keller in Fujisawa-kongocho festgehalten worden. Dort hatten Lemon und er ihn herausgeholt.
»Glaubst du, ich bin so blöd, mir eine Stichwunde verpassen zu lassen?«, sagte Lemon. Mit knapp eins achtzig war er genau so groß wie Tangerine und ebenso schlank, sodass man sie fälschlicherweise oft für Brüder hielt, manchmal sogar für Zwillinge. Bisweilen war von den ›Killerzwillingen‹ die Rede oder den ›Brüdern Tod‹, was Tangerine jedes Mal auf die Palme brachte. Wie konnte man ihn mit so einem impulsiven und leichtsinnigen Typen in einen Topf werfen! Lemon störte das natürlich nicht. Der nahm es mit nichts genau. Tangerine hasste das. ›Mit Tangerine kommt man klar‹, hatte ein Kontaktmann mal gesagt, ›aber Lemon ist eine Zumutung. Ist wie mit dem Obst. Zitronen kann man auch nicht essen, die sind einfach zu sauer.‹ Genau so war es.
»Gut. Und woher kommt dann der rote Strich in deinem Gesicht? Alter! Als der mit dem Messer auf dich losging, hast du geschrien.«
»Ich? Wegen so was? Wenn ich geschrien habe, dann höchstens vor Überraschung. Dass so ein Würstchen es wagt, ein Messer zu zücken. Außerdem stammt der Kratzer nicht von einem Messer. Das ist Ausschlag. Ich bin allergisch.«
»Seit wann sieht Ausschlag wie ’ne Stichwunde aus?«
»Bist du der Schöpfer der Allergien?«
»Häh?«
»Hast du die Allergien in die Welt gebracht? Nein. Bist du Gesundheitsexperte? Willst du mir achtundzwanzig Jahre Allergieerfahrung absprechen? Seit wann kennst du dich mit Allergien aus?«
»Ich will dir gar nichts absprechen. Ich habe die Allergien auch nicht in die Welt gebracht. Nur: Das ist kein Ausschlag.«
Es war immer dasselbe. Lemon wies alles von sich und redete weiter, ob man darauf einging oder nicht.
»Ähm, Entschuldigung«, meldete sich Papas Liebling furchtsam zu Wort. »Ich … äh …«
»Was?«, fragte Tangerine.
»Was?«, fragte Lemon.
»Ähm, wie … wie hießen Sie noch mal?«
Als Tangerine und Lemon gestern den Keller gestürmt hatten, hatte Minegishi Junior gefesselt auf einem Stuhl gesessen. Bewusstlos. Da er auch später, nachdem sie ihn zu sich gebracht und befreit hatten, nicht mehr als ›Ich bitte um Verzeihung. Ich bitte um Verzeihung‹ gestammelt hatte, war eine vernünftige Unterhaltung nicht möglich gewesen.
»Ich bin Dolce, das ist Gabbana«, sagte Tangerine.
»Nein. Ich bin Donald, und das ist Douglas«, schüttelte Lemon den Kopf.
»Donald und Douglas?«, fragte Tangerine, obwohl er ahnte, dass es sich dabei um Freunde von Thomas, der kleinen Lokomotive, handeln musste. Lemon liebte diese alte Serie aus dem Kinderfernsehen. Fast alle seine Vergleiche stammten aus den Abenteuern von Thomas und seinen Freunden. Lemon hing an den Figuren, als hätte er alles von ihnen gelernt.
»Ich hab sie dir doch gezeigt. Donald und Douglas sind die schwarzen Zwillingslokomotiven. Sie drücken sich immer vornehm aus. ›Hoppla, ist das nicht unser guter alter Freund Henry?‹, sagen sie zum Beispiel. Das macht sie so sympathisch. Geht einem da nicht das Herz auf?«
»Nein.«
Lemon fuhrwerkte in seiner Jacketttasche herum und förderte eine notizblockgroße Glanzkarte zutage. »Guck, das ist Donald«, sagte er. Auf der Karte klebten Bilder von Lokomotiven. Eine schwarze war auch dabei.
»Ich hab dir die Namen schon so oft gesagt, und du hast sie dir immer noch nicht gemerkt. Du willst sie dir wohl nicht merken?«
»Was du nicht sagst.«
»Mann! Also, noch mal. Hier, das sind sie, von Thomas bis Oliver. Diesel ist auch dabei. Siehst du? Jetzt merk sie dir!«, sagte Lemon und fing an, die Loks aufzuzählen.
»Schon gut, schon gut«, sagte Tangerine und schob die Karte zurück.
»Äh, wie heißen Sie denn nun?«, fragte Papas Liebling.
»Hemingway and Faulkner«, sagte Tangerine.
»Bill und Ben sind auch Zwillinge. Harry und Bert auch.«
»Wir aber nicht!«
»Hat mein Vater Sie und, ähm, Mister Donald gebeten, mich zu retten?«, fragte Minegishi Junior ernst.
»Gebeten ist gut«, erwiderte Lemon und bohrte gelangweilt in seinem Ohr. »Dein Vater kann sehr bestimmend sein. Und einem Angst machen.«
»Richtig Angst«, pflichtete Tangerine ihm bei.
»Wie ist er denn zu dir? Verwöhnt er dich oder hast du auch Angst vor ihm?«
Minegishi Junior zuckte zusammen, obwohl Lemon ihn nur angetippt hatte.
»Ich … Nein, ich habe keine Angst vor meinem Vater.«
Tangerine lächelte säuerlich. An den eigentümlichen Geruch der Sitze hatte er sich allmählich gewöhnt.
»Kennst du die Geschichten deines Vaters aus seiner Zeit in Tokio? Da gibt’s ’ne ganze Menge. Schöne und weniger schöne. Zum Beispiel die von der Frau, der er den Arm abgehackt hat, weil sie fünf Minuten zu spät kam, um ihre Schulden zu bezahlen. Er hat ihr nicht einen Finger abgeschnitten, nein, er hat ihr gleich den Arm abgehackt. Wegen fünf Minuten, nicht fünf Stunden. Und diesen Arm …« Er hielt inne. Das war vielleicht doch nicht die Art von Geschichte, die man im Zug zum Besten gab.
»Ich weiß«, sagte Minegishi Junior entschuldigend. »Der ist in der Mikrowelle gelandet«, fuhr er fort, als ginge es um ein Kochexperiment seines Vaters.
»Und was ist mit der?« Lemon beugte sich vor und ließ seinen Zeigefinger vorschnellen. »Die Geschichte von dem Mann, dessen Sohn entführt wird, weil er seine Schulden nicht bezahlt, und der sich mit seiner Frau eine Messerstecherei liefern muss?«
»Die kenne ich auch.«
»Die kennst du auch?«, fragte Tangerine entgeistert.
»Dein Vater ist schlau. Macht’s sich einfach. Wenn ihn einer stört, sagt er: ›Umbringen.‹ Wenn ihm was zu viel ist, sagt er: ›Aufhören.‹ Basta«, sagte Lemon. Sein Blick folgte dem Shinkansen auf dem Nebengleis, der sich gerade in Bewegung setzte. »Vor zehn Jahren gab’s in Tokio einen Mann namens Terahara. Der war gut im Geschäft.«
»Ich weiß. Seine Firma hieß ›Frollein‹, stimmt’s?«, sagte Minegishi Junior zusehends lebhafter, was Tangerine überhaupt nicht gefiel. In einem Roman war Übermut ganz unterhaltsam, sonst nicht.
»Vor sechs, sieben Jahren ging ›Frollein‹ bankrott. Terahara und sein Sohn kamen um, die Firma löste sich auf. Dein Vater hat sich vorsichtshalber direkt nach Morioka abgesetzt. Sehr clever«, sagte Lemon.
»Vielen Dank!«
»Wofür? Das war kein Kompliment«, sagte Lemon. Wehmütig blickte er dem weißen Shinkansen nach.
»Ich meine, danke, dass Sie mich gerettet haben. Ich hatte schon gedacht, das war’s. So, wie die mich verschnürt hatten. Das waren doch bestimmt dreißig Leute, oder? Noch dazu in einem Keller. Ich dachte, selbst wenn mein Vater das Lösegeld zahlt, bringen die mich um. Sie schienen ziemliche Wut auf ihn zu haben. Ich dachte wirklich, das war’s jetzt, die machen mich platt«, plapperte Minegishi Junior weiter.
Ich hab’s ja gewusst, verzog Tangerine das Gesicht. »Sehr scharfsinnig«, sagte er. »Erstens: Dein Vater ist ziemlich unbeliebt. Es gibt wahrscheinlich mehr Unsterbliche als Leute, die deinen Vater mögen. Zweitens: Du hast recht. Sobald die Typen das Lösegeld gehabt hätten, hätten sie dich plattgemacht. Du warst tatsächlich kurz davor, das Zeitliche zu segnen.«
Tangerine und Lemon waren von Minegishi Senior beauftragt worden, das Lösegeld zu übergeben und seinen Sohn zu befreien, was sich einfacher anhörte, als es war.
»Dein Vater ist penibel«, seufzte Lemon. »Sohn retten. Lösegeld wieder mitnehmen. Täter umlegen«, zählte er an den Fingern auf. »Als wäre das ein Kinderspiel.«
Die Reihenfolge hatte Minegishi bestimmt. Erst den Sohn. Dann das Lösegeld. Dann die Täter.
»Aber Sie haben es geschafft, Mister Donald. Krass!«, sagte Minegishi Junior. Seine Augen leuchteten.
»Wo ist der Koffer eigentlich?«, fragte Tangerine plötzlich. Der Koffer, ein stabiles Exemplar mit Rollen, für eine Auslandsreise vielleicht zu klein, aber keinesfalls klein, sollte bei Lemon sein. Auf der Gepäckablage oder neben dem Sitz stand er nicht.
»Auf die Frage habe ich gewartet!« Lemon stellte die Füße auf die Fußstütze und machte es sich bequem. »Den habe ich hier«, sagte er fröhlich und klopfte auf seine Jacketttasche.
»Da? Da passt kein Koffer rein.«
Lemon lachte. »Reingefallen. Hier ist nur ein Zettel«, sagte er, zog ein visitenkartenkleines Stück Papier hervor und wedelte damit herum.
»Was ist das?« Minegishi Junior beugte sich vor.
»Ein Los aus dem Supermarkt, in dem wir eben waren. Einmal im Monat gibt’s da ’ne Tombola. Guck, was man gewinnen kann. Erster Preis: ein Reisegutschein. Den kann man einlösen, wann man will. Die waren zu blöd, ein Ablaufdatum anzugeben.«
»Ist der für mich?«
»Nee. Du brauchst keinen Gutschein. Du hast Papa. Der kann dir ’ne Reise spendieren.«
»Vergiss das Los, Lemon. Wo ist der Koffer?«, fragte Tangerine spitz. Ihm schwante Böses.
Lemon reckte stolz das Kinn. »Du kennst dich mit Eisenbahnen ja nicht so aus. Ich erklär’s dir, pass auf. In allen Schnellzügen gibt es am Ende jedes Wagens inzwischen eine sogenannte Großgepäckablage. Für Reisekoffer, Skier und anderes Gepäck.«
Tangerine blieb die Spucke weg. Um nicht die Beherrschung zu verlieren, rammte er Minegishi Junior den Ellbogen in den Arm. Minegishi Junior stöhnte auf. »Was soll das?«, keuchte er. Tangerine ignorierte den Protest. »Lemon«, sagte er mit unterdrückter Stimme. »Haben Mama und Papa dir nicht beigebracht, dass man wichtiges Gepäck immer im Auge behält?«
»Wie redest du mit mir?«, brauste Lemon auf. »Siehst du hier Platz für’n Koffer? Hier sitzen drei Männer. Wo soll da der Koffer hin?«, zeterte er. Auf Minegishi Junior regnete es Speichel. »Hier ist kein Platz für einen Koffer!«
»Du hättest ihn da oben auf die Gepäckablage legen können.«
»Hätte ich nicht. Er war viel zu schwer. Was du natürlich nicht weißt, du hast ihn ja nicht getragen.«
»Ich habe ihn sehr wohl getragen. Er war nicht so schwer.«
»Wenn zwei dubiose Typen wie wir einen Koffer dabeihätten, würde jeder denken, dass da was Wertvolles drin ist. Wir würden sofort auffliegen. Viel zu gefährlich.«
»Wir würden nicht auffliegen.«
»Würden wir doch! Außerdem weißt du ganz genau, dass meine Eltern bei einem Unfall gestorben sind, als ich noch klein war. Die haben mir gar nichts beigebracht. Außer, dass man seinen Koffer nicht direkt neben seinen Platz stellt.«
»Red keinen Quatsch.«
Tangerines Handy vibrierte. Er zog es aus der Hosentasche, warf einen Blick aufs Display und schnitt eine Grimasse. »Dein Papa«, sagte er zu Minegishi Junior, und stand auf, um in den Vorraum zu gehen. Kaum hatte er sich in Bewegung gesetzt, fuhr der Zug los.
Die Abteiltür öffnete automatisch. Im Vorraum drückte Tangerine ›Annehmen‹ und hielt sich das Handy ans Ohr. »Und?«, fragte Yoshio Minegishi ruhig, aber bestimmt. Tangerine stellte sich ans Fenster, betrachtete die vorbeiziehende Landschaft und erwiderte: »Der Zug ist gerade abgefahren.«
»Meinem Sohn geht es gut?«
»Säßen wir sonst im Zug?«
Minegishi fragte, ob sie das Lösegeld wieder mitgenommen hätten und was mit den Entführern passiert sei. Wegen des lauter werdenden Ratterns des Zuges war nur die Hälfte zu verstehen. Tangerine erstattete Bericht.
»Wenn ihr meinen Sohn unversehrt abgeliefert habt, ist euer Job erledigt.«
Du sitzt in deinem Ferienhaus und lässt es dir gutgehen. Machst du dir wirklich Sorgen um deinen Sohn?, hätte Tangerine am liebsten gesagt.
Das Gespräch brach ab. Kaum hatte Tangerine einen Fuß zurück ins Abteil gesetzt, tauchte Lemon vor ihm auf. Tangerine zuckte zusammen. Es war, als hätte er in den Spiegel geschaut. Als stünde er einer schlechten Kopie seiner selbst gegenüber. Einem Mann, der alles nur halb so genau nahm und nur halb so gute Manieren hatte.
»Es gibt ein Problem«, sagte Lemon mit dem ihm eigenen Mangel an Gelassenheit.
»Ein Problem? Was für ein Problem? Ich will mit deinen Problemen nichts zu tun haben. Die gehen mich nichts an.«
»Dieses schon.«
»Wieso? Was ist los?«
»Du hast doch gesagt, dass ich den Koffer in die Ablage über unserem Sitz legen soll.«
»Ja und?«
»Deswegen bin ich zur Gepäckablage. Der am Ende des Wagens.«
»Gut gemacht. Und?«
»Der Koffer ist weg.«
Tangerine folgte Lemon durchs Abteil. Die Ablage befand sich neben den Toiletten und der Waschnische. Im oberen der beiden Fächer stand ein großer Koffer. Allerdings nicht der mit Minegishis Lösegeld. Neben den Gepäckfächern gab es eine Nische; die Wagen hatten dort früher einen öffentlichen Fernsprecher installiert.
»Wo hast du ihn hingestellt? Hier?«, fragte Tangerine und zeigte auf das leere Fach unter dem großen Koffer.
»Ja.«
»Wo ist er jetzt?«
»Aufm Klo?«
»Der Koffer?«
»Ja.«
Tangerine bezweifelte, dass Lemon das ernst gemeint hatte, ging aber trotzdem ins Pissoir, um nachzusehen. Dann stieß er die Tür der Toilettenkabine auf und brüllte: »Wo bist du, Koffer? Zeig dich!«
Dass jemand den Koffer versehentlich mitgenommen haben könnte, war unwahrscheinlich. Tangerines Herzschlag beschleunigte sich. Beunruhigt stellte er fest, dass er beunruhigt war.
»Welches Wort mit vier Buchstaben beschreibt unsere Lage am besten?«, fragte Lemon mit verkniffenem Gesicht.
Im selben Moment erschien die Frau mit dem Trolley. Lemon trat zur Seite, damit sie nicht etwa aus Rücksicht stehen blieb und etwas von ihrem Gespräch mitbekam. Als sie vorbei war, sagte Tangerine: »Vier Buchstaben? … Fuck.«
»Shit!«
Tangerine schlug vor, fürs Erste zurück zum Platz zu gehen, um in Ruhe nachzudenken. »Hey! Hörst du mir nicht zu? Was für Wörter mit vier Buchstaben gibt’s noch?«, hörte er Lemon hinter sich in einem Ton, als hätte er den Ernst der Lage noch immer nicht begriffen. Tangerine stellte sich taub. Das Abteil war ziemlich leer. Tangerine wusste nicht, wie die Züge sonst ausgelastet waren, aber vierzig Prozent kamen ihm, selbst für diese Zeit an einem Werktag, recht wenig vor.
Da die Sitze gegen die Fahrtrichtung standen, hatte er einen guten Blick auf die Fahrgäste. Leute mit verschränkten Armen, Leute mit geschlossenen Augen, Leute, die Zeitung lasen, und Büroangestellte. Um sicherzugehen, dass nicht irgendwo ein schwarzer Koffer stand, schaute er hinter jeden Sitz und auf jede Ablage.
Auf mittlerer Höhe des Wagens saß Papas Liebling. Den Mund geöffnet, die Augen zu, ans Fenster gelehnt. Kein Wunder! Der Arme hat seit zwei Tagen nicht mehr geschlafen! Hätte man meinen können.
Tangerine meinte das nicht. Sein Herz setzte einen Schlag aus. Das hat gerade noch gefehlt, dachte er, riss sich aber sofort wieder zusammen. Setzte sich auf seinen Platz und legte Minegishi Junior zwei Finger an den Hals.
»Der hat vielleicht Nerven! Hier brennt die Hütte, und der pennt«, sagte Lemon und blieb stehen.
»Hier brennt mehr als die Hütte, Lemon«, sagte Tangerine.
»Wieso?«
»Papas Liebling ist tot.«
»Nicht dein Ernst!«, sagte Lemon und, nach einer kurzen Pause: »Holy Shit.«
Er sah auf seine Finger. »Acht Buchstaben«, murmelte er.
Was einmal passiert, passiert zweimal. Was zweimal passiert, passiert dreimal und weil, was dreimal passiert, auch ein viertes Mal passiert, kann man sagen, dass das, was einmal passiert, immer wieder passiert, oder nicht?, überlegte Nanao. Wie beim Domino. Vielleicht hätte er nach seinem ersten Job vor fünf Jahren, der sich als wesentlich schwieriger erwiesen hatte als gedacht, nicht denken sollen, dass das, was einmal passiert, auch zweimal passiert, doch weil sein zweiter Job ebenfalls wieder katastrophal verlaufen war, hatte er natürlich auch für den dritten das Schlimmste befürchtet.
»Du denkst zu viel«, hatte Maria gesagt, die Frau, die ihm die Aufträge vermittelte. »Ich sitze am Schalter.« Was für Nanao immer so klang wie Du kochst, ich esse, oder Ich gebe die Anweisungen, du führst sie aus.
»Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung mal einen Auftrag annehmen würdest«, hatte er gesagt.
»Tue ich doch.«
»Ich meine, praktisch. Wie soll ich sagen, im Feld.«
Pass auf, hatte er erklärt. Du hast zwei Fußballer, der eine begnadet, der andere eine Lusche. Wäre es dann nicht besser, den begnadeten auf den Platz zu stellen anstatt an den Spielfeldrand, wo er sich die Lunge aus dem Leib brüllt, um der Lusche Anweisungen zu erteilen, und sich hinterher nur ärgert, dass die Lusche so schlecht spielt? Wäre es, mit einem Wort, nicht besser, sie, Maria, übernähme den Job? Dann hätten alle weniger Stress, und das Ergebnis stimmte auch.
»Was redest du da? Ich bin eine Frau.«
»Das schon, aber mit deinem Kung Fu erledigst du locker drei Mann. Auf dich ist wahrscheinlich mehr Verlass als auf mich.«
»Darum geht es nicht. Als Frau kann ich mir eine Verletzung im Gesicht nicht leisten.«
»Ich bitte dich, diese Zeiten sind vorbei. Heutzutage wird Wert auf Gleichberechtigung gelegt.«
»Das ist sexuelle Belästigung.«
Nanao gab auf. An den gegebenen Strukturen – Maria gab die Anweisungen, er führte sie aus – war offenbar nicht zu rütteln.
Auch der zweite Job, hatte Maria behauptet, sei »ganz einfach, im Handumdrehen erledigt«, diesmal gebe es »definitiv« keine Probleme. Zu widersprechen lohnte sich nicht.
»Ich weiß nicht, irgendwas passiert bestimmt.«
»Du musst nach vorne schauen, nicht nach hinten. Du bist wie ein Einsiedlerkrebs. Wie jemand, der sich aus Angst vor Erdbeben zu Hause verkriecht.«
»Ich wusste gar nicht, dass Einsiedlerkrebse das machen.«
»Warum sonst schleppen die ihr Haus mit?«
»Um keine Vermögenssteuer zu zahlen«, erwiderte er in seiner Verzweiflung, aber darauf ging sie nicht ein.
»Die meisten unserer Aufträge sind heikel. Es besteht fast immer die Gefahr, dass es Probleme gibt. Probleme gehören praktisch zum Job.«
»Das meine ich nicht«, widersprach Nanao und noch einmal bestimmt: »Diese Art von Problemen meine ich nicht. Erinnerst du dich an den Job im Hotel? Den Politiker, den ich im Bett mit seiner Geliebten fotografieren sollte? ›Ganz einfach‹, hast du gesagt, ›im Handumdrehen erledigt.‹«
»Ja und? War doch einfach. Ein Foto, mehr nicht.«
»Ja, wenn da nicht zufällig jemand Amok gelaufen wäre …«
In der Lobby des Hotels hatte ein Mann im Anzug plötzlich angefangen, wild um sich zu schießen. Vielleicht hatte er sein tristes Leben nicht mehr ertragen. Hinterher stellte sich heraus, dass es ein sehr fähiger Staatsbediensteter gewesen war. Jedenfalls erschoss er mehrere Hotelgäste und verschanzte sich anschließend. Die Sache war reiner Zufall gewesen, mit Nanaos Job hatte sie nicht das Geringste zu tun gehabt.
»Na, hör mal, du warst großartig! Wie viele Leute hast du gerettet? Und dann hast du dem Verrückten auch noch die Kehle durchgeschnitten!«
»So ist es, ich hatte alle Hände voll zu tun! Und dann dieser Job im Fastfood-Restaurant! Ich müsste nur reingehen, in den neuen Burger beißen und sagen: ›Wow, ist der gut! Eine wahre Geschmacksexplosion.‹«
»Ja und? Hat er nicht geschmeckt?«
»Doch, aber dann ist der Laden tatsächlich explodiert.«
Der Anschlag ging auf das Konto eines Angestellten, dem man gekündigt hatte. Obwohl das Restaurant zum Zeitpunkt der Explosion nur spärlich besucht und niemand ums Leben gekommen war, hatte Nanao Mühe und Not gehabt, die wenigen Kunden durch den Qualm und die Flammen nach draußen zu bringen, nur um dort auf einen Auftragskiller zu stoßen, der es, das Gewehr im Anschlag, auf einen berüchtigten Mann abgesehen hatte, der sich im Restaurant versteckt hielt. Ein Heidenaufruhr!
»Und du hast, brav, wie du bist, den Killer gleich miterledigt. Großartig!«
»Der Job, hast du behauptet, wäre auch ›ganz einfach‹ und ›im Handumdrehen erledigt‹.«
»Ich bitte dich. Einen Burger zu essen ist doch nicht schwer.«
»Und der Job neulich? In dem Fastfood-Laden das Geld auf der Toilette deponieren, fertig, hast du gesagt. Und das Ende vom Lied? Nasse Socken und ein Burger voller Senf. Es gibt keine einfachen Jobs auf der Welt. Optimismus kann tödlich sein. Bis jetzt weiß ich außerdem immer noch nicht, was ich tun soll.«
»Ich hab’s dir doch gesagt. Den Koffer nehmen und aussteigen. Weiter nichts.«
»Weiß ich, wo der Koffer steht? Weiß ich, wem er gehört? Nein. ›Steig in den Zug, alles Weitere erfährst du unterwegs.‹ Dieser Job kann nicht einfach sein. Dann soll ich auch noch in Ueno aussteigen. Von Tokio nach Ueno ist es ein Katzensprung. Da muss ich mich beeilen.«
»Du musst das anders sehen. Für einen schwierigen Job braucht man weitere Informationen. Weil man planen, sich vorbereiten oder Vorkehrungen treffen muss für den Fall, dass etwas schiefläuft. Keine weiteren Informationen bedeutet also, dass der Job einfach ist. Stell dir vor, der Job bestünde darin, dreimal auszuatmen. Dafür brauchtest du auch keine weiteren Informationen.«
»Merkwürdige Logik. Ich bleibe dabei: Der Job kann nicht einfach sein. Einfache Jobs gibt es nicht.«
»Doch. Viele sogar.«
»Nenn mir einen.«
»Meinen. Aufträge zu vermitteln ist einfach.«
»Was du nicht sagst!«
Nanao hielt sich das Handy ans Ohr. Aus den Lautsprechern dröhnte eine Männerstimme über den Bahnsteig. »Auf Gleis 20 – fährt ein – der Shinkansen Hayate – Komachi nach Morioka.« Maria war kaum mehr zu verstehen.
»Hörst du mir zu? Hörst du mich überhaupt?«
»Der Zug fährt ein.«
Die Durchsage fegte über den Bahnsteig. Nanao kam es so vor, als hätte sich ein unsichtbares Netz über das Handy gelegt, als wäre der Empfang gestört. Der herbstliche Wind war angenehm, der Himmel, abgesehen von ein paar einsamen Wolken, strahlend blau.
»Sobald ich mehr weiß, melde ich mich. Direkt nach Abfahrt des Zuges wahrscheinlich.«
»Telefonisch oder per Mail?«
»Wahrscheinlich telefonisch. Vergiss jedenfalls nicht, ab und zu dein Handy zu checken. Das kriegst du hin, oder?«
Die schlanke Schnauze des Schnellzugs kam in Sicht. Lange weiße Wagen rollten heran, wurden langsamer und kamen schließlich zum Stehen. Türen öffneten sich, Fahrgäste stiegen aus. Binnen kürzester Zeit wimmelte es auf dem Bahnsteig nur so von Menschen. Sie überschwemmten den Raum wie Wasser, das es auf den letzten Flecken trockener Erde abgesehen hat. Die Warteschlangen zerflossen. Trauben von Menschen versanken im Aufgang. Die, die nicht mit abgeflossen waren, formierten sich automatisch neu. Nanao wunderte sich, dass das funktionierte, obwohl er Teil davon war.
Wider Erwarten gingen die Türen noch einmal zu. Offenbar wurden die Wagen vor der Abfahrt gereinigt. Er hätte das Gespräch mit Maria gar nicht so hastig beenden müssen.
»Warum fahren wir nicht 1. Klasse?«, hörte er eine Stimme nahebei und sah sich um. Eine grell geschminkte Frau und ein kleiner, bärtiger Mann mit Papiertragetasche standen da. Der Mann hatte ein Mondgesicht. Er sah aus wie der Pirat im Fass, die kleine Figur, die man aus ihrem Fass katapultieren kann. Die Frau trug ein leuchtend grünes ärmelloses Kleid. Ihre Oberarme waren muskulös. Der ultrakurze Rock gab so viel von ihren Oberschenkeln preis, dass Nanao sofort wieder wegsah. Peinlich berührt rückte er seine schwarze Brille zurecht.
»Das kannste nicht bezahlen«, sagte der kleine Mann, kratzte sich am Kopf und gab der Frau ihre Platzkarte. »Aber hier, schau mal, Wagen 2, Reihe 2. Wie dein Geburtstag. Zwei, zwei. 2. Februar.«
»Seit wann habe ich am 2. Februar Geburtstag? Ich habe extra mein grünes Kleid angezogen, weil ich dachte, dass wir 1. Klasse fahren, Green Car!«, kreischte die muskulöse Frau und versetzte dem Mann einen wuchtigen Stoß. Die Papiertragetasche fiel zu Boden und erbrach ihren Inhalt auf den Bahnsteig. Eine rote Jacke, ein schwarzes Kleid und mittendrin ein schwarzes haariges Etwas. Nanao zuckte zusammen. Ein Tier? Sofort bekam er eine Gänsehaut. Genervt hob der kleine Mann es auf. Eine Perücke. Nanao stellte fest, dass die Frau in dem ärmellosen Kleid keine Frau war, sondern ein geschminkter Mann. Vorstehender Adamsapfel, breite Schultern. Mit dem Bizeps kann man ja leben, dachte er, aber der Rock …
»Was gibt’s denn da zu gucken?«
Als Nanao merkte, dass der Anpfiff ihm galt, sah er sofort wieder nach vorne.
Der Bartpirat trat einen Schritt vor. »Willste die haben? Die Klamotten? Ich verkauf sie dir. Zehntausend. Komm schon. Lass jucken«, sagte er und hob die Kleidungsstücke auf.
Die wollte ich nicht mal geschenkt, hätte Nanao fast gesagt, hielt sich aber zurück, um nicht noch Öl ins Feuer zu gießen. Ich wusste es ja, dachte er, irgendwas musste ja passieren.
»Lass jucken, Brillenschlange«, quäkte der kleine Mann wie ein Schüler, der einen anderen erpresst. »Willst wohl intelligent aussehen.«
Nanao sah zu, dass er wegkam.
Denk an den Job.
Die Aufgabe war einfach. Koffer nehmen und am nächsten Bahnhof aussteigen. Jetzt würde nichts mehr passieren. Nach diesem Vorfall war sein Pechkonto ausgeglichen. Er hatte sozusagen im Voraus bezahlt.
»Die Wagen sind nun zum Einstieg bereit«, schallte es über den Bahnsteig. Trotz des geschäftsmäßigen Tons wurde es den des Wartens müden Fahrgästen leicht ums Herz, wenigstens Nanao, obwohl er gar nicht lange gewartet hatte. »Sesam, öffne dich«, murmelte er und – siehe da – die Türen gingen auf.
Er warf einen Blick auf seine Platzkarte. Wagen 4, Reihe 1, Platz D. »Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber im Hayate gibt es keine freie Platzwahl, man muss reservieren. Auch wenn man gleich wieder aussteigt«, hatte Maria gesagt. »Ich habe dir einen Platz am Gang reserviert.«
»Und was ist in dem Koffer?«
»Keine Ahnung. Nichts Besonderes bestimmt.«
»Bestimmt? Du weißt es also nicht?«
»Woher soll ich es wissen? Ich habe nicht gefragt. Will ich unseren Auftraggeber verprellen?«
»Und was mache ich, wenn in dem Koffer was Gefährliches ist?«
»Was Gefährliches? Zum Beispiel?«
»Eine Leiche, sehr viel Geld, illegale Substanzen, ein Haufen Insekten.«
»Oh ja. Ein Haufen Insekten wäre furchtbar. Allein der Gedanke lässt mich schaudern.«
»Alles andere wäre nicht weniger furchtbar. Der Koffer ist bestimmt nicht harmlos.«
»Ausschließen kann ich das nicht …«
»Gefährlich also«, sagte Nanao, halb verärgert.
»Selbst wenn. Du musst ihn ja nur transportieren. Das ist ungefährlich.«
»Dann geh du doch!«
»Du weißt doch, dass ich gefährliche Jobs nicht mag.«
Nanao nahm seinen Platz in der ersten Reihe von Wagen 4 ein. Mit einem schnellen Blick stellte er fest, dass die meisten Sitze im Abteil frei waren. Während er darauf wartete, dass der Zug abfuhr, warf er einen Blick auf sein Handy. Maria hatte sich noch nicht gemeldet. Bis Ueno war es ein Katzensprung. Viel Zeit, sich des Koffers zu bemächtigen, hatte er nicht. Hoffentlich geht nichts schief.
Zischend öffnete sich die Tür zu seinem Abteil. Nanao wollte gerade rücksichtsvoll die Beine zur anderen, zur Fensterseite hin übereinanderschlagen, als ihm eine Papiertüte ans Bein stieß. Der Tütenträger funkelte ihn an. Er war blass, hatte einen Dreitagebart, Ringe unter den Augen und machte einen eher ungesunden Eindruck. »Verzeihung«, entschuldigte sich Nanao sofort. Dabei war streng genommen nicht er für den Zusammenstoß verantwortlich, sondern der andere, der Mann mit der Tüte. Eigentlich müsste der sich entschuldigen. Aber Nanao wollte keinen Streit. Um einen Streit zu vermeiden, würde er sich sogar tausend Mal entschuldigen. Grantig setzte sich der Mann wieder in Bewegung.
»Vorsicht, Ihre Tüte ist gerissen.«
»Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß«, sagte der Mann und ging weiter.
Nanao löste seine lederne Hüfttasche vom Gürtel, um sich seiner Fahrkarte zu vergewissern. Die Tasche enthielt alles Mögliche: einen Notizblock mit Kugelschreiber, Draht, ein Feuerzeug, Tabletten, eine Uhr, einen Kompass, einen Magneten in Hufeisenform und extrastarkes Klebeband. Außerdem drei Armbanduhren mit Weckfunktion. Wecker konnte man immer gebrauchen. »Deine Kampfausrüstung«, lachte Maria immer, obwohl man den Kram in jeder Küche oder jedenfalls in jedem Convenience Store fand. Für Verbrennungen oder kleinere Wunden hatte Nanao zudem Steroidsalbe und blutstillende Creme dabei.
Ein vom Glück verlassener Mann musste sich eben so gut wie möglich rüsten.
Die Fahrkarte steckte in dem Fach an der Außenseite. Nanao erschrak. Tokio – Morioka? Wieso Morioka? Im selben Moment klingelte sein Handy. Er meldete sich sofort. »Ich weiß Bescheid«, hörte er Maria sagen. »Der Koffer steht auf der Gepäckablage zwischen Wagen 3 und 4. Er ist schwarz und hat einen Aufkleber am Griff. Der Kofferträger sitzt in Wagen 3. Steig mit dem Koffer also woanders aus, nicht in Wagen 3 oder 4.«
»Alles klar«, erwiderte er. »Sag mal«, fügte er hinzu, »warum habe ich eine Fahrkarte bis Morioka, wenn ich doch schon in Ueno aussteige?«
»Für den Fall, dass unterwegs was passiert. Du weißt doch. Sicher ist sicher.«
»Ha!«, entfuhr es Nanao eine Spur zu laut. »Du fürchtest also auch, dass etwas passiert!«
»Sei nicht so nervös. Das war allgemein gesprochen. Lächel lieber. Du weißt doch: Wer lächelt, dem winkt das Glück.«
»Dann falle ich erst recht auf«, erwiderte Nanao und legte auf. Der Zug war inzwischen abgefahren.
Nanao stand auf und trat in den Vorraum. Er hatte keine Zeit zu verlieren. Bis Ueno waren es nur fünf Minuten. Die Gepäckablage fand er zum Glück sofort, den schwarzen Koffer auch. Ein nicht besonders großes Exemplar mit Rollen. Hartschale, auch wenn er nicht wusste, aus welchem Material. Am Griff entdeckte er einen Aufkleber. Möglichst geräuschlos nahm er den Koffer von der Ablage. »Ganz einfach«, hörte er Marias verführerische Stimme im Ohr. Das stimmt. Bis hierhin war es einfach. Er sah auf die Uhr. Noch vier Minuten. Schnell ankommen, betete er, schnell ankommen. Er ging in Wagen 4 zurück und so nonchalant wie möglich weiter Richtung Wagen 5. Niemand nahm Notiz von ihm.
Im Vorraum von Wagen 6 atmete er auf. Allen Befürchtungen zum Trotz warteten am Ausstieg keine Hindernisse. Keine Jugendlichen, die vor der Tür saßen und schliefen oder sich schminkten oder ihm den Weg versperrten und ihn anmachten, kein sich zankendes Ehepaar im Gang, das ihn zwang, für sie oder ihn Partei zu ergreifen.
Der Ausstieg war frei. Er musste nur noch warten und aussteigen. Maria konnte er anrufen, sobald er die Sperre hinter sich gelassen hatte. Siehst du, hörte er sie schon feixen, was habe ich dir gesagt? Ganz einfach. Halt, dachte er, noch bin ich nicht da. Es ist definitiv besser, davon auszugehen, dass noch was dazwischenkommt.
Plötzlich wurde es dunkel. Der Wagen tauchte ab. Bis zu den unterirdischen Bahnsteigen des Bahnhofs konnte es nicht mehr weit sein. Nanao verstärkte den Griff um den Koffer und sah sinnloserweise noch einmal auf die Uhr.
Sein Gesicht spiegelte sich im Türfenster. Selbst er fand, dass man ihm das Pech förmlich ansah. Seine Ex-Freundinnen hatten vielleicht nicht ganz unrecht gehabt. »Seit ich mit dir zusammen bin, verliere ich dauernd mein Portemonnaie«, hatten sie gesagt. Oder: »Ich habe vorher nie so viele Fehler gemacht.« Oder: »Jetzt gehen meine Pickel gar nicht mehr weg.« Er hatte immer widersprochen, aber wer weiß, vielleicht war ja doch was dran.
Das Pfeifen des Zuges nahm ab. Der Ausstieg war in Fahrtrichtung links. Jenseits der Tür wurde es wieder hell. Wie aus dem Nichts tauchte der Bahnsteig auf. Fahrgäste zogen vorbei. Treppen, Bänke, Anzeigetafeln.
Nanao, den Blick starr auf die Tür gerichtet, hatte acht, dass sich von hinten niemand näherte. Auf Ärger mit dem Kofferträger konnte er verzichten. Der Zug rollte aus. Einmal in seinem Leben hatte Nanao im Kasino Roulette gespielt. Daran musste er jetzt denken. An das aufreizend langsame Falle-ich-oder-falle-ich-nicht der Kugel. Genau so rollte der Zug. Als könnte er sich nicht entscheiden, wo er zum Halt kommen soll. Schließlich blieb er stehen.
Am Ausstieg wartete ein kleiner Mann mit Schiebermütze. Er sah aus wie ein Privatdetektiv aus dem Krimi. Der Zug stand, aber die Türen blieben zu. Nanao fühlte sich, als müsste er wie unter Wasser den Atem anhalten.
Die missmutige Visage und das Detektivkostüm erinnerten Nanao an jemanden, der, wie er, auf Bestellung arbeitete, also Aufträge erledigte, über die nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde. Wegen der im Gegensatz zu seinem unspektakulären Namen spektakulären Geschichten, die er überall zum Besten gab, wenig glaubhaften Heldentaten und allerlei Hirngespinsten, wurde er von allen nur ›der Wolf‹ genannt. Nicht im Sinne von ›einsamer Wolf‹, sondern in Anspielung auf den von dem Hirtenjungen aus Äsops Fabel imaginierten Wolf. Der Wolf selbst hatte an seinem unrühmlichen Spitznamen nichts auszusetzen. Den hat Terahara mir gegeben, brüstete er sich immer. Dass ausgerechnet der Doyen der Branche ihm diesen Namen verpasst haben sollte, war schwer vorstellbar, aber der Wolf schwor Stein und Bein, dass es Terahara gewesen sei.
»Es gab doch mal einen Kerl, der Politiker und Ministerialbeamte dazu brachte, sich umzubringen. Den Selbstmordmörder«, hatte er zum Beispiel vor längerer Zeit einmal in einer Kneipe geprahlt, als Nanao ihm dort über den Weg lief. »Du weißt schon, diesen Schrank, den sie Wal oder Killerwal nennen. Hat man lang nicht mehr gesehen, stimmt’s? Kein Wunder. Um den hab ich mich nämlich gekümmert.«
»Gekümmert? Was soll das heißen?«
»Erledigt. Auf Bestellung erledigt. Ich ihn.«
Das plötzliche Verschwinden des Wals hatte in der Branche für Unruhe gesorgt. Es kursierten die wildesten Gerüchte. Die einen behaupteten, ein Kollege habe ihn kaltgemacht, die anderen, er sei in einen Unfall verwickelt worden. Was seine Leiche betraf, wurde es noch wilder. Ein Politiker, der schon immer einen Hass auf ihn gehabt habe, habe sie für viel Geld gekauft und zur Dekoration bei sich zu Hause aufgehängt. Unabhängig davon, was von alldem wahr war oder nicht – für jemanden wie den Wolf, den man allenfalls als Laufbursche oder zur Einschüchterung kleiner Mädchen anheuerte, war diese Nummer zu groß.
Nanao war dem Kerl immer so weit wie möglich aus dem Weg gegangen. Jedes Mal, wenn er ihn sah, war er nämlich versucht, ihm »die Fresse zu polieren«. Einmal hatte er sich tatsächlich nicht mehr beherrschen können.
An dem Abend hatte der Wolf in einer Hintergasse drei Grundschüler in der Mangel gehabt. »Was machst du da?«, hatte Nanao gefragt. »Ihnen Manieren beibringen. Die haben sich über mich lustig gemacht«, hatte der Wolf geantwortet und einem der angststarren Kinder die Faust ins Gesicht geschlagen. Wutentbrannt hatte Nanao ihn daraufhin mit einem Fußtritt an den Kopf zu Boden gestreckt.
»Ein Herz für Kinder«, hatte Maria ihn anschließend aufgezogen.
»Nein«, hatte er erwidert. Vor seinen Augen war das Bild eines Jungen erschienen, der um Hilfe schrie. »Kinder in Not machen mich schwach.«
»Ach ja, die Wunde in deinem Herzen, ich vergaß.«
»So wie du das sagst, klingt es kalt.«
»Trauma ist out«, hatte Maria verächtlich gesagt.
»In oder out spielt keine Rolle«, hatte Nanao erklärt. Kein Mensch streift seine Vergangenheit einfach so ab.
»Kinder, Tiere und Schwächere zu quälen ist jedenfalls das Letzte. Außerdem bringt der Kerl immer Terahara ins Spiel. ›Terahara protegiert mich‹ oder ›Das sage ich Terahara‹.«
»Dabei ist der längst tot.«
»Der Wolf soll Rotz und Wasser geheult haben. Aber wie dem auch sei. Dank dir weiß er jetzt wenigstens, was sich gehört.«
Der Tritt musste den Wolf empfindlich getroffen haben. »Das wirst du büßen«, hatte er gedroht und war verschwunden. Seitdem hatte Nanao ihn nicht mehr gesehen.
Die Tür des Shinkansen öffnete sich. Nanao wollte gerade aussteigen, als der Mann mit der Schiebermütze in sein Blickfeld geriet. Der sieht wirklich aus wie der Wolf, dachte er noch, das muss ein Doppelgänger sein, da zeigte der Mann schon mit dem Finger auf ihn und versperrte ihm den Weg. Sie standen Brust an Brust. Nanao wich zurück.
»Welch glücklicher Zufall!«, sagte der Wolf erfreut. Seine Nasenflügel bebten.
»Warte. Ich muss hier aussteigen«, wisperte Nanao, um möglichst kein Aufsehen zu erregen.
»Glaubst du wirklich, so eine Gelegenheit lasse ich mir entgehen? Ich schulde dir noch was.«
»Später. Ich bin bei der Arbeit. Oder nein, warte, vergiss die Schulden. Ich erlasse sie dir.«
Prima, dachte er, ganz prima. Im selben Moment ging die Tür zu. Gleichgültig setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Ganz einfach, lachte Maria in seinem Ohr. Mann!, wollte er schreien. Er hatte es ja gewusst.
Er klappte das in die Rückseite des Vordersitzes eingelassene Tablett herunter und stellte eine Plastikflasche darauf. Riss eine Tafel Schokolade auf und steckte sich ein Stück in den Mund. Hinter Ueno fuhr der Zug wieder oberirdisch. Trotz ein paar Wolken war der Himmel strahlend blau. So fühle ich mich, dachte er, strahlend. Eine Driving Range kam in Sicht. Das wie ein überdimensionales Moskitonetz aussehende grüne Netz bauschte sich. Kurz darauf sah er eine Schule. Hinter den Fenstern der Betonwürfel tummelten sich uniformierte Schüler. Mittelstufe? Oberstufe?, überlegte Satoshi Oji für einen Moment. Wie auch immer. Es machte keinen Unterschied. Alle waren sie gleich, egal, ob es Mittelstufenschüler waren, so wie er, Oberstufenschüler oder Erwachsene. Jeder war berechenbar. Der Mann neben ihm war das beste Beispiel dafür. Wie langweilig!
Weil Kimura sich trotz der Fesseln zu wehren versuchte, drückte Oji ihm die entwendete Pistole in die Seite: »Bleib ruhig und hör zu. Alles andere würdest du bereuen.« Dann sagte er: »Kam dir das nicht komisch vor? Ein Mittelstufenschüler, ganz allein im Zug? Und du weißt auch noch, wo er sitzt! Nie daran gedacht, dass es sich um eine Falle handeln könnte?«
»Du hast die Information lanciert?«
»Nachdem ich erfahren hatte, dass du mich suchst …«
»Ich dachte, du hältst dich versteckt. In der Schule warst du nicht.«
»Ich verstecke mich nicht. Wir haben keinen Unterricht.« Das war nicht gelogen. Wegen eines Infekts, der sich noch vor dem Winter plötzlich ausgebreitet hatte, war die ganze Klasse erst eine und dann, weil die Lage sich nicht entspannte, eine weitere Woche beurlaubt worden. Dass man wegen ein paar fehlender Schüler gleich den Unterricht für die ganze Klasse aussetzte, ohne Infektionsgeschehen, die Inkubationszeit oder die Zahl schwerer Verläufe zu berücksichtigen, konnte Oji nicht verstehen. Bevor man ein Risiko einging, für das man anschließend die Verantwortung übernehmen musste, folgte man lieber dem Protokoll. Grundsätzlich war dagegen natürlich nichts einzuwenden, aber nicht einmal darüber nachzudenken, ob es wirklich nötig war, den Unterricht komplett ausfallen zu lassen, ließ ihn am Verstand der Lehrer zweifeln. Ihre Fähigkeit, zu prüfen, zu analysieren und zu beurteilen war gleich null.
»Weißt du, was ich in der Zeit gemacht habe?«, fragte Oji.
»Woher sollte ich?«
»Erkundigungen über dich eingezogen. Du bist böse auf mich, stimmt’s?«
»Nee.«
»Nicht?«
»Böse ist kein Ausdruck.« Kimuras Worte troffen vor Hass. Ojis Miene wurde weich. Menschen, die ihre Gefühle nicht kontrollieren konnten, waren leicht zu manipulieren.