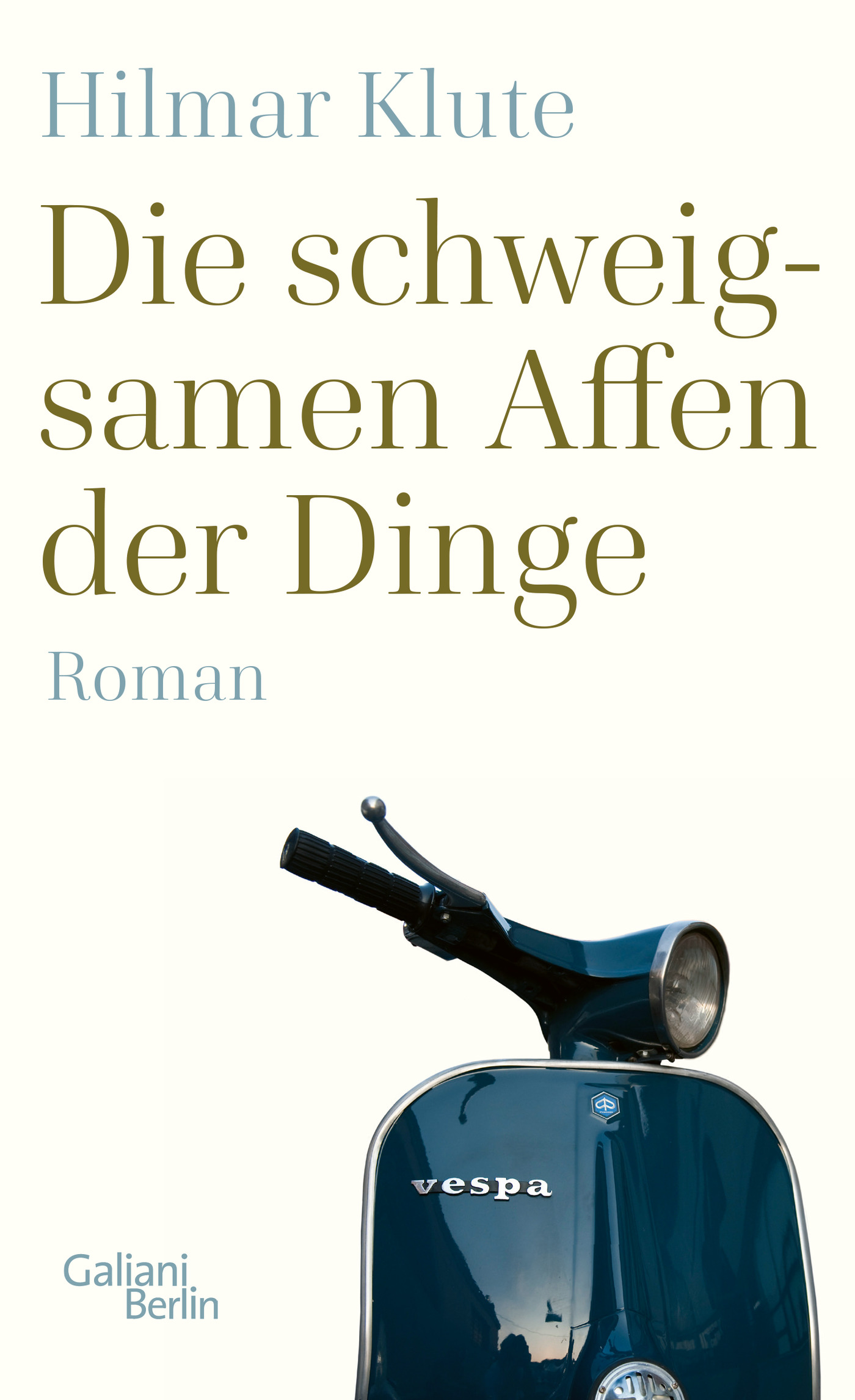
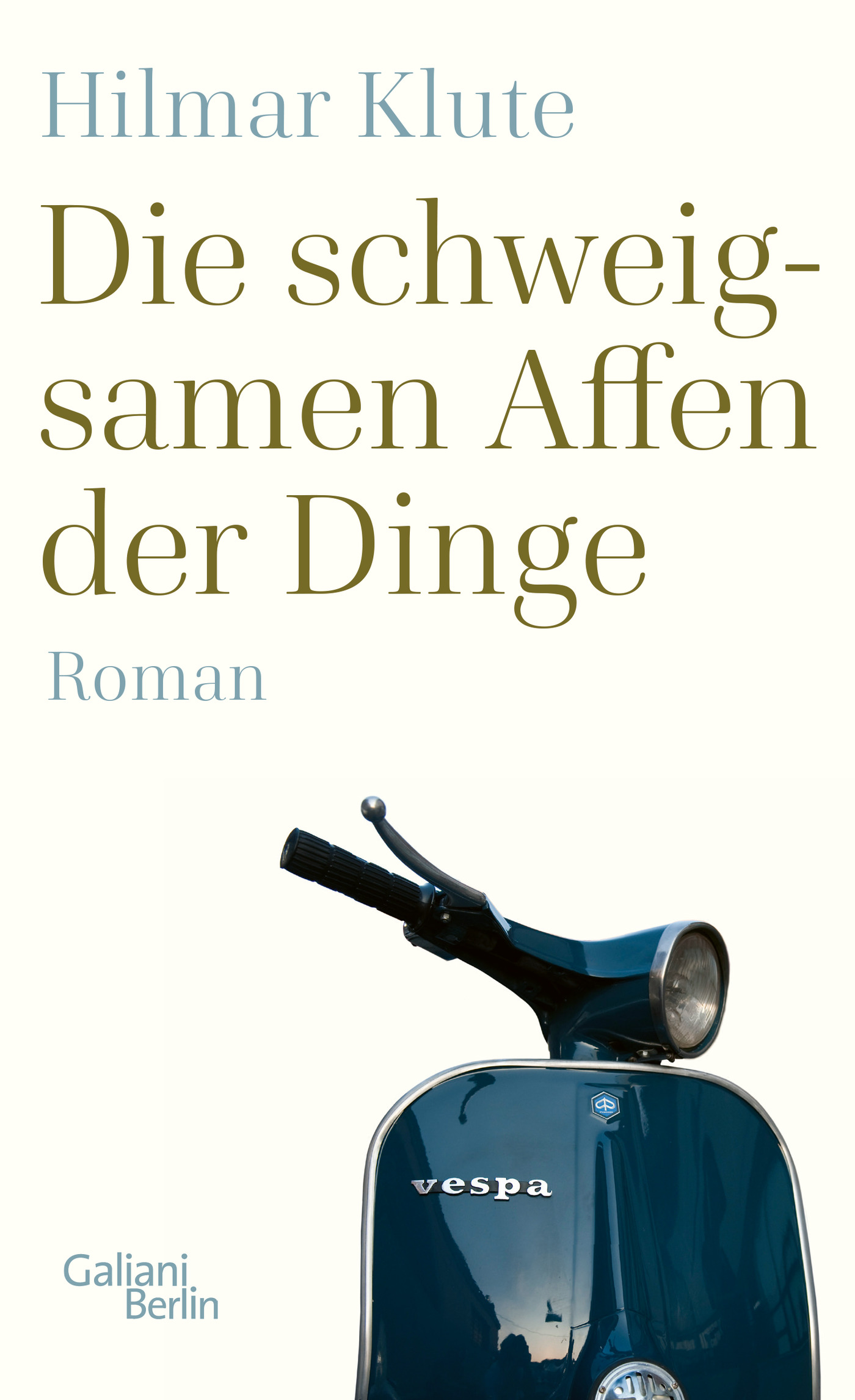
Für Edda, Golda und Joseph
Wo findet man das Allerfremdeste? Bisweilen in Menschen, mit denen man längere Zeit Umgang gehabt hat.
Oskar Loerke, Tagebücher, Freitag, 26. August 1904
September, das ist die beste Reisezeit für Rom, sagten die Kenner. Henning war seit Jahren von Kennern umgeben, die ihm für jedes Land eine fabelhafte Empfehlung mitgaben. Das Hotel, in das er am Vortag mit Annette gezogen war, hatte ihm Ulrich ans Herz gelegt, weil Ulrich mit Rom eine Liebesbeziehung hatte – Ulrich unterhielt darüber hinaus Liebesbeziehungen mit Madrid, mit Neapel und mit Lissabon. Er war ein polyamoröser Städte-Don-Juan, dessen Geschmack sich allerdings letzten Endes für Henning und Annette immer als Enttäuschung erwiesen hatte. Wie oft waren sie Ulrichs Restauranttipps gefolgt und dann – wie neulich in Wien – in einem tristen, kaum besuchten Lokal mit lieblos zubereiteten Allerweltsgerichten gesessen.
Und auch dieses Hotel hier oben auf dem Aventin, wo ihnen die Luft frischer und das Leben müheloser vorkamen als unten in der Stadt, besaß abgesehen von der Lage nichts Außergewöhnliches. Gleichwohl war es über Gebühr teuer, fast tausend Euro für drei Tage. Annette und er hatten eines der kleinen Appartementhäuser zugewiesen bekommen, die aus einem nicht besonders großen Schlafzimmer und aus einem dafür doppelt so großen Bad bestanden; das Badezimmer war ein gekacheltes Gewölbe im Untergeschoss, dunkel und glitzernd wie das Boudoir einer perversen Gräfin und viel zu groß für sie beide.
Am ersten Abend hatten sie einen Joint da unten geraucht, weil sich der Qualm von dort nicht bis zum Rauchmelder hochkräuseln konnte. Danach waren sie in eines von den Restaurants gegangen, die Ulrich ihnen empfohlen hatte – ein einfaches Lokal an der Straße, der Kellner träge, aber freundlich, und am Ende saßen sie bei einem soliden Pastagericht ohne besondere geschmackliche Raffinesse. Dafür war der Weißwein außergewöhnlich gut gewesen.
Henning hatte an diesem Morgen seinen Computer mit in den Hotelgarten genommen, weil er noch einen Zeitungsbeitrag fertig schreiben wollte, einen Essay, wie er gerne sagte, weil es erhabener klang und nicht so sehr nach Tagesmühe roch. Es wunderte ihn manchmal, dass die Redaktionen immer noch regelmäßig bei ihm anfragten; dass seine Einlassungen zur Welt weiterhin erwünscht waren, obwohl doch überall die Budgets immer knapper gehalten und längere Stücke seit einiger Zeit lieber von festangestellten Redakteuren besorgt wurden, um das Honorar zu sparen. Aber Henning Amelott schien noch ein Name mit einem gewissen Schmuckwert zu sein; wenn der große Bogen gewünscht war, die kritische Zeitbetrachtung aus dem Geist einer theoretischen und kulturhistorischen Expertise, dazu noch in einem lässigen Ton, der die polemische Zuspitzung nicht fürchtet – dann ging die Auftragsmail an Henning.
Es war noch ein Platz unter der kleinen Laube frei. Ein großer Tisch mit einer getönten Glasplatte stand darin und ein paar gepolsterte Gartenstühle; Henning legte die Computertasche auf eines der Polster und beschloss, drinnen beim Kellner einen Kaffee zu bestellen, da ging sein Mobiltelefon. Es war Rita, die zweite Frau seines Vaters.
Henning konnte sie kaum verstehen, einzelne Wörter wurden von einem Rauschen weggezerrt, nur dass sein Vater in der Nacht zuvor gestorben war, hatte er sofort begriffen. Es war kaum ein Satz im Zusammenhang verständlich, aber die Zeitangabe halb drei reichte aus, um den Sachverhalt begreiflich zu machen. Wenn etwas, das nachts um halb drei geschehen war, einen morgendlichen Anruf rechtfertigte, konnte dies nur ein größeres Unglück sein. Henning wollte das Gespräch kurzhalten, vor allem gab er darauf acht, Rita nicht allzu tröstliche Worte zu sagen, denn sonst konnte sie den Eindruck gewinnen, ihn betreffe der Tod seines Vaters nur wenig. »Das tut mir leid«, sagte er und dann den Satz, den er als eine Art sprachliche Jodtinktur in petto hatte: »Es war eine Erlösung für ihn.« Rita sagte etwas von fürchterlichem Kampf, der sieben Stunden gedauert habe. Henning kniff die Augen zu, um die einander widersprechenden Stimmen in seinem Kopf ordnen zu können. Die eine, die sagte: Es gibt Menschen, die länger und heftiger im Leben gekämpft haben als dein Vater, und die andere, die beschwichtigte: Lass es gut sein, kein Mensch ist vollkommen. Henning ging auf und ab während des Gesprächs, mal hörte er Rita besser, mal wieder undeutlicher, aber seine Augen erkannten in scharfer Kontur, was in diesem schönen Garten vor sich ging. Die Vorbereitung auf einen Tag, der niemandem hier Mühe machen würde, die Stärkung für die große Bummelei durch eine alte, mythenbeschwerte Stadt.
»Wann ist die Beerdigung?«, fragte Henning, und er fühlte, dass die Abwesenheit von Trauer bei ihm den Ehrgeiz weckte, möglichst aufmerksam und nötigenfalls hilfsbereit zu wirken. Er war die ganze Zeit auf und ab gegangen, manchmal konnte er an den Gesichtern der frühstückenden Gäste ablesen, dass offenbar auch in seinem Gesicht etwas vor sich ging oder zumindest eine Bewegtheit oder ein Schrecken zu erkennen war. Als Rita begann, ihm zu erklären, dass sie sich am Nachmittag beim Bestatter einfinden und Henning später über alles Weitere in Kenntnis setzen werde, stand er vor einem kleinen dunklen Teich, in dem eine Wasserschildkröte dabei war, ein großes Salatblatt zu fressen. Die Schildkröte stieß immer wieder mit dem Kopf gegen das Blatt, als sei es ihr wichtig, ihre Beute in Bewegung zu halten, vielleicht, um einen kleinen Jagdtrieb zu stimulieren. Nach jeweils zwei Stößen gelang es der Schildkröte, ein größeres Stück von dem Blatt abzubeißen, die Kerbe war ihr sichtbarer Triumph, aber vielleicht war sie gar nicht imstande, die Kerbe zu erkennen? Henning sah dem Tier zu und hörte gleichzeitig, wie Rita sich abmühte, ihre Trauer nicht allzu große Macht über sich gewinnen zu lassen. Ja, sie werde sich einfach wieder melden, später am Tag.
Henning dankte ihr nochmals für den Anruf und als das Gespräch beendet war, kniete er sich nieder und navigierte das Salatblatt ein wenig im Wasser hin und her. Die Schildkröte fiel in eine Starre, weil die plötzliche Einwirkung von außen sie beunruhigte. Aber dann gefiel ihr offenbar die plötzlich einsetzende Bewegung des Blattes und sie biss umso kühnherziger zu. Das Blatt wurde jetzt in immer kürzer werdenden Abständen und von verschiedenen Seiten angegriffen und die Kerben wurden zahlreicher und größer. Henning nahm seinen Rechner und ging in den Frühstücksraum. Er bestellte beim Kellner einen Kaffee, der auch gleich kam. Mein Vater ist tot, dachte er, das heißt, er dachte in Wahrheit: Ich bin jetzt ein Sohn, dessen Vater gerade gestorben ist. Es war, auch wenn er es niemandem hätte sagen können, ohne sich vor sich und dem anderen zu schämen, ein verhohlener Stolz, jetzt endlich ein Sohn ohne Vater zu sein.
Den Rechner hatte er zugeklappt und auf den Tisch neben die kleine silberne Kaffeekanne gelegt. Schreiben war jetzt nicht möglich, es erschien ihm irgendwie unangemessen, der Tod gebietet es, dachte Henning, dass die Welt zumindest ein paar Minuten lang den Atem anhält. Aber hier im Frühstücksraum hielt niemand den Atem an. Ein Vater mit seiner fast erwachsenen Tochter saß am Nebentisch, das Mädchen starrte in sein Smartphone wie in einen Abgrund. Der Mann sah resigniert aus, er hatte die Waffen gestreckt vor der Gleichgültigkeit seines Kindes, an welcher seine Erziehungsversuche gescheitert und alle Appelle ungehört verhallt waren.
Als Annette kam, sagte Henning ihr sofort, was passiert war. Sie legte ihm den Arm auf die Schulter und drückte dann ihr Gesicht an seine Wange. Es war genau das richtige Maß an Anteilnahme. Sie wusste ja, dass der Tod seines Vaters einerseits zu erwarten gewesen war, andererseits auch keine besonderen Verwerfungen in ihm auslösen würde. Annette sagte auch, dass es nun besser für seinen Vater war, eine Erlösung, ja das war es natürlich.
Was es für ihn selbst war, konnte Henning nicht sagen, es war alles zu klein für schwere Worte. Es gab Todesnachrichten, die wie Blitzeinschläge ins Gemüt fahren; danach ist nichts mehr, wie es vorher war, die Farben erlöschen, die Welt verliert ihr Licht, es gibt keine Zukunft, nur noch die Vergangenheit mit dem Toten. Hier in diesem Frühstücksraum war nichts anders als zuvor. Die Nachricht war in seinem Kopf, er hatte sie Annette mitgeteilt, aber sie war nicht in der Welt, weil die Welt zu groß war für dieses Ereignis, das eigentlich nur Rita etwas anging, dachte Henning. Annette fragte, ob es schon einen Termin für die Beerdigung gebe.
»Sie ruft noch einmal an deswegen«, sagte Henning. Jetzt kam ihm der in Aussicht gestellte Anruf von Rita beinahe wie eine Belästigung vor, die den vor ihnen liegenden Tag eintrübte. Annette holte sich Brot und Käse und redete in einer seltsamen Behutsamkeit mit Henning, die dieser sofort zurückwies.
»Ich bin nicht von Trauer gelähmt, das weißt du«, sagte er und sah mit Bedauern auf den zugeklappten Rechner. Nein, schreiben werde er heute nicht, obwohl er den Aufsatz über den Dichter Oskar Loerke spätestens nächste Woche abliefern sollte. Das Thema hatte er einem sogenannten Ideenmagazin angeboten, weil die schon länger einen Text von ihm haben wollten, und weil der Chefredakteur ein alter Freund aus Studentenzeiten war. »Sie können sich aussuchen, worüber Sie schreiben möchten«, hatte die junge Redakteurin ihm versichert, offenbar in Unkenntnis von Hennings Marotte, sich weniger auf allgemein zugängliche und populäre Themen zu kaprizieren als auf das Entlegene. Entsprechend irritiert gab sie sich, als Henning ihr vorschlug, einen Essay über diesen vergessenen Lyriker zu schreiben, und er hatte noch ihr verlegenes Stammeln im Ohr, dass sie zuerst den Chef fragen müsse, weil es doch jetzt ein unerwartet spezielles Thema sei.
Henning hatte sie sofort beruhigt und versichert, dass er nicht verstimmt sei, wenn sich die Redaktion dagegen entscheiden würde, er wisse ja, dass das Thema nicht jedermanns Sache sei. Nein, nein, das sei gewiss ein tolles Thema, sagte sie, aber sie fühle sich nicht kompetent genug, die Sache einzuordnen. Eine halbe Stunde später rief der Chef des Ideenmagazins an und gab sich in einer Weise begeistert, die darauf schließen ließ, dass er das Thema gegen die Empfehlung so gut wie aller seiner Kollegen durchgedrückt hatte. Natürlich müsse man jetzt, er betonte das Zeitwort, etwas über Oskar Loerke machen; wie dieser Mann sich so still und beharrlich gegen die Nazis gestemmt und ganz konträr zum herrschenden Zeitgeist seine leisen und vertrackten Sachen geschrieben habe, also darin könne man sich heute doch wiederfinden. Die Stille im großen Getöse, sagte er. Das reine Wort gegen den Chor der Social-Media-Quassler. Wenn das einer aufschreiben könne, dann sei es Henning, sagte er. »Ich freue mich wahnsinnig auf deinen Text, mein Lieber.«
Mit dieser überraschend zeitbezüglichen Einordnung seines abseitigen Themas war das Gespräch beendet und Henning hatte eine Nachmittagslaune zum Arbeitsgegenstand gemacht. Er bereute es sofort, aus Eitelkeit und Lust an der Irritation ausgerechnet dieses Thema angemeldet zu haben, das intensives Lesen und philologische Recherche verlangte. Eigentlich hatte er zu nichts weniger Lust, als sich damit zu beschäftigen. Warum hatte er es der Zeitschrift überhaupt angeboten? Eine Lesefrucht war, noch ehe sie reif wurde, zum Ernte-Projekt gemacht worden. Den umfangreichen Band mit Loerkes Gedichten hatte er ein paar Tage zuvor bei seinem Lieblingsantiquar in der Immanuelkirchstraße gekauft, einem stillen, manchmal sonnig lächelnden Mann namens Wolfgang Späthimmel, der seine Bücher wie seltene und sehr empfindsame Tiere pflegte. Bevor er den Laden zum ersten Mal betrat, hatte Henning den Mann beobachtet, wie er, leicht gebeugt auf dem Gehsteig stehend, seine Bücher mit einer feinen Bürste säuberte. Die Hingabe des Antiquars an seinen Gegenstand hatte Henning gerührt. Irgendwann war er mit Herrn Späthimmel ins Gespräch gekommen und ließ sich dessen Lebensgeschichte erzählen, keine aufregende Biographie, aber eine schöne Legende des einfachen Lebens, die Henning gut gefiel. Er wollte etwas kaufen, und weil er in dem Augenblick keinen zwingenden Lektürewunsch hatte, nahm er das braune Suhrkamp-Taschenbuch mit. Henning war einen kurzen Moment lang gespannt, ob Späthimmel seinen Kauf kommentieren würde; aber der Buchhändler lächelte nur freundlich, nahm die zehn Euro in Empfang und wünschte Henning viel Freude damit.
Henning begann in den Gedichten zu lesen und war rasch gefangen genommen von den dringlichen, mitunter beinahe ungelenken Versen, in denen eine wunderbare traurige Kraft lag. Was er über Loerke wusste, hatte er in den Biographien anderer Schriftsteller gelesen, die Loerkes betrübliches Schicksal wortreich bedauerten. Ein Naturlyriker, der seinen Lebensunterhalt als Lektor für den S. Fischer Verlag verdienen musste und unter dieser Fronarbeit litt. Der Preußischen Akademie diente er als Sekretär, bis die Nazis ihn kaltstellten. Die Nazis hatten ihn nicht gewollt und er hatte sie verabscheut. Bis dahin kannte Henning nur ein einziges Gedicht von Oskar Loerke, immerhin wusste er es auswendig: »Jedwedes blutgefügte Reich/ sinkt ein, dem Maulwurfshügel gleich./ Jedwedes lichtgeborne Wort/ Wirkt durch das Dunkel fort und fort.« Inzwischen hatte er nur wenig mehr von diesem Dichter gelesen, aber offenbar genug, um übermütig zu werden und gleich einen ausführlichen Beitrag über ihn zu vereinbaren.
Annette wollte shoppen gehen, das war Henning nur recht, weil sie dabei nicht gezielt auf die Jagd ging, wie diese Business-Bitches, die den schnellen Konsum in ihren Time Table tippten, sondern eher phlegmatisch herumsuchend, und wenn sie nichts fand, war es auch egal. Damit konnte Henning gut leben, er mochte es nicht, wenn Frauen wie irre von Boutique zu Boutique stapften, um einen bestimmten Rock, einen von Instagram tausendfach gepriesenen Wildledergürtel zu erbeuten.
Als sie aus dem Hotel traten, war die Morgensonne kräftig und heiß. Sie schlugen den Weg zum Malteserkloster ein, die Sonne schien mitzuwandern, es gab keine Schattenphasen auf dem Weg zum großen Platz, wo eine kleine Gruppe von Menschen hintereinander vor dem Eingangsportal der Basilika San Saba wartete. Der berühmte Blick durch das kleine handtellergroße Fenster, das Schlüsselloch, wie es in den Reiseführern augenzwinkernd hieß, ließ die Erwartung anwachsen, das Auge würde gleich einer besonders raffinierten Spielart der Landschaftsbetrachtung zugeführt. Annette und Henning stellten sich in die Reihe, amüsiert über die Disziplin der Leute am Ziel, die sich nur eine knapp bemessene Zeitspanne gönnten, um das Motiv in sich aufzunehmen. Als Annette ihr Auge an das schmale Fenster hielt, grinste sie wie über einen Sketch und lud Henning mit einer ironisch-förmlichen Handbewegung ein, durch das Schlüsselloch zu schauen. Henning wandte sich höhnisch lachend nach drei Sekunden von dem lächerlichen Bild ab, das ihm hier angedreht wurde: ein kitschiges visuelles Touristenangebot, der Petersdom und die Vatikanischen Gärten in ein und derselben Fluchtlinie. Dafür standen die Leute vor dem Loch Schlange? Das hätte man auch einfacher haben können, indem man sich an die Mauer stellte und auf das großzügige Weichbild der Stadt von hier oben schaute.
Sein Vater war nie in Rom gewesen. Auch nicht in Paris, nicht in Madrid, nicht in Prag, nicht einmal nach Wien hatte er es geschafft. Rita und er hatten in den letzten Jahren regelmäßig Urlaub in der Türkei gemacht, in einem Touristenclub, wo man deutsches Mittagessen bekam und Bier, und wo alles, was anders aussah und fremd schmeckte, außen vor bleiben musste. Henning erinnerte sich, wie sein Vater früher in der großen Halle der Fabrik stand und die türkischen Arbeiter beschimpfte. Das seien faule Schweine allesamt, »nur ein toter Türke ist ein guter Türke«, hatte er einmal einem Mann gesagt und das für einen guten Witz gehalten. In der Türkei, hatte sein Vater ihm auf diesen Einwand hin gesagt, lebten ja die ordentlichen Türken, die seien ganz anders als die bei uns. Die Welt seines Vaters war klein wie das Schlüsselloch an der Klosterkirche. Was er sah, rechnete er auf seine Bedürfnisse herunter, die auch gering geblieben waren sein ganzes Leben lang. Er hatte kein einziges Buch gelesen, seine Handschrift war ungelenk, die Orthografie fehlerhaft und sein Wissen über die Welt auf dem Stand eines Schulkindes.
Annette wollte einen richtigen Kaffee trinken, sagte sie, der im Hotel sei Instant-Plörre gewesen. Sie stiegen herunter vom Berg, wie zwei Propheten, dachte Henning, sie arbeiteten sich durch den Verkehr zum Tiber und schlüpften dann irgendwo zwischen den Steinpollern nach Trastevere durch.
In der Kirche Santa Maria zündete Henning eine Kerze an, die weiße schlanke Wachskerze bohrte er in ein Bett aus Pottasche, warf zwei Euro in den Blechschlitz und fühlte, dass es kaum eine unpassendere Geste geben konnte, als zu Ehren seines toten, zu Lebzeiten jeder Kulturgeste so fern gewesenen Vaters eine Kerze anzuzünden. Henning wusste, dass er die Kerze für sich selbst angezündet hatte, zu seiner Beruhigung, zur Besänftigung seines unguten Gewissens, dass er keine Spur von Trauer über den Tod seines Vaters an sich spürte. Er würde, sobald Rita mit dem Termin für die Beerdigung herausrückte, einen Zug ins Ruhrgebiet buchen, sehr früh am Morgen, um den bedrückenden Tag des Abschieds hinter sich zu bringen, und am frühen Abend zurück nach Berlin fahren. Henning stellte sich immer wieder die Rückfahrt vor, wie er, erschöpft von den Anforderungen an sein Mitgefühl, im Speisewagen säße, vor sich ein frisch gezapftes Bier, und mit jedem Schluck weicher und zufriedener würde – ein Mann der Schicksalsbejahung, denn natürlich war alles Natur oder der Wille Gottes oder wessen Wille auch immer.
Bald saßen sie an einem kleinen Plastiktisch vor einem Café und tranken Espresso. Annette rauchte eine Zigarette und fragte Henning nach seinem Gefühl. Nein, Trauer nicht, sagte er, eher ein mattes Einverständnis mit dem Unausweichlichen. Dass Annette ihn ratlos anlächelte, geschah ihm nur recht. Er mochte seine Selbstzufriedenheit auch nicht, sie war unpassend und jede Beschwichtigung kam als ein Eingeständnis seiner kompletten Empfindungslosigkeit daher. Was für ein Privileg das war, seinen Vater verloren zu haben und weder Verachtung noch Trauer, weder rückblickenden Zorn zu empfinden noch die Sorge einer künftigen Leere zu haben. Er würde seinen Vater nicht vermissen, zu keinem Zeitpunkt. Und trotzdem war nichts Unredliches an seiner Art, diesen Tod zu verarbeiten; es war alles möglich in diesem Rahmen, jeder Kaffee, jedes Essen, ja auch der Apero später am Nachmittag würde nichts Unangemessenes an sich haben. Es wuchs ja kein Übermut in ihm, es blieb nur eine leichte Mattigkeit nach der Wucht des Ereignisses. Andererseits hatte Henning von dieser Wucht höchstens ein leichtes Beben mitbekommen.
Die Trauernden saßen woanders. Hier saßen Annette und er an diesem schönen heißen Sommertag in Rom, das beinahe menschenleer war, jedenfalls kam es ihm hier viel ruhiger und genügsamer vor als in Paris, wo er einmal für ein Jahr gelebt hatte. In Rom würde nichts mehr entschieden werden, den Gedanken hatte er jetzt, und er mochte ihn, weil er unsinnig war und in seiner Unsinnigkeit tröstlich. Diese alten Steine, die gewaltigen Reste großer Reiche, auf denen die Jugendlichen mit ihren Weinflaschen saßen, die Wohnungen, in denen junge Dichter gestorben waren, die Restaurants mit ihren verblassten Fotos an den Wänden, die Gärten und die toten Augen der Philosophen auf ihren Sockeln – es gab keinen besseren Ort für jemanden, der mit aufwendigen Zukunftsplänen nichts am Hut hatte. Die Stadt war mit Vergangenem vollgestellt, überall traf man auf Größe, auf gespeichertes Wissen. Annette und er hatten, seit sie sich kannten, die Abmachung, in bedeutenden Städten grundsätzlich auf Sightseeing zu verzichten. Sollten die anderen die endlosen Schlangen vor den Vatikanischen Gärten bilden, soll der eine, soll die andere gesenkten Hauptes ins Pantheon eintreten, wo die Japaner die Grabmonumente durch ihre Smartphones betrachten.
Das Goethehaus am Corso hätte Henning gerne besichtigt, um einmal das Fenster zu sehen, vor dem der Dichter in Pantoffeln und Weste gestanden und nach draußen geschaut hatte – sein Freund Tischbein hatte diesen Schnappschuss gezeichnet. Damals besaßen Künstler die Gabe, Augenblicke einzufangen, ohne dass ihnen eine rasche Belichtungszeit oder die digitale Sofortverbilderung zur Verfügung standen. Ein paar schnelle Umrisse, die Idee einer Figur und ihrer Position in der Welt mit dünnen Bleistiftlinien skizziert, so hielten sie die Banalitäten für uns Nachgeborene fest, die heute in jeder freigelegten Socke einen Beleg für die Lässigkeit der Klassiker vermuten. In Rom würden sie keine Tickets kaufen, Annette und er, keine Münzen in Opferstöcke werfen, keine andächtigen Begehungen irgendwelcher Kunstorte vornehmen oder Friedhöfe mit bedeutenden Namen aufsuchen. Allenfalls eine Galerie, eine besonders interessante Ausstellung, auf die sie beide sich einigen konnten.
Annette bat sich ein wenig Zeit aus, um sich in Schuhgeschäften und Modeboutiquen umschauen zu können. Henning blieb vor den Läden stehen, frei von Ungeduld und ohne Annette vorher genötigt zu haben, die ungefähre Dauer ihres Ladenbummels anzugeben. Es war ohnehin nicht wichtig, Henning liebte es, Zeit zu vergeuden, ins Nichts zu starren und seinerseits Leuten bei Nichtigkeiten zuzuschauen. Ein paar Minuten so absichtslos dazustehen, dachte er, wie sein Vater sein ganzes Leben zugebracht hatte: ohne irgendetwas zu wollen.
Vor zwei Jahren hatte sein Vater ihm über Whatsapp mitgeteilt, dass der feste Knoten in seinem Bein ein Sarkom sei, eine Krebswucherung im Gewebe. »Das Geschwür ist bösartig, also Krebs«, stand in der Mitteilung. Er ließ sich operieren, die Chirurgen hatten den Tumor weitflächig, wie es hieß, herausgenommen, dazu einen großzügigen Teil des umliegenden Gewebes, um sicherzugehen, dass sich keine Tochtergeschwülste abgesetzt hatten. Es sah so aus, als wäre er glimpflich davongekommen. Das Wort glimpflich war Henning immer interessant erschienen. Er hatte einmal gelesen, dass es sich auf das mittelhochdeutsche Wort für Angemessenheit berief. Sein Vater schien also angemessen aus der Krankheit herauszukommen. Aber wem oder was sollte die glückliche Fügung angemessen gewesen sein? Dem Phlegma, aus dem sein Vater sein Lebtag nicht herausfand, weil er es nicht erkannte? Rita hatte es auch nicht erkannt, das Phlegma, so wie die Ärzte bei seinem Vater erst sehr spät den Krebs erkannt hatten. Es war kein Krebs, der bequem auf eine besonders exzentrische Lebensweise zurückzuführen war, auf starkes Rauchen, auf haltloses Trinken, geschweige denn, dass es ein Krebs war, der als somatische Äußerung eines schwer wiegenden seelischen Leidens zu deuten gewesen wäre. Seinem Vater war alles fern und fremd, was anders oder besonders zu sein schien. Er hatte ohne jeden inneren und äußeren Aufwand gelebt, und den Krebs, den er bekam, hatte er sich auch nicht erarbeitet. Henning war es unwohl bei diesen Gedanken, diesem unbotmäßigen Sarkasmus, zu dem er keinen Anlass hatte. Oder doch?
Während Annette in einem Schuhladen ein paar Modelle anprobierte, kam draußen in die schmale Gasse, wo Henning stand, plötzlich Bewegung. Zwei Männer, der eine mit Kamera, der andere mit Notizbuch ausgestattet, hatten ein junges Paar entdeckt, sie groß, blond und ansonsten ohne bemerkenswerte Kennzeichen, der Junge ebenso groß, dunkelhaarig und von gleicher Durchschnittlichkeit. Aber sie mussten für irgendetwas berühmt sein, denn die Männer liefen ihnen, immer schneller werdend, hinterher, bis sich die beiden in einen Parfümladen verzogen; geduldig wie Hunde warteten die Paparazzi davor. Henning war aufgewühlt von der Szene, wo war Annette? Er hätte sie jetzt als Informantin gebraucht, denn Annette wusste ganz sicher, wer dieses Mädchen und ihr Freund waren. Eine bedeutende Schauspielerin, deren Reputation jeder kannte, jeder außer Henning natürlich? Oder eine Sängerin, die mit einem Lied, das jedem geläufig war, jedem außer Henning, weltweit Herzen erobert hatte?
Annette kam früher aus ihrem Schuhladen, als die beiden die Parfümerie verließen, und Henning versuchte, Annette das Mädchen zu beschreiben. Aber während er die lächerlich dürftigen Merkmale aufzählte, kam er sich schon dämlich vor, die Szene überhaupt erwähnt zu haben. Annette zeigte nicht eine Spur von Neugierde, und Henning dachte für einen kurzen Augenblick daran, die Paparazzi zu fragen, wen sie da eigentlich jagten. Vielleicht waren es auch eher die beiden, die ihn interessierten, weil er Kollegen in ihnen erkannte, Journalisten wie er, nur näher dran am richtigen Leben. Aber hätte er wirklich mit ihnen tauschen wollen, war ihm denn so daran gelegen, am Unmittelbaren teilzunehmen, den Alltag einzufangen, den Menschen in seinem natürlichen Umfeld abzubilden? Eigentlich hatte Henning doch alles verabscheut, was diesen Beruf für die meisten Journalisten so interessant machte. Er hasste es, Leuten ihre Geheimnisse zu entlocken, er mochte die Fragerei nicht, weil er eigentlich kaum Fragen hatte. Alle Fragen, die er als Journalist gestellt hatte, waren gestellte Fragen, konstruiertes Interesse, er wollte eigentlich gar nichts in Erfahrung bringen. Und was gab es Unerfreulicheres als ein Telefongespräch mit einem fremden Menschen über einen Gegenstand, der diesem anderen, Fremden, vermutlich so unangenehm war wie Henning?
Einmal, und das war bislang seine letzte Arbeit am lebenden Menschen gewesen, hatte er eine alte Schriftstellerin besucht, die sich von muslimischen Männern verfolgt sah. Sie hatte Henning in ihrer großzügigen Wohnung in Schöneberg empfangen, schwarz gekleidet, und in ihrer kettenrauchenden Einsamkeit pflegte sie eine traurige Eleganz. Das Gespräch kreiste um nichts anderes als um ihren Fetisch der feindlichen Übernahme. Wenn sie mit ihrem alten, fast blinden Hund die Runde machte, trug sie immer Reizgas bei sich, um sich der zu jeder Zeit denkbaren Übergriffe zu erwehren. Bei Hennings zweitem Besuch erklärte sie, dass sie den Schwarzen in Afrika am liebsten ein Mittel ins Trinkwasser geben würde, das sie unfruchtbar machte. Aber das Zitat wollte sie auf keinen Fall freigeben.
Annette suchte ein kleines Café in der Via Catalana aus, wo sie wieder auf Plastikstühlen saßen und Aperol Spritz bestellten. Nachdem er den ersten Schluck genommen hatte, fühlte er die erhoffte Seelenstreckung, eine schöne Weichheit und die erste Ahnung einer feierlichen Gleichgültigkeit. Das Leben bestand, wenn es gut sein sollte, aus solchen Augenblicken, die den Körper entlasten und den Verstand auf lässige Weise schärfen.
»Hat sich Rita noch einmal gemeldet?«, fragte Annette.
»Nein, ich denke, sie kümmert sich um die Beerdigung.«
»Dann fährst du gleich am Montag?«
»Keine Ahnung, ich nehme es an.«
Henning dachte daran, wie er lange gezögert hatte, ehe er Annette seinen Vater und Rita vorstellte. Aber als die beiden für ein Wochenende nach Berlin gekommen waren, war es Annette, die ihm bescheinigte, dass sein Vater zwar ein einfacher, aber kein unangenehmer Mensch sei. Und Rita sei doch wirklich klasse und patent. Henning war überrascht, wie sehr erleichtert er danach war.
»Richte Rita einen schönen Gruß aus, und dass es mir leidtut«, sagte Annette als sie den zweiten Aperol vor sich hatten, das frische sprudelnde Rot mit der Orangenscheibe und den Eiswürfeln darin.