Georgi Gospodinov
Zeitzuflucht
Roman
Aus dem Bulgarischen von Alexander Sitzmann
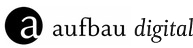
In Georgi Gospodinovs Roman trifft der Erzähler auf Gaustine, einen Flaneur, der durch die Zeit reist. Er liest alte Nachrichten, trägt Vintage-Kleider und erforscht die verschlungenen Pfade des 20. Jahrhunderts. In Zürich eröffnet Gaustine eine »Klinik für Vergangenheit«, eine Einrichtung, die Alzheimer-Kranken eine inspirierende Behandlung anbietet: Jedes Stockwerk ist einem bestimmten Jahrzehnt nachempfunden. Patienten können dort Trost finden in ihren verblassenden Erinnerungen. Aber auf einmal interessieren sich auch immer mehr gesunde Menschen dafür, in die Klinik aufgenommen zu werden, in der Hoffnung, den Schrecken der Gegenwart zu entkommen ... Ein glänzender Roman, durchzogen von Verspieltheit und dunklem Witz, der uns eine neue Art eröffnet, unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenzudenken.
Georgi Gospodinov, geboren 1968 in Bulgarien, ist Autor, Lyriker und Dramatiker. Er wurde bekannt mit seinem »Natürlichen Roman« sowie der »Physik der Schwermut«. Er wurde ausgezeichnet mit dem Mitteleuropäischen Literaturpreis Angelus, dem Jan Michalski Preis und dem Usedomer Literaturpreis und war Finalist des Brücke Berlin Preises sowie des PEN Übersetzerpreises. Sein Roman »Zeitzuflucht« erscheint in mehr als fünfzehn Sprachen. Er erhielt dafür den Premio Strega Europeo.
Alexander Sitzmann, geboren 1974 in Stuttgart, studierte Skandinavistik und Slawistik in Wien, forscht und lehrt an der dortigen Universität. Seit 1999 ist er als literarischer Übersetzer aus dem Bulgarischen, Mazedonischen und den skandinavischen Sprachen tätig.
Georgi Gospodinov
Zeitzuflucht
Roman
Aus dem Bulgarischen von Alexander Sitzmann
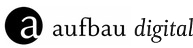
Meiner Mutter und meinem Vater,
die immer noch die ewigen Erdbeerfelder der Kindheit jäten
Alle echten Personen in diesem Roman sind ausgedacht,
nur die ausgedachten sind echt.
Bisher hat noch niemand eine Gasmaske und einen Luftschutzraum gegen die Zeit erfunden.
Gaustín, »Zeitzuflucht«, 1939
Aber welches ist denn unser Zeitorgan? Willst du mir das mal eben angeben?
Thomas Mann, »Der Zauberberg«
Der Mensch ist die einzige Zeitmaschine, über die wir verfügen.
Gaustín, »Gegen die Utopien«, 2001
Wozu gibt’s Tage? Wo sonst sollten wir leben?
Philip Larkin, »Days«
Oh, yesterday came suddenly …
John Lennon/Paul McCartney
»Wenn die Straße die Zeit wäre, und er am Ende der Straße…«
T. S. Eliot, »The Boston Evening Transcript«
Unser ewiges gestern, gestern und dann wieder gestern …
Gaustín/Shakespeare
Der Roman kommt im Notfall mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene daher.
Gaustín, »Emergency Novel.
Brief Theory and Practice«
… und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist.
Prediger 3,15
Die Vergangenheit unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von der Gegenwart – sie fließt nie in eine Richtung.
Gaustín, »Physik der Vergangenheit«, 1905
Einmal, als sie noch klein war, zeichnete sie ein Tier, das absolut nicht zu erkennen war.
Was ist das, fragte ich.
Manchmal ist es ein Hai, manchmal ein Löwe und manchmal eine Wolke, antwortete sie.
Aha, und was ist es jetzt gerade?
Und jetzt ist es ein Versteck.
G. G., »Anfänge und Enden«
Klinik für Vergangenheit
Also, das Thema ist das Gedächtnis. Tempo: andante bis andante moderato, sostenuto (zurückhaltend). Vielleicht wäre die Sarabande mit ihrer beherrschten Feierlichkeit, mit der Punktierung der zweiten Note gut für den Anfang. Eher Händel als Bach. Strenge Wiederholung und zur gleichen Zeit kommt sie vom Fleck. Zurückhaltend und feierlich für den Anfang. Danach kann – und muss – alles zerfallen.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt macht man sich daran auszurechnen, wann die Zeit begonnen hat, wann genau die Erde erschaffen wurde. Der irische Bischof Ussher berechnete Mitte des 17. Jahrhunderts nicht nur das konkrete Jahr, sondern auch das anfängliche Datum: 22. Oktober 4004 vor Christi Geburt. Es sei auf einen Samstag gefallen (natürlich). Manchen Forschern zufolge nennt Ussher auch die genaue Stunde – gegen sechs am Nachmittag. Samstagnachmittag, das glaube ich sofort. Zu welcher anderen Zeit der Woche wird sich ein gelangweilter Schöpfer daran machen, eine Welt zu erbauen und sich Gesellschaft zu suchen. Ussher widmete dem sein ganzes Leben, der Aufsatz umfasste 2000 Seiten auf Latein, es haben sich wohl kaum viele die Mühe gemacht, ihn ganz zu lesen. Aber er wurde außerordentlich populär, vielleicht nicht so sehr er selbst, als eher die darin beschriebene Entdeckung. Die Bibeln der Insel kamen fortan mit nach Ussher vermerktem Datum und Chronologie aus dem Druck. Diese Theorie über die junge Erde (und meiner Meinung nach über die junge Zeit) eroberte die christliche Welt. Wir müssen dazusagen, dass sogar Gelehrte wie Kepler und Sir Isaac Newton konkrete Zeitangaben für die göttliche Schöpfung machen, die ebenfalls rund um das von Ussher angegebene Jahr liegen. Aber trotzdem sind für mich nicht das Jahr und die Tatsache, dass es gar nicht so lange zurückliegt, das Erstaunlichste, sondern der konkrete Tag.
22. Oktober, viertausendundvier Jahre vor Christus, gegen 6 Uhr Nachmittag.
Irgendwo im oder um den Dezember 1910 veränderte sich der menschliche Charakter. So schreibt Virginia Woolf. Und man kann sich jenen Dezember des Jahres 1910 vorstellen, vordergründig wie alle anderen auch, grau, kalt und nach frischem Schnee riechend. Aber etwas hat sich gelöst, etwas, das nur wenige gespürt haben.
Am 1. September 1939 früh am Morgen kam das Ende der menschlichen Zeit.
Jahre später, wenn viele seiner Erinnerungen wie erschrockene Tauben in alle Richtungen davonfliegen würden, könnte er sich immer noch diesen Morgen zurückrufen, an dem er ziellos durch die Straßen Wiens ging und ein Stadtstreicher mit einem Schnurrbart wie Márquez auf dem Gehsteig in der frühen Märzsonne Zeitungen verkaufte. Es kam Wind auf, und einige Zeitungen erhoben sich in die Luft. Er versuchte zu helfen, erwischte zwei, drei und brachte sie zurück. Sie können eine behalten, sagte Márquez.
Gaustín, wir werden ihn so nennen, obwohl er selbst diesen Namen als Tarnkappe verwendete, steckte die Zeitung ein und reichte ihm eine Banknote, eine ziemlich große in Anbetracht der Umstände. Der Stadtstreicher drehte sie unschlüssig in der Hand hin und her und sagte unvermittelt: Aber … ich kann doch gar nicht rausgeben. Das klang so absurd an diesem frühen Wiener Morgen, dass beide lachten.
Gaustín verspürte Liebe und Furcht für die Obdachlosen, das waren die Wörter, und immer in dieser Kombination. Er liebte sie und fürchtete sich vor ihnen in der Art, in der man jenes liebt und fürchtet, das man schon gewesen ist oder von dem man erwartet, dass man sich eines Tages in es verwandeln wird. Er wusste, dass er sich früher oder später in ihre Armee eingliedern würde, falls wir das Klischee verwenden wollen. Er stellte sich einen Augenblick lang die langen Reihen marschierender Obdachloser auf der Kärntner Straße und dem Graben vor. Ja, er war mit ihnen verwandt, war einer von ihnen, wenngleich ein wenig anders als sie. Ein Obdachloser in der Zeit sozusagen. Er war einfach aufgrund glücklicher Umstände mit ausreichend Geldmitteln ausgestattet, um die Verwandlung metaphysischer Unbilden in physisches Leid hinauszuschieben.
Zu diesem Zeitpunkt verwendete er einen seiner Berufe – den des Alterspsychiaters. Ich hatte den Verdacht, dass er heimlich die Geschichten seiner Patienten klaute, um in ihnen unterzuschlüpfen, um sich für kurze Zeit an jemandes Ort und Vergangenheit niederzulassen. Sonst herrschte in seinem Kopf ein solches Durcheinander von Zeiten, Stimmen und Orten, dass er sich entweder unverzüglich in die Hände seiner Psychiaterkollegen hätte begeben müssen oder dass er etwas Derartiges getan hätte, dass sie ihn ganz von selbst einkassierten.
Gaustín nahm die Zeitung, ging ein paar Schritte und setzte sich auf eine Parkbank. Er trug einen Borsalino, einen dunklen Trenchcoat, unter dem ein Rollkragenpulli mit hochgezogenem Kragen zu sehen war, alte Lederschuhe und eine Ledertasche in mit Würde verbleichendem Rot. Er sah aus wie jemand, der soeben mit dem Zug aus einem anderen Jahrzehnt angekommen war, er hätte als diskreter Anarchist durchgehen können, als alternder Hippie oder Prediger eines weniger bekannten Ordens.
Er setzte sich also auf die Parkbank und las den Namen der Zeitung – »Augustin«, die Obdachlosenzeitung. Ein Teil der Zeitung wurde von den Obdachlosen geschrieben, ein Teil von professionellen Journalisten. Dort irgendwo, auf der vorletzten Seite unten links in der Ecke, dem am wenigsten beachteten Bereich in einer Zeitung, das wissen alle Zeitungsmacher, stand die Notiz. Sein Blick fiel darauf. Ein schmales Lächeln, in dem mehr Bitterkeit lag als Freude, huschte über sein Gesicht. Er würde gezwungen sein, wieder zu verschwinden.
Vor einiger Zeit, als Herr Alzheimer noch hauptsächlich in Witzen Erwähnung fand, welche Diagnose wurde dir gestellt, nun ja, es war der Name eines Mannes, aber ich habe ihn vergessen, erschien eine kurze Mitteilung in einer kleinen Zeitung, eine jener Nachrichten, die von fünf Personen gelesen und von vieren von ihnen im selben Augenblick wieder vergessen wird.
Hier die Notiz, in wenigen Worten nacherzählt.
Ein Arzt, ein gewisser Dr. G. (erwähnt nur mit seiner Initiale) aus dem Wiener Geriatriezentrum am Wienerwald, ein Verehrer der Beatles, hatte sein Büro im Stil der 60er eingerichtet. Er trieb ein Bakelit-Grammophon auf, hängte sich Bandplakate an die Wand, den berühmten »Sergeant Pepper« … Auf dem Flohmarkt besorgte er sich einen alten Schrank und stellte allen möglichen Kleinkram aus den Sechzigern hinein – Seifen, Zigarettenschachteln, eine Serie von VW Käfern im Miniaturformat, rosa Cadillacs und Mustangs, Filmplakate, Poster von Schauspielern. Es hieß auch, sein Schreibtisch sei mit alten Zeitschriften überhäuft, und er selbst sitze da und trage einen Rollkragenpulli unter dem weißen Kittel. Foto gab es natürlich keines, der ganze Artikel bestand aus knapp dreißig Zeilen, die in die linke untere Ecke gequetscht waren. Die Nachricht bestand darin, dass der Arzt bemerkt hatte, wie die Patienten mit Störungen im Gedächtnis immer länger in seinem Büro verweilten, immer gesprächiger wurden, mit anderen Worten, sie fühlten sich wie zu Hause. Auch die häufigen Fluchtversuche aus dieser sonst renommierten Klinik hatten radikal abgenommen.
Die Mitteilung hatte keinen Autor, sie war im Namen der Zeitung unterzeichnet.
Das war eigentlich meine Idee gewesen, sie schwirrte mir seit Jahren im Kopf herum, aber offenbar war mir jemand zuvorgekommen. (Ich muss gestehen, dass meine Idee sich auf einen Roman bezog, nicht auf eine Klinik, aber egal.)
Bei Gelegenheit besorgte ich mir immer diese Straßenzeitung, einerseits aufgrund einer seltsamen Verbundenheit mit denen, die sie redigierten, eine lange Geschichte aus einem anderen Roman, aber auch aufgrund des deutlichen Gefühls (persönlichen Aberglaubens), dass genau auf diese Art und Weise, durch einen Zeitungsausschnitt, jenes, was dir gesagt werden muss, bei dir landet oder vor dem Blick vorbeihuscht. Und es hat mich nie getäuscht.
Dort stand, dass die Klinik im Wienerwald war, sonst nichts. Ich überprüfte die Geriatriezentren in der näheren Umgebung, mindestens drei von ihnen befanden sich dort. Dieses, das ich brauchte, stellte sich, wie es sich gehört, als das letzte heraus. Ich gab mich als Journalist aus, eigentlich war das gar nicht so sehr gelogen, ich hatte einen Ausweis von einer Zeitung, um kostenlos in die Museen zu kommen, und manchmal schrieb ich sogar für sie. Sonst verwendete ich den verwandten, weitaus harmloseren und flüchtigeren Beruf des Schriftstellers, mit dem es unmöglich ist, sich auszuweisen.
Wie dem auch sei, es gelang mir, übrigens mit ziemlich viel Mühe, zur Direktorin der Klinik vorzudringen. Als sie begriff, wofür ich mich interessiere, wurde sie schlagartig verschlossen. Die Person, nach der Sie suchen, ist seit gestern nicht mehr verfügbar. Warum? Sein Arbeitsverhältnis wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, antwortete sie, wobei sie sich auf die rutschige Ebene der Beamtensprache begab. Wurde er entlassen, zeigte ich mich aufrichtig verwundert. Ich habe Ihnen doch gesagt, in beiderseitigem Einvernehmen. Warum interessieren Sie sich dafür? Ich habe in der Zeitung vor einer Woche einen interessanten Artikel gelesen … Noch während ich die Phrase aussprach, spürte ich, dass ich einen Fehler beging. Jenen Artikel mit den Fluchtversuchen aus der Klinik? Von unserer Seite ist eine Klage auf Widerruf eingereicht worden. Ich begriff, dass es für mich keinen Grund gab, weiter hier zu sitzen, ich begriff auch den Grund für die Kündigung in beiderseitigem Einvernehmen. Und wie hieß der Arzt, drehte ich mich im Hinausgehen noch einmal um, aber sie sprach bereits am Telefon.
Ich verließ die Klinik nicht sofort, ich entdeckte den Flügel mit den Büros und sah, wie ein Arbeiter gerade das Schild von der dritten Tür rechts abnahm. Natürlich, das war sein Name. Ich hatte es von Anfang an geahnt.
Gaustíns Spur aufzunehmen, der von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wechselt, so wie wir am Flughafen den Flieger wechseln, ist eine Chance, die sich nur einmal alle hundert Jahre auftut. Gaustín, den ich mir zuerst ausdachte und später in Fleisch und Blut traf. Oder war es umgekehrt, ich erinnere mich nicht. Der unsichtbare Freund, sichtbarer und realer als ich selbst. Der Gaustín meiner Jugend. Der Gaustín meines Wunschtraums, jemand anders zu sein, anderswo zu sein, eine andere Zeit zu bewohnen und andere Räume. Wir hatten eine gemeinsame Obsession für die Vergangenheit. Der Unterschied war klein, aber wesentlich. Ich blieb überall ein Fremder, doch er fühlte sich in allen Zeiten gleich wohl. Ich klopfte an die Türen von allerlei Jahren, doch er war schon dort, öffnete mir, führte mich ein und verschwand.
Als ich Gaustín zum ersten Mal rief, war es, damit er drei Zeilen unterschrieb, die einfach so von irgendwoher zu mir gekommen waren, gleichsam aus einer anderen Zeit. Ich mühte mich monatelang ab und konnte ihnen nichts hinzufügen.
Der Troubadour ist von der Frau erdichtet
Ich wiederhole es noch einmal
Sie hat den Dichter erdacht
Eines Abends träumte ich den Namen, geschrieben auf einen Ledereinband – Gaustín von Arles, 12. Jhd. Ich erinnere mich, dass ich mir noch im Traum sagte, das ist es. Später tauchte Gaustín selbst auf, will sagen einer, der ihm ähnelte und den ich für mich selbst auch so nannte.
Es war ganz am Ende der 80er. Irgendwo muss ich diese Geschichte aufbewahrt haben.
Gaustín. Kennenlernen
Genau so würde ich ihn euch gerne vorstellen: Auf einem der traditionellen frühseptemberlichen Literaturseminare am Meer sah ich ihn zum ersten Mal. Wir hatten uns gegen Abend in ein kleines Restaurant am Ufer gesetzt, ausnahmslos Schreibende, unverheiratet und ohne ein erstes Buch veröffentlicht zu haben, in einem angenehmen Alter zwischen 20 und 25. Der Kellner kam fast nicht damit nach, die Schnäpse, gemischten und Snežanka-Salate aufzuschreiben. Als wir endlich verstummten, meldete sich zum ersten Mal der junge Mann am Ende des langen Tisches, dem es offenbar nicht gelungen war, seine Bestellung aufzugeben.
Eine Kaffeesahne, bitte!
Er sprach es aus mit der Entschiedenheit eines Menschen, der zumindest Ente mit Orangen oder Blue Curaçao bestellt. Während der darauffolgenden langen Stille hörte man nur, wie der vom Meer her kommende leichte Abendwind eine leere Plastikflasche mit sich schleifte.
Verzeihung?, brachte der Kellner heraus.
Eine Kaffeesahne, bitte, wiederholte er mit derselben zurückhaltenden Würde.
Auch wir waren verdutzt, aber schon kurz darauf setzten die Gespräche bei Tisch wieder mit ihrer vorherigen Lautstärke ein. Bald bedeckten Teller und Gläser die Tischdecke vollständig. Das letzte, was der Kellner brachte, war ein kleines Porzellantellerchen mit vergoldetem Rand. In der Mitte des Tellers stand anmutig, wie mir schien, die bestellte Kaffeesahne. Er trank so langsam und so wenig, dass sie ihm für den ganzen Abend reichte.
Das war unser erstes Zusammentreffen.
Bereits am nächsten Tag versuchte ich, ihm näherzukommen, und in der weniger als einen Woche verbleibender Zeit kehrten wir dem Seminar vollends den Rücken. Wir gehörten beide nicht zu den Gesprächigsten, sodass wir unsere Zeit wunderbar mit Spaziergängen und Schwimmen in gemeinsam geteiltem Schweigen verbrachten. Immerhin gelang es mir zu erfahren, dass er allein lebte, sein Vater war schon vor langer Zeit gestorben und seine Mutter vor einem Monat zum dritten Mal illegal nach Amerika aufgebrochen – er hoffte sehr, dass sie diesmal Erfolg haben würde.
Außerdem erfuhr ich, dass er manchmal Erzählungen vom Ende des letzten Jahrhunderts schrieb, genau so drückte er sich aus, und ich konnte meine Neugier kaum zügeln, tat aber so, als sei das etwas ganz Natürliches. Die Vergangenheit beschäftigte ihn besonders. Durch alte, leerstehende Häuser sei er gezogen, habe in den Ruinen gewühlt, Dachböden und Kisten durchsucht, alle möglichen Altwaren sammle er. Von Zeit zu Zeit gelinge es ihm, etwas zu verkaufen, an ein Antiquariat oder an Bekannte, und so erhalte er sich. Ich dachte mir, dass die Bescheidenheit seiner Bestellung an jenem Abend keinen Anlass dazu gab, sonderlich viel Vertrauen in diese Art von Business zu setzen. Deshalb, als er nebenbei erwähnte, dass er im Moment über drei Schachteln Zigaretten der Marke »Tomasjan« aus dem Jahre 1937 verfüge, entstaubt und Double Extra Qualität, wollte ich ihm, als eingefleischter Raucher, sofort alle drei abkaufen. Wirklich?, fragte er. Ich hätte schon immer davon geträumt, so lang gelagerte »Tomasjan« zu probieren, antwortete ich, und er rannte los zu seinem Bungalow. Er sah mir mit echtem Vergnügen dabei zu, wie ich sie lässig mit einem deutschen Originalstreichholz aus dem Jahre 1928 (ein Geschenk von ihm zu den Zigaretten) anzündete, und fragte, wie der Geist von 37 sei. Scharf, gab ich zur Antwort. Die Zigaretten waren wirklich stark, hatten keinen Filter und qualmten mächtig. Das liegt sicher an den Bombardierungen von Guernica im selben Jahr, sagte Gaustín leise. Oder vielleicht ist es auch wegen der »Hindenburg«, der größte Zeppelin der Welt explodierte damals kurz vor der Landung, ich glaube am 6. Mai, 100 Meter über dem Boden und mit 97 Personen an Bord. Alle Radioreporter weinten im Äther. Solche Dinge bleiben sicher an den Tabakblättern kleben …
Ich wäre fast erstickt. Ich drückte die Zigarette aus, sagte aber nichts. Er sprach wie ein Augenzeuge, dem es nach vielen Anstrengungen gelungen war, über das Geschehene hinwegzukommen.
Ich beschloss, das Thema abrupt zu wechseln, und an diesem Tag fragte ich ihn zum ersten Mal nach seinem Namen. Nenn mich Gaustín, sagte er und lächelte. Angenehm, Ismael, antwortete ich, um den Scherz noch ein wenig weiterzutreiben. Aber er schien mich gar nicht zu hören, sagte, ihm gefalle dieses eine Gedicht mit dem Motto von Gaustín, das war mir angenehm, muss ich gestehen. Und außerdem, fuhr er ganz ernst fort, verbindet es meine beiden Namen Augustin-Garibaldi miteinander. Meine Eltern konnten sich nicht darauf einigen, wie ich heißen sollte. Mein Vater bestand darauf, mich auf den Namen Garibaldi zu taufen, er war sein leidenschaftlicher Verehrer. Meine Mutter, sagte Gaustín, eine stille und kluge Frau, eine bekennende Verehrerin des Hl. Augustinus mit drei Semestern Philosophie an der Universität, wiederum bestand darauf, auch den Namen des Heiligen dazuzunehmen. Sie nennt mich immer noch Augustin, und mein Vater nannte mich, solange er noch am Leben war, Garibaldi. So fanden frühe Theologie und spätes Revoluzzertum zusammen.
Alles in allem erschöpfte sich damit die konkrete Information, die wir im Laufe dieser fünf, sechs Tage des sich seinem Ende zuneigenden Seminars austauschten. Ich erinnere mich natürlich auch an einige besonders wichtige Momente des Schweigens, aber die kann man schwerlich nacherzählen.
Ach ja, es gab noch ein kurzes Gespräch, am letzten Tag. Erst da erfuhr ich, dass Gaustín in einem verlassenen Haus in einem kleinen Städtchen am Fuße des Balkangebirges lebte. Ich habe kein Telefon, sagte er, aber Briefe kommen an. Er kam mir unendlich einsam vor und … unzugehörig. Das war das Wort, das mir damals in den Sinn kam. Nicht zugehörig zu nichts in der Welt, oder genauer gesagt, zur gegenwärtigen Welt. Wir betrachteten den verschwenderischen Sonnenuntergang und schwiegen. Aus dem Gebüsch hinter uns erhob sich eine ganze Wolke von Mücken. Gaustín folgte ihnen mit dem Blick und sagte: Während das für uns einfach nur ein weiterer Sonnenuntergang ist, ist dieser Sonnenuntergang für die heutigen Eintagsfliegen der Sonnenuntergang ihres Lebens. Oder so etwas in der Art. Ohne nachzudenken, sagte ich, das sei doch nur eine abgedroschene Metapher. Er schaute mich verwundert an, blieb aber stumm. Erst nach einigen Minuten meinte er: Bei denen gibt es keine Metaphern.
… Im Oktober und November 1989 passierte ein ganzer Haufen Dinge, die schon zur Genüge bekannt und beschrieben worden sind. Ich lungerte auf den Plätzen herum und schrieb nicht an Gaustín. Ich hatte auch andere Probleme, ich bereitete gerade mein erstes Buch vor, heiratete. Alles dumme Ausreden natürlich. Aber während dieser Zeit dachte ich oft an ihn. Auch er schrieb nicht.
Die erste Postkarte erhielt ich exakt am 2. Januar 1990, eine offene Weihnachtskarte mit einem nachträglich kolorierten schwarz-weißen Schneewittchen, das an Judy Garland erinnerte. Es hielt einen Zauberstab in der Hand, der auf die mit großer Schrift geschriebene Jahreszahl 1929 zeigte. Auf der Rückseite der Karte standen meine Adresse und knapp gehaltene Neujahrswünsche, mit Tusche geschrieben, nach der damaligen Orthographie, mit allen möglichen harten und weichen Zeichen am Wortende und anderen, nicht mehr verwendeten Buchstaben. Sie endete mit »Ich wage es, mich Dein Gaustín zu nennen«. Ich setzte mich gleich hin und antwortete ihm mit einem Brief, in dem ich mich für die angenehme Überraschung bedankte und schrieb, dass ich seine elegante Mystifikation wirklich zu schätzen wisse.
Noch in derselben Woche erhielt ich eine Antwort. Ich öffnete den Umschlag vorsichtig, darin waren zwei blassgrüne Blätter mit Wasserzeichen, nur auf einer Seite mit derselben anmutigen Handschrift beschrieben, unter strenger Einhaltung der alten, wenn ich mich nicht täusche, auf Omarčevski zurückgehenden Rechtschreibung der 20er Jahre. Er schrieb, dass er nirgendwohin gehe, sich aber ausgezeichnet fühle. Er habe die Tageszeitung »Zora« abonniert, unter der »sehr objektiven Redaktion von Herrn Krapčev«, und die Zeitschrift »Zlatorog«, um immerhin auf dem Laufenden zu bleiben, wohin sich die Literatur entwickelte. Er fragte mich, was ich von der Suspendierung der Verfassung halte und von der Auflösung des Parlamentes durch den jugoslawischen König Aleksandar am sechsten dieses Monats, worüber »Zora« bereits am folgenden Tag berichtet habe. Er beendete seinen Brief mit einem Postskriptum, in dem er sich entschuldigte, dass er nicht verstanden habe, was ich mit »eleganter Mystifikation« meinte.
Ich las den Brief noch einige Male, drehte und wendete ihn in meinen Händen, schnupperte an ihm in der Hoffnung, wenigstens irgendein Anzeichen von Ironie zu entdecken. Vergeblich. Wenn das ein Spiel war, lud mich Gaustín ohne jegliche Präzisierung der Regeln ein mitzuspielen. Also gut, ich entschied mich, sein Spiel zu spielen. Weil ich keinerlei Kenntnisse über das verfluchte Jahr 1929 hatte, musste ich die nächsten drei Tage in der Bibliothek verbringen, in alten Ausgaben von »Zora« wühlend, die zu allem Überfluss auch nur auf Mikrofilm existierten. Ich las aufmerksam über den Fürsten Aleksandar. Ich warf für jeden Fall einen Blick auf die anstehenden Ereignisse: »Trotzki aus UdSSR verjagt«, »Die Deutschen akzeptieren den Briand-Kellogg-Pakt«, »Mussolini unterschreibt eine Übereinkunft mit dem Papst«, »Frankreich gewährt Trotzki kein politisches Asyl«, einen Monat später »Deutschland gewährt Trotzki kein politisches Asyl«, ich gelangte schließlich zu »Börsenkrach an der Wall Street« am 24. Oktober. Noch in der Bibliothek schrieb ich Gaustín eine kurze und, wie mir schien, kühle Antwort, wo ich auf die Schnelle meine Meinung zu den Ereignissen in Jugoslawien mitteilte (welche verdächtig genau mit der des Herausgebers Herrn Krapčev übereinstimmte) und ihn bat, mir die Dinge zu schicken, an denen er gerade arbeitete, weil ich mir davon zu erfahren erhoffte, was genau vor sich ging.
Sein nächster Brief kam erst eineinhalb Monate später. Er entschuldigte sich, dass ihn eine heimtückische Influenza befallen habe und er nicht im Stande gewesen sei, auch nur irgendetwas zu tun. Unter anderem fragte er, ob ich glaubte, dass Frankreich Trotzki aufnehmen würde. Lange überlegte ich, ob ich der ganzen Geschichte nicht ein Ende setzen und ihm einen ernüchternden Brief schreiben sollte, doch ich entschied mich, noch ein wenig weiter mitzuspielen. Ich gab ihm einige Ratschläge bezüglich der Influenza, die er allerdings bereits selbst in »Zora« gelesen hatte, riet ihm, nicht viel auszugehen und jeden Abend ein warmes Fußbad in gesättigter Salzlösung zu nehmen. Ich zweifelte stark daran, dass Frankreich Trotzki politisches Asyl gewähren würde, wie übrigens auch Deutschland nicht. Als sein nächster Brief ankam, hatte Frankreich es wirklich abgelehnt, Trotzki aufzunehmen, und Gaustín schrieb mit Begeisterung, dass ich jedenfalls ein »kolossales politisches Gespür« hätte. Dieser Brief war länger als die früheren aufgrund noch zweier anderer Begeisterungen seinerseits. Die eine rührte von der soeben publizierten Ausgabe von »Zlatorog« her und der darin abgedruckten neuen Auswahl von Gedichten Bagrjanas, die andere von einem Radioapparat Marke »Telefunken«, den er jetzt zu reparieren versuchte. Zu diesem Zwecke bat er mich, ihm eine Radioröhre »Valvo« aus dem Geschäft von Džabarov auf der »Aksakov« Straße Nr. 5 zu schicken. Lang und breit beschrieb er mir die Demonstration eines mit zwölf Röhren bestückten Apparats von Dr. Reißer in Berlin, der auf Kurzwelle mit automatischer Regulierung des Fadings empfange. »Damit wird man sogar Konzerte aus Amerika hören können, kannst Du Dir das vorstellen?«
Nach diesem Brief beschloss ich, nicht weiter zu antworten. Er schrieb mir auch nicht mehr. Weder zum nächsten Neujahr, noch zum übernächsten. Allmählich verblasste die Erinnerung, und wenn da nicht einige Briefe wären, die ich immer noch aufbewahre, würde ich wahrscheinlich selbst nicht daran glauben. Aber es sollte anders kommen. Einige Jahre später erhielt ich erneut einen Brief von Gaustín. Ich hatte böse Vorahnungen und es nicht eilig, ihn zu öffnen. Ich fragte mich, ob er nach so langer Zeit Vernunft angenommen oder die Dinge sich eher noch verschlimmert hatten. Ich öffnete den Briefumschlag erst am Abend. Darin standen nur einige Zeilen geschrieben. Ich werde sie wörtlich zitieren:
Verzeih, dass ich Dich nach so langer Zeit erneut behellige. Aber Du siehst ja selbst, was rund um uns geschieht. Du liest Zeitung, und mit Deinem politischen Spürsinn hast Du bestimmt schon längst die Schlächterei, die an unserer Türschwelle steht, vorhergesehen. Die Deutschen ziehen massiv Truppen an der polnischen Grenze zusammen. Bis jetzt hatte ich Dir gegenüber noch nicht erwähnt, dass meine Mutter Jüdin ist (erinnere Dich daran, was letztes Jahr in Österreich geschehen ist, und auch an die »Kristallnacht« in Deutschland), der da wird vor nichts Halt machen. Ich habe das Notwendige veranlasst und bin fest entschlossen, morgen in aller Frühe mit dem Zug nach Madrid zu fahren, dann nach Lissabon und von dort aus nach New York …
Leb vorerst wohl!
Dein Gaustín.
14. August 1939.
Heute ist der 1. September.
Am 1. September 1939 erwacht Wystan Hugh Auden in New York und schreibt in sein Tagebuch:
Bin mit Kopfschmerzen aufgewacht nach einer Nacht böser Träume, in denen C untreu war. Die Zeitung berichtet über den deutschen Überfall auf Polen … Da hast du alles in einem echten Anfang – böse Träume, Krieg und Kopfweh.
Ich war in der New York Public Library, als ich auf diesen Eintrag in Audens Tagebuch stieß, das sonst in London aufbewahrt wird, aber durch einen glücklichen Zufall war sein Archiv vorübergehend in New York.
Nur ein Tagebuch kann auf diese Weise Persönliches und Historisches zusammenbringen. Die Welt ist nicht mehr dieselbe – Deutschland überfällt Polen, der Krieg beginnt, mir tut der Kopf weh, und dieser Idiot C besitzt die Unverfrorenheit, mir im Traum untreu zu werden. Heute im Traum, morgen in Wirklichkeit (ob er sich das gedacht hat?). Mit dem Erkennen von Untreue beginnt Schahriyar das große Abschlachten von Frauen in »Tausendundeine Nacht«. Ob Auden sich bewusst war, wie viele Dinge jene zwei Zeilen registrieren, wie genau, persönlich und zynisch genau sie sind. Zwei Zeilen über den wichtigsten Tag des Jahrhunderts. Am selben Tag, nachdem das Kopfweh leicht verflogen ist, wird er einige Verse zu Papier bringen:
I sit in one of the dives
On Fifty-second Street
Uncertain and afraid …
Und hier bereits die Spelunke in der 52sten, das Kopfweh, die Untreue und der böse Traum, der Überfall auf Polen an jenem 1. September – alles ist zu Geschichte geworden. Das Gedicht wird genau so heißen: 1. September 1939.
Wann wird aus Alltag Geschichte?
Eine Sekunde nur. Hängt jenes so oft zitierte We must love one another or die gegen Ende des Gedichts, das Auden später angeblich überhaupt nicht gefiel und das er ständig wegließ, nicht gerade mit dieser geträumten Untreue zusammen? Wer würde sich gern an solche Albträume erinnern?
Ich würde gern alles über diesen Tag wissen, ein Tag im Herbst 1939, würde gern mit jedem in den Küchen der Welt sitzen, in die Zeitung hineinsehen, die er aufgeschlagen hat, während er seinen Kaffee trinkt, begierig alles lesen – von den an der deutsch-polnischen Grenze zusammengezogenen Truppen bis zu den letzten Tagen des Sommerschlussverkaufs und der neuen Bar »Cinzano«, die in Lower Manhattan öffnet. Der Herbst liegt schon in der Luft, die Werbeflächen in den Zeitungen, im Voraus bezahlt, stehen jetzt in Nachbarschaft zu den kurzen Kommuniqués über die letzten Stunden in Europa.
An einem anderen 1. September werde ich auf dem Rasen im Bryant Park sitzen, die Spelunke in der 52sten gibt es schon lange nicht mehr, ich bin soeben aus Europa gekommen, und müde (die Seele hat ebenfalls Jetlag) werde ich die Gesichter der Menschen betrachten. Ich habe den kleinen Band von Auden mitgenommen, immerhin sind wir uns das Ritual schuldig. Nach einem Tag, verbracht in der Bibliothek, sitze ich hier »unsicher und ängstlich«. Ich habe schlecht geschlafen, habe nicht von Untreue geträumt, oder ich habe davon geträumt, habe sie aber vergessen … Die Welt steht auf der gleichen Stufe von Beunruhigung, der örtliche Sheriff und der Sheriff eines weit entfernten Landes bedrohen sich gegenseitig. Sie tun es über Twitter, begrenzt auf einige Zeichen. Die alte Rhetorik gibt es nicht mehr, es gibt keine Redegewandtheit. Ein Köfferchen, ein Knopf und … Ende des Arbeitstages für die Welt. Eine Beamtenapokalypse.
Ja, die alten Spelunken und die alten Meister gibt es nicht mehr, der Krieg, der damals bevorstand, ist ebenfalls vorbei, auch andere Kriege sind vorbei, nur die Beunruhigung ist geblieben.
I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Irgendwo in der Nähe lief der Song der Doors, und auf einmal kam es mir so vor, als würde hier ein heimliches Gespräch stattfinden, als ob Morrison tatsächlich mit Auden spricht. Und genau dieser Refrain, diese Replik, ist gleichsam die Lösung für das Zögern in jener von Auden selbst so ungeliebten Zeile, We must love one another or die. Bei Morrison gibt es kein Zögern mehr, die Antwort ist kategorisch: I tell you we must die.
Nach gewisser Recherche entdecke ich, dass das Lied bereits 1925 von Brecht mit Musik von Kurt Weill geschrieben wurde. Er selbst singt es 1930 wie wahnsinnig, am Rande des Entsetzlichen … Und das macht die Dinge noch verworrener. Auden hat den Vers von jenem Lied Brechts entgegengenommen und umgedreht, und eigentlich spricht er mit ihm. Sowohl Brecht von 1925 als auch Morrison von 1969 folgen dem Tod. Ich sage dir, wir müssen sterben. Vor ihrem Hintergrund klingt Auden so, als würde er noch immer eine Chance sehen – uns lieben oder sterben. Nur vor Kriegen, selbst an ihrem Vorabend, ist der Mensch geneigt zu hoffen. Am 1. September hätte die Welt wahrscheinlich noch gerettet werden können.
Ich bin als dringender Fall hierhergekommen, wie man für gewöhnlich nach New York kommt, vor etwas auf der Flucht, auf der Suche nach etwas anderem. Ich floh vor dem Kontinent der Vergangenheit an einen Ort, der behauptete, keine Vergangenheit zu besitzen, auch wenn er in der Zwischenzeit welche gesammelt hatte. Ich hatte ein gelbes Notizbuch dabei, ich suchte einen Menschen, ich wollte erzählen, solange mich das Gedächtnis noch nicht verlassen hatte.
Einige Jahre früher werde ich mich in einer Stadt aufhalten, wo es kein 1939 gegeben hat. Eine Stadt, die gut zum Leben ist und noch besser zum Sterben. Eine Stadt so ruhig wie ein Friedhof. Ist dir nicht langweilig, fragt man mich am Telefon. Die Langeweile ist das Emblem dieser Stadt. In ihr haben Canetti, Joyce, Dürrenmatt, Frisch und sogar Thomas Mann sich gelangweilt. Es ist irgendwie unangenehm, seine Langeweile mit der ihren zu messen. Mir ist nicht langweilig, sage ich. Wer bin ich, dass mir langweilig wäre. Obwohl ich heimlich Lust hätte, vom Luxus der Langeweile zu kosten.
Es war einige Zeit vergangen, seit ich die Spur Gaustíns in Wien verloren hatte.
Ich wartete darauf, irgendwoher ein Zeichen von ihm zu erhalten, ich sah die Seiten der abwegigsten Zeitungen durch, aber offensichtlich war er vorsichtiger geworden. Eines Tages bekam ich eine offene Karte, ohne Namen und Rücksendeadresse.
Grüße aus Zürich, ich habe mir etwas ausgedacht, wenn es klappt, werde ich schreiben.
Das konnte nur Gaustín sein. Die folgenden Monate schrieb er nicht, aber ich beeilte mich, eine Einladung für einen kurzen Aufenthalt im dortigen Literaturhaus anzunehmen.